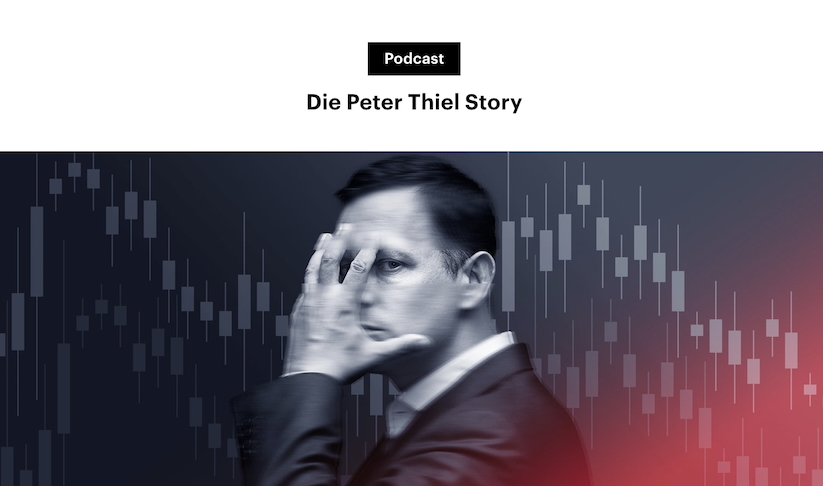Jürgen Klopp im DOAC-Podcast: „Ich bin kein ständiger Gewinner, ich bin ein ständiger Versucher“ 21 Oct 5:18 AM (20 hours ago)
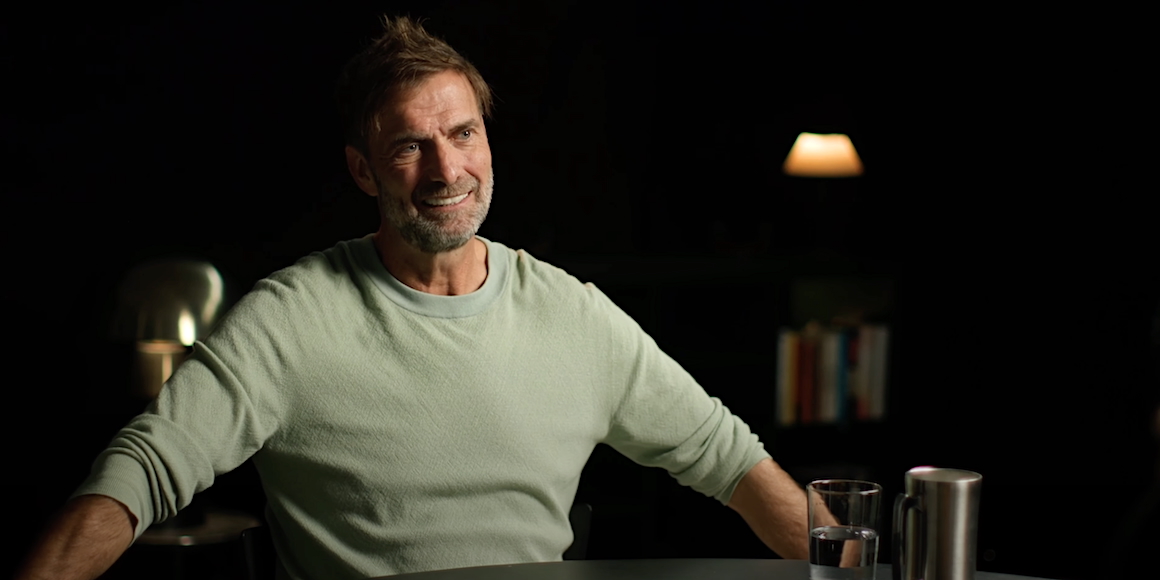
Jürgen Klopp spricht im DOAC Podcast so offen wie selten. Es geht weniger um Taktik oder Tabellen, sondern um Herkunft, Charakter und Führung. Klopp erzählt, wie ihn zwei gegensätzliche Eltern prägten: eine fürsorgliche Mutter, die ihn vorbehaltlos liebte, und ein ehrgeiziger Vater, der Erwartungen hatte. Diese Mischung aus Empathie und Ehrgeiz wurde zum Fundament seines Führungsstils. „Mein Vater wollte, dass ich in allem gut bin. Meine Mutter war einfach glücklich, dass ich da war.“
Er erinnert sich an die frühen Jahre in Glatten, an Wintersportduelle mit dem Vater, an die Angst, mit 20 Vater zu werden, und an das Gefühl, über Nacht erwachsen zu sein. „Die Nacht, in der mein Sohn geboren wurde, war die Nacht, in der ich erwachsen wurde.“ Diese Verantwortung, sagt Jürgen Klopp, habe ihn geformt – Disziplin, Mitgefühl, Durchhaltevermögen.
Jürgen Klopp x DOAC – Der Weg vom Kämpfer zum Coach
Als Spieler war Klopp kein Ausnahmetalent. „Meine Mitspieler waren besser, aber ich konnte alles geben. Von der ersten bis zur letzten Minute.“ Genau diese Mentalität übertrug er später auf seine Teams: 90 Minuten „Heavy Metal“, kein Rückzug, kein Sicherheitsfußball.
Als er 2001 von einem Tag auf den anderen Cheftrainer in Mainz wurde, war der Club sportlich am Boden. Klopp übernahm aus Loyalität – und gewann sofort. „Wir waren wie Maschinen. Niemand wollte mehr gegen uns spielen.“ Der Aufstieg 2004 war nicht Glück, sondern die Belohnung aus Niederlagen. „Ich habe zuerst gelernt zu verlieren – das war entscheidend.“
„Ich bin hier nicht, um alles zu bekommen, sondern um alles zu geben“
Klopp spricht viel über Scheitern – und über Haltung. Die verpassten Meisterschaften mit Dortmund oder Liverpool seien keine Wunden, sondern Lehrstücke. „Ich sehe mich nicht als ständigen Gewinner, sondern als ständigen Versucher.“ Er erklärt, dass Misserfolge Charakter formen, wenn man sie versteht. „Eine Niederlage ist nur dann eine Niederlage, wenn du nichts daraus lernst.“
Diese Einstellung machte ihn zum Anführer, der Menschen formt. „Führung bedeutet, nicht alle gleich zu behandeln. Jeder braucht etwas anderes, um sein Bestes zu geben.“ Klopp erzählt, wie er junge Spieler wie Alexander-Arnold anders führte als Routiniers wie James Milner. Und wie wichtig es ist, Spieler zu verstehen, statt sie zu verurteilen: „Frag ihn, warum er schlecht trainiert. Vielleicht hat er nicht geschlafen, weil zu Hause was passiert ist.“
Manchester United? „Das war nicht mein Projekt“
Einer der überraschendsten Momente: Klopp bestätigt, dass Manchester United ihn 2013 nach Fergusons Rücktritt wollte – doch er lehnte ab. „Sie sagten, wir holen jeden Spieler, den wir wollen. Aber das war nicht mein Projekt.“ Liverpool hingegen überzeugte ihn mit Bodenständigkeit, nicht mit Glamour.
Seine Entscheidung: „Ich will Teil eines Fußballprojekts sein, nicht eines PR-Projekts.“ Als der Anruf aus Liverpool kam, wusste er sofort: Das passt. „Meine Jungs sagten nur: ‚Ja, Papa, mach das!‘“
Liverpool: Fußball als Gemeinschaft
Klopp beschreibt im Podcast (YT), was der „Liverpool Way“ für ihn bedeutet: „Du musst verstehen, dass dieser Club für die Menschen mehr ist als Fußball.“ Seine Spieler sollten fühlen, dass sie Teil von etwas Größerem sind. „Wenn wir in 15 Jahren zurückblicken, sollen wir sagen: Das war das Beste, was wir geben konnten.“
Sein Stil – Pressing, Emotion, Zusammenhalt – machte Liverpool zur Einheit. Siege wie das 4:0 gegen Barcelona oder der Champions-League-Triumph 2019 sind für ihn Ausdruck dieser Verbindung. Doch Klopp betont auch: „Manchmal gewinnst du 1:0. Dann musst du dich genauso freuen.“
Jürgen Klopp x DOAC – Über Arne Slot und das Loslassen
Über seinen Nachfolger Arne Slot spricht Klopp mit Respekt. „Er hat’s perfekt gemacht. Er hat nicht alles geändert – das war super smart.“ Für Klopp zeigt Slots Erfolg, dass wahre Größe im Vertrauen liegt, nicht in Eitelkeit. „Ich wollte, dass er Erfolg hat. Wer anders denkt, hat etwas falsch verstanden.“
Ob er selbst eines Tages zurückkehrt? „Es ist möglich“, sagt Klopp – mit diesem typischen Zwinkern zwischen Ehrlichkeit und Understatement. Aber jetzt brauche er eine Pause. „Man kann nicht sagen: ‚Gebt mir ein Jahr, ich komm wieder.‘ In diesem Geschäft geht das nicht.“
Fazit: Der Mensch, nicht nur der Trainer
Jürgen Klopp bleibt das, was Christian Heidel in der Grußbotschaft nannte: ein echter Mensch, der Städte verändert hat, weil er Herzen berührte. Seine Philosophie passt in einen Satz: „Wenn du nicht glauben kannst, dass du es schaffst – dann glaub mir, ich tue es.“
Er führte Mainz in die Bundesliga, Dortmund zum Double, Liverpool zum Gipfel Europas. Aber vor allem führte er Menschen zu sich selbst.
Jürgen Klopp im DOAC-Podcast: „Ich bin kein ständiger Gewinner, ich bin ein ständiger Versucher“
South Park S28E01 – „Twisted Christian“ erklärt: Wenn Memes, Macht und Messiasse verschmelzen 21 Oct 12:45 AM (yesterday, 12:45 am)

Mit „Twisted Christian“ gelingt Trey Parker und Matt Stone ein weiterer Geniestreich. Die Episode nimmt moderne Religiosität, politische Heuchelei und Internet-Dummheit so präzise aufs Korn, dass selbst langjährige South-Park-Fans kurz innehalten. Der Ausgangspunkt ist banal: Kinder in South Park flüstern plötzlich „Six, Seven“. Ein bedeutungsloses Meme, das in sozialen Netzwerken kursiert – ohne Ursprung, ohne Sinn, ohne Ziel. Doch wie immer verwandelt sich das Lächerliche binnen Minuten in eine gesellschaftliche Katastrophe. South Park S28E01 – „Twisted Christian“ erklärt: Wenn Memes, Macht und Messiasse verschmelzen.
Lehrer und Eltern geraten in Panik. Der neue „Power Christian Principal“ deutet die Zahlen als satanisches Signal, ruft eine Schulversammlung ein und lädt ausgerechnet Tech-Milliardär Peter Thiel ein, um über den Antichristen zu sprechen. Die Erwachsenen reagieren auf harmlose Jugendkultur wie auf dämonische Bedrohung – und damit beginnt die eigentliche Satire: ein Porträt einer Gesellschaft, die in jeder viralen Bewegung das Werk des Teufels sieht.
Peter Thiel, der Antichrist und die Daten
Thiel tritt hier als Karikatur seiner selbst auf: blass, emotionslos, unheimlich ruhig. Seine PowerPoint-Präsentation verbindet Bibelverse mit Wi-Fi-Frequenzen, Engel mit Algorithmen. Laut seiner Theorie „operieren Daten und Dämonen auf derselben Wellenlänge“. Es ist einer der absurdesten, aber auch treffendsten Momente der Staffel. Denn der reale Peter Thiel hält tatsächlich Vorträge über den Antichristen und kontrolliert mit Palantir ein Unternehmen, das für militärische Überwachung und künstliche Intelligenz steht.
South Park greift diesen Widerspruch brillant auf: Der Mann, der die Welt überwacht, warnt vor einer dämonischen Macht – und schafft sie zugleich selbst. Thiel nutzt den Hype um das 6/7-Meme, um Panik zu erzeugen und so noch mehr Datenzugriff zu rechtfertigen. Damit gelingt Parker und Stone ein Seitenhieb auf Tech-Oligarchen, die religiöse Rhetorik für politische Kontrolle instrumentalisieren.
South Park Twisted Christian erklärt – Cartman, der Besessene
Natürlich steht Cartman wieder im Zentrum des Wahnsinns. Zuerst nutzt er das Meme, um eine eigene Kirche zu gründen – die „6 to 7 Ministries“. Dann beginnt er, grün zu kotzen, zu levitieren und Bibelzitate zu schreien, die er nie gelesen hat. Die Szenen erinnern an Der Exorzist – nur eben mit Cartman.
Die Erwachsenen holen Peter Thiel zur Austreibung. Doch statt Weihwasser bringt er einen Laptop mit. Er spricht von „metaphysischem Datentransfer“ und zeichnet Cartmans Krämpfe auf, um sie anschließend in Washington auszuwerten. Hier verknüpft sich das Lächerliche mit echtem Unbehagen: Religion, Technologie und Kontrolle bilden ein Dreieck der Manipulation.
Jesus kehrt zurück – und erkennt seine Religion nicht mehr
Parallel dazu kehrt Jesus nach South Park zurück. Aber dieser Jesus ist anders: zynisch, genervt, sichtlich überfordert. Seine erste Reaktion: „Ich bin 2000 Jahre weg, und ihr macht aus meinem Namen eine politische Marke.“ Er besucht eine Kirche, in der MAGA-Anhänger „Jesus 2024“-Merchandise verkaufen, und trifft PC Principal, der nun „Power Christian Principal“ heißt.
In einem der stärksten Dialoge der Folge sagt Jesus:
„Du und viele andere habt ein sehr verdrehtes Verständnis davon, was Christentum ist.“
PC Principal reagiert darauf, indem er Jesus verprügelt – ein Sinnbild für die Aggression des modernen Glaubens, der alles verteidigt, was Liebe, Mitgefühl und Selbstreflexion längst verloren hat. Am Ende gibt Jesus auf. Er schneidet sich den Bart ab, zieht ein Muskelshirt an und passt sich an. Das Symbol: Selbst der Sohn Gottes kann in dieser Kultur nur überleben, wenn er sich dem Zynismus anpasst.
Trump, Satan und das Ende der Welt
Parallel spinnt sich die größere Staffelhandlung weiter: Satan ist schwanger – von Donald Trump. Die groteske Idee dient als Allegorie auf politische Verderbnis. JD Vance, in der Serie ein religiöser Machtmensch, will das dämonische Baby abtreiben lassen, um selbst als neuer Messias zu gelten. Thiel und Vance sehen in Cartmans „Besessenheit“ den Schlüssel, um das Kind des Teufels zu lokalisieren.
Das Ergebnis: In Twisted Christian endet alles offen. Peter Thiel scheitert mit dem Exorzismus und kündigt an, Cartman „nach Washington zu bringen“. Viele Fans sehen darin den Auftakt zu einer größeren Storyline, in der Überwachungsdrohnen über Colorado kreisen und sich Jesus, Satan und Trump auf ein kommendes Armageddon vorbereiten könnten. Laut YouTube-Breakdowns und Reddit-Diskussionen zeigen Trailer-Hinweise bereits ein dämonisches Baby in einer goldenen Wiege, das leise „Six… seven…“ summt – eine unheimliche Symbolik für die nächste Staffelphase. Ob diese Szenen tatsächlich erscheinen oder nur Metaphern bleiben, ist offen. Sicher ist nur: South Park deutet an, dass Sinnlosigkeit längst die neue Religion geworden ist.
South Park Twisted Christian erklärt – Die Moral im Chaos
„Twisted Christian“ funktioniert auf mehreren Ebenen. Es ist ein Kommentar über das moderne Christentum, das sich selbst nicht mehr erkennt. Es ist eine Satire auf Tech-Eliten, die mit esoterischem Machtgehabe ihre Überwachung rechtfertigen. Und es ist eine Parodie auf Social-Media-Kultur, die aus jeder Belanglosigkeit ein göttliches Zeichen macht.
Reddit-Diskussionen lobten die Episode als „erschreckend realistisch“, weil sie die Verschmelzung von Glaube, Angst und Algorithmus so präzise zeigt. Auf YouTube sahen viele Fans in Thiels Figur die perfekte Personifikation des digitalen Antichristen – jemand, der an das Böse glaubt, während er es erschafft.
Fazit | tl;dr
„Twisted Christian“ ist South Park in Reinform: schockierend, komisch, klug. Hinter jedem ekelhaften Gag steckt ein Spiegel für unsere Zeit. Zwischen 6/7-Memes, religiöser Hysterie und technokratischem Größenwahn zeigt die Serie, dass der wahre Antichrist nicht im Himmel oder in der Hölle sitzt – sondern wahrscheinlich im Silicon Valley.
South Park S28E01 – 6-7
South Park zerlegt das moderne Christentum:
South Park S27E06 / S28E01 – Zusammenfassung und Analyse:
South Park Meme 6-7 erklärt:
Was es wirklich bedeutet, der Cycle Breaker in deiner Familie zu sein 20 Oct 3:53 AM (yesterday, 3:53 am)

Wenn jemand in einer Familie beschließt, alte Muster zu durchbrechen, beginnt eine stille Revolution. Dieser Mensch wird zum sogenannten Cycle Breaker – jemand, der das Schweigen beendet und sich für Heilung entscheidet. Dabei geht es nicht um einen Moment der Erleuchtung, sondern um viele Nächte ohne Schlaf, um Tränen im Auto und um das Zurückhalten des Atems bei Familienessen, nur um den Frieden zu wahren.
Der unsichtbare Weg ohne Applaus
Cycle Breaker zu sein bedeutet, etwas Neues zu wählen, obwohl man nie gesehen hat, wie es aussieht. Es gibt keinen Plan, keine Anerkennung, kein einfaches Ende. Es ist der heilige Entschluss, anders zu leben, als die Generationen zuvor. Wer diesen Weg geht, fühlt sich oft verloren, denn das Gehirn liebt Wiederholung, selbst wenn sie weh tut. Alte Muster aus Kontrolle, Scham und Schweigen wirken vertraut. Doch Heilung entsteht erst, wenn man sie bewusst verlässt.
Heilung fühlt sich oft wie Verlust an
Der Prozess ist schmerzhaft, weil er sichtbar macht, was früher verborgen war. Man erkennt, was gefehlt hat – Liebe, Sicherheit, Wahrhaftigkeit, das Recht, man selbst zu sein. Es fühlt sich wie Trauer an, obwohl tatsächlich Fortschritt geschieht. Man trauert um das, was nie existierte, und gleichzeitig wächst das Bewusstsein für das, was möglich wird.
Cycle Breaker: Wenn du plötzlich das schwarze Schaf bist
Viele, die Familienmuster brechen, erleben Ablehnung. Sie werden als empfindlich bezeichnet, als schwierig oder zu wütend. Doch es ist kein Angriff auf die Familie, sondern ein Akt der Selbstachtung. Der Bruch mit toxischer Loyalität bedeutet, endlich authentisch zu leben. Der Schmerz entsteht, weil die Menschen, die uns geprägt haben, vielleicht nie Verantwortung übernehmen. Doch darin liegt auch Freiheit.
Die Macht, das Unsagbare zu benennen
Autorin Brené Brown sagt: „Scham gedeiht im Schweigen. Wenn wir sie benennen, nehmen wir ihr die Luft.“ Genau das tun Cycle Breaker. Sie sprechen aus, was Generationen verschweigen mussten. Sie geben Worten, was ihre Eltern und Großeltern nie aussprechen durften. Dadurch heilen sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Wunden ihrer Ahnen. Jede Träne, die heute fließt, reinigt ein Stück Vergangenheit.
Tausend kleine Schritte Richtung Freiheit
Der Bruch mit alten Mustern geschieht nicht in einem Moment. Es sind unzählige kleine Entscheidungen. Man sagt Nein, auch wenn es Angst macht. Man beginnt Therapie, schreibt Tagebuch, lernt sich zu beruhigen. Man hört auf, um Liebe zu kämpfen, die an Bedingungen geknüpft war. Heilung sieht nicht immer schön aus. Manchmal herrscht Chaos, manchmal Frieden. Doch beides ist Teil des Weges.
Cycle Breaker – Authentizität statt Anpassung
Als Kinder wählen wir Bindung, um zu überleben. Als Erwachsene lernen wir, Authentizität zu wählen, um zu leben. Zum ersten Mal entsteht eine neue Wahrheit: man darf echt sein, ohne Angst vor Ablehnung. Wenn du dich nicht länger entschuldigst, weil du anders bist, brichst du den Zyklus. Niemand klatscht, doch dein inneres Kind spürt die Befreiung.
Drei Werkzeuge für den Weg
Erstens: Benenne dein Handeln. Sag dir selbst, dass du einen Zyklus brichst, auch wenn es klein erscheint. Zweitens: Reparent dich selbst. Frage dich, was du einem Kind in deiner Situation sagen würdest, und sag es zu dir. Drittens: Schaffe Rituale der Regulierung – durch Atmung, Bewegung oder Stille. Dein Nervensystem lernt, Sicherheit neu zu spüren. Perfektion ist kein Ziel, Bewusstsein ist der Schlüssel.
Der stille Triumph
Cycle Breaking bedeutet nicht, ein Heiliger zu werden. Es bedeutet, echt zu werden. Du entscheidest dich für Präsenz statt Performance, für Heilung statt Verdrängung und für Wahrheit statt Tradition. Es fühlt sich an, als würdest du zerbrechen, doch in Wahrheit brichst du frei – mit jeder Grenze, jedem ehrlichen Gespräch und jedem bewussten Atemzug. Du wirst zum Vorfahren, den deine Familie gebraucht hätte, und zum Elternteil, den du dir als Kind gewünscht hast. Und das allein verändert alles.
Was es wirklich bedeutet, der Cycle Breaker in deiner Familie zu sein
Isaiah Falls – „Lucky You“: Zwischen Intimität, Glauben und Sinnlichkeit 20 Oct 1:03 AM (2 days ago)

Isaiah Falls bleibt sich treu. Auch auf seiner neuen EP Lucky You geht es ihm weniger um Lautstärke oder Drama als um Nähe und Atmosphäre. In sechs Songs entfaltet er eine leise, fast scheue Intimität, die an vertraute Gespräche im Auto erinnert – spät in der Nacht, wenn jedes Wort Gewicht bekommt. Isaiah Falls drängt sich mit „Lucky You“ nie auf, sondern lässt seine Musik fließen, ruhig und organisch.
Schon der Opener „Brown Sugah“ setzt den Ton: schwüle Florida-Luft, Soul-Schwere und eine verführerische Ruhe. Wenn Falls singt, dass „die Sonne Wunder für deine Haut“ tut, spürt man Hitze und Nähe. Gemeinsam mit SiR entsteht ein Song, der wie eine geteilte Erinnerung klingt – zwei Stimmen, die sich um dasselbe Begehren kreisen. Das Arrangement schwebt zwischen ‘70s-Soul und moderner R&B-Produktion, getragen von einem zurückgelehnten Beat. Hier funktioniert alles, weil Falls weiß, wann er schweigen und wann er singen sollte.
Zwischen Spiritualität und Körperlichkeit
Mit „God Is Real“ erreicht die EP ihren emotionalen Kern. Hier verzichtet Falls auf Gäste und große Effekte. Stattdessen bekennt er schlicht: „I know God is real by the way you make me feel.“ Diese Zeile ist keine Pose, sondern Bekenntnis – ein Versuch, Liebe und Glauben in einem Atemzug zu denken. Die Fragen des Songs („Where does your mind go? How does your heart feel?“) sind existenziell, aber nie verkopft. Das Stück erinnert daran, dass Spiritualität auch im Zwischenmenschlichen lebt.
Träume, Versuchung und moderne Romantik
„Just a Dream“ mit Alex Isley schwingt in der Mitte zwischen Nostalgie und Verführung. Isley verleiht dem Song Leichtigkeit, während Falls sich etwas zu sehr auf die Atmosphäre verlässt. Die Chemie stimmt, aber der Text bleibt an der Oberfläche. Ähnlich bei „Enticing“ mit Chase Shakur: Die Idee – Liebe als Spurensicherung („Leaving Fenty ‘round my crib“) – ist stark, doch der Song verliert sich im Vibe. Was als sinnlicher Moment beginnt, endet als Skizze. Falls’ ruhige Art ist angenehm, aber manchmal fehlt der letzte Funke, der den Song größer macht.
Wenn Einfachheit trägt
Mit dem bereits bekannten „Butterflies“ zeigt Falls, was passiert, wenn Zurückhaltung auf Präzision trifft. Gemeinsam mit Joyce Wrice entsteht ein Duett voller gegenseitiger Wertschätzung. Beide Stimmen erzählen von Liebe ohne Überschwang, dafür mit Augenhöhe. Das Stück bleibt schlicht – keine überladene Produktion, keine Effekthascherei – und genau dadurch wirkt es.
Ein stilles Bekenntnis zum Jetzt
Das Finale „Have My Babies“ klingt zunächst nach Übertreibung, entpuppt sich aber als ehrlicher Versuch, Zukunft zu benennen. Falls singt davon, Kinder mit der Geliebten zu haben, nicht aus Impuls, sondern als Ausdruck von Sehnsucht nach Dauer. Der Text wirkt stellenweise roh, doch das macht ihn glaubwürdig. Er ringt mit Worten, wie jemand, der das Richtige sagen will – und das fühlt man.
Fazit | tl;dr
Lucky You ist keine EP, die schreit oder beeindrucken will. Sie flüstert, beobachtet, fühlt. Isaiah Falls (Insta) versteht es, Intimität als ästhetisches Prinzip zu inszenieren – mal spirituell, mal sinnlich, oft beides zugleich. Nicht jeder Song sitzt perfekt, doch die besten Momente – „God Is Real“ und „Butterflies“ – zeigen, wie kraftvoll stille Ehrlichkeit klingen kann.
Isaiah Falls – „Lucky You“ // Spotify:
Isaiah Falls – „Lucky You“ // apple Music:
Yoga Nidra for Peace – 25 Minuten bewusste Ruhe mit Ally Boothroyd 17 Oct 6:03 AM (4 days ago)

Ein neues Kapitel im WHUDAT Yoga Nidra Kosmos: Mit „25 Minute Yoga Nidra for Peace“ führt uns Ally Boothroyd tiefer denn je in die Kunst der bewussten Entspannung – begleitet von einem sanften Klangteppich von Charlie Gates. Eine Praxis, die das Nervensystem erdet und innere Ruhe kultiviert – ideal als tägliche Mini-Auszeit zwischen digitalem Dauerfeuer und mentalem Overload.
Bewusste Ruhe: Eine Fortsetzung der WHUDAT-Reihe zu Yoga Nidra und NSDR
Wir haben auf WHUDAT bereits über die Wirkung von Yoga Nidra und NSDR (Non-Sleep Deep Rest) geschrieben – jene Praxis, die zwischen Schlaf und Meditation stattfindet und eine tiefgreifende Regeneration ermöglicht. Mit dieser neuen Session von Ally Boothroyd (Sarovara Yoga) schließt sich ein weiterer Kreis: „Yoga Nidra for Peace“ ist weniger Technik, mehr Einladung – ein stiller Rückzugsort, um sich selbst und die eigene innere Balance wiederzufinden.
Das Prinzip bleibt dasselbe: Der Körper ruht, der Geist bleibt wach. Zwischen Atem, Aufmerksamkeit und Visualisierung entsteht jener Zwischenzustand, in dem das autonome Nervensystem von Anspannung auf Heilung umschaltet. Boothroyd erinnert in der Einleitung bewusst an die alten Wurzeln der Praxis – als Geschenk aus der jahrtausendealten indischen Tradition – und lädt ein, diesen Moment mit Dankbarkeit zu beginnen.
Yoga Nidra for Peace – Die Struktur der Stille
Die 25 Minuten sind klar strukturiert, aber nie mechanisch. Sanft führt Ally durch Atemübungen, Body Scan und innere Bilder, begleitet von sphärischen Klängen des Musikers Charlie Gates. Zunächst geht es um das körperliche Loslassen – der Atem wird vertieft, Schultern, Gesicht und Kiefer entspannen, die Schwerkraft übernimmt. Dann wandert die Aufmerksamkeit durch den Körper, von der Stirn über das Herz bis in die Füße. Ein klassisches Element des Yoga Nidra, das hier besonders feinfühlig umgesetzt ist.
Im Mittelpunkt steht schließlich die Sankalpa, die persönliche Intention: Sätze wie „Ich vertraue meiner inneren Weisheit“ oder „Ich liebe und akzeptiere mich, wie ich bin“ wirken wie kleine Samen, die in der Stille gesetzt werden. Sie entfalten ihre Kraft nicht im rationalen Denken, sondern in den stillen Schichten des Bewusstseins.
Shanti – Frieden als Schwingung
Eines der zentralen Motive dieser Session ist das Mantra „Shanti“, das Sanskrit-Wort für Frieden. Boothroyd lässt es durch verschiedene Energiezentren wandern – Stirn, Herz, Nabel – bis es den ganzen Körper durchdringt. Dieses wiederholte „Shanti, Shanti, Shanti“ wirkt fast wie ein rhythmisches Pulsieren, ein inneres Wiegenlied für das Nervensystem.
Visuelle Bilder – etwa das Rauschen des Ozeans oder der Blick in einen sternklaren Nachthimmel – unterstützen das Loslassen. So wird Frieden nicht als abstrakter Zustand, sondern als körperlich spürbare Erfahrung vermittelt.
Yoga Nidra for Peace – Wirkung und Nachklang
Wer regelmäßig praktiziert, spürt die kumulative Wirkung: besserer Schlaf, emotionale Stabilität, mehr Präsenz im Alltag. Yoga Nidra ist keine Flucht, sondern ein Reset – eine Rückkehr zur eigenen Mitte. Genau darum geht es auch in dieser 25-Minuten-Reise: bewusst nichts tun, um wieder ganz zu sein.
Boothroyd betont am Ende, dass dieser Frieden nicht nur uns selbst zugutekommt. Jeder regulierte Atemzug, jede bewusste Pause strahlt aus – in Begegnungen, Gesprächen, Handlungen. So wird aus individueller Ruhe ein kollektiver Beitrag zu mehr Gelassenheit in einer überreizten Welt.
Fazit | tl;dr
„25 Minute Yoga Nidra for Peace“ ist eine Einladung zur Rückverbindung – mit dem Körper, dem Atem und jener Stille, die unter allem Lärm noch immer da ist. Wer die früheren WHUDAT-Beiträge zu Yoga Nidra und NSDR mochte, wird hier eine neue Tiefe finden: weniger Technik, mehr Hingabe. Ein stilles Highlight für alle, die wissen, dass wahre Regeneration nicht im Tun, sondern im bewussten Nichtstun liegt.
Yoga Nidra for Peace – 25 Minuten bewusste Ruhe mit Ally Boothroyd
Goodbye, D’Angelo – Der Mann, der uns das Fühlen beibrachte 17 Oct 2:26 AM (4 days ago)
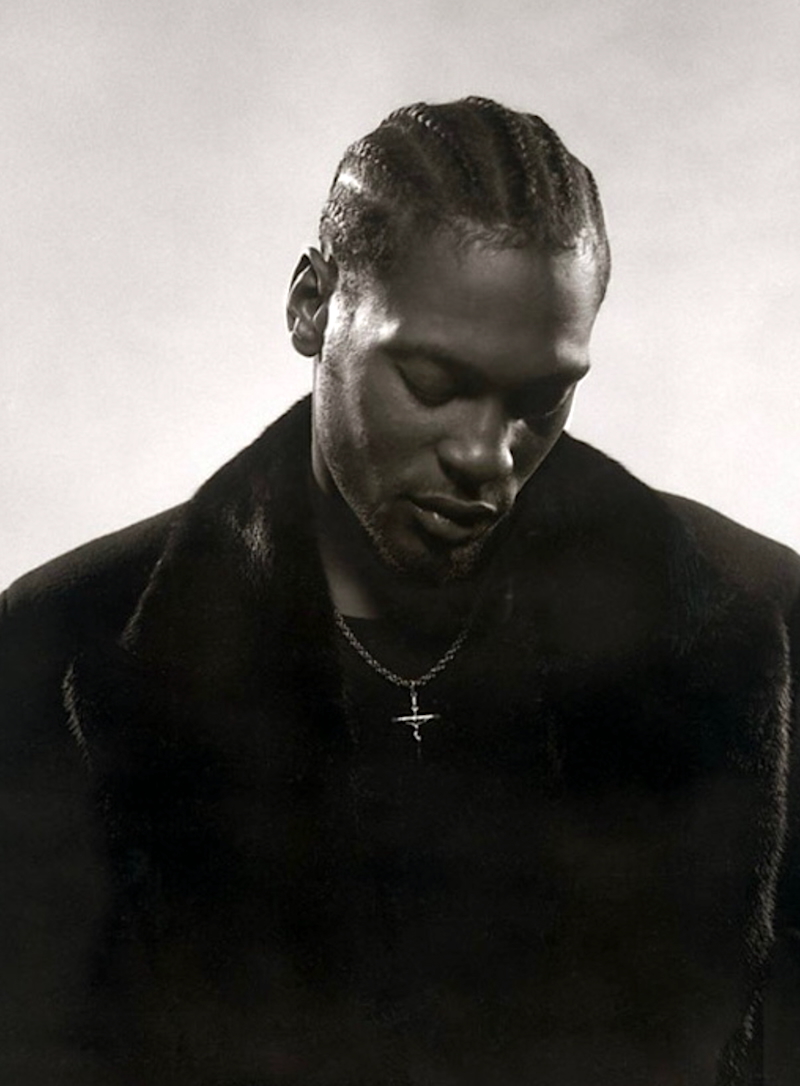 Goodbye D’Angelo: Ein persönliches Tribute zum Tod von Michael Eugene Archer (1974–2025)
Goodbye D’Angelo: Ein persönliches Tribute zum Tod von Michael Eugene Archer (1974–2025)
Der Anfang einer Liebe: „Brown Sugar“ im Vorbeigehen
Ich erinnere mich genau: Irgendwo lief dieses Stück – „Brown Sugar“. Ich blieb stehen, wusste sofort, dass das etwas ganz Besonderes war. Ich kannte den Künstler nicht, aber der Groove, diese Wärme, die Soulfulness – das war neu. Am Kieler Bahnhof, in einem kleinen Kiosk mit internationalen Magazinen, fand ich dann einen Bericht in der Source. Ich las ihn durch, kaufte kurz darauf die CD und war hin und weg.
Ich war Anfang 20, in der Blüte meines Lebens. Man nannte D’Angelos Musik damals „Babymaking Music“ – und ja, da war was dran. Es kam tatsächlich mehrfach zu den entsprechenden Momenten und ich erinnere mich, jedes Mal für die Musikauswahl gelobt worden zu sein. Nur Babys wurden keine gemacht – ich war in dieser Hinsicht stets wachsam.
Als das Album durch war, wartete ich sehnsüchtig auf Neues. Doch es kam nichts. Ein Jahr verging. Dann zwei. Erst 2000 – fünf Jahre später – erschien Voodoo. Und jeder, der diese Platte kennt, weiß: Dieses Warten hat sich gelohnt.
Die goldene Ära: Die Soulquarians und der Himmel auf Erden
Als Voodoo erschien, war die Welt bereit. Der goldene Hip-Hop & RnB der 90er hatte sich etabliert, die Soulquarians standen in voller Blüte. Diese Ära war pure Magie – ein kreatives Universum aus Groove, Spiritualität und Freiheit.
Meine persönlichen Lieblingsplatten dieser Ära? Like Water For Chocolate von Common, Mama’s Gun von Erykah Badu, Fantastic Vol. 2 von Slum Village, Things Fall Apart von The Roots und natürlich Voodoo selbst. Diese Alben veränderten alles. Sie klangen nicht nur organisch, sie fühlten sich lebendig an. Man konnte hören, dass sie in einem Raum entstanden, in dem sich Musiker gegenseitig befeuerten.
Voodoo war für mich der Inbegriff dieser Energie. Und auch hier: unzählige Babymaking-Sessions. Eine davon endete legendär. Früh am Morgen, leicht angetrunken, stand ich vor der Tür einer Freundin – mit Voodoo unterm Arm. Sie öffnete im Halbschlaf. Wir landeten im Bett. Irgendwann stellte sie erschrocken fest, dass ich gar nicht ihr Freund war, für den sie mich gehalten hatte. Eine Anekdote, die mich bis heute begleitet – und jedes Mal, wenn „The Line“ oder „Spanish Joint“ läuft, muss ich lachen.
Goodbye D’Angelo: Das Internet und der Duct-Tape-Moment
Ein paar Jahre später wollte ich D’Angelos ikonisches Video zu Untitled (How Does It Feel) auf meine Art feiern. Ich hatte ein Blogger-Projekt namens Belly Off gestartet – ein öffentliches Abnehm-Experiment. Am Ende wollte ich meinen Fortschritt mit einem Parodie-Video krönen: nackt, verschwitzte Haut, Kamera ganz nah, genau wie D’Angelo. Nur, dass ich mir hinten mit Duct-Tape die Lovehandles zusammengeklebte – und sie am Ende des Videos löste.
Das Netz liebte es. Es wurde viral (jedenfalls für damalige Verhältnisse) und die Kommentare unter dem Post auf WHUDAT zeigen, dass Humor, Musik und Selbstironie sich bestens vertragen. Ich glaube, D’Angelo hätte das gefeiert.
Die Rückkehr: Black Messiah und das Wiederauferstehen
Dann kam wieder Stille. Ein Jahrzehnt. Man dachte, D’Angelo sei verloren – gefangen zwischen Ruhm, Körperbild und inneren Dämonen. Doch 2014, nach 14 Jahren Pause, erschien Black Messiah. Ohne Ankündigung, mitten in einer Zeit gesellschaftlicher Unruhe. Dieses Album war anders – reifer, kantiger, politischer. D’Angelo war nicht mehr der sanfte Crooner, sondern ein Überlebender. Black Messiah gewann zwei Grammys, einen für „Really Love“ als besten RnB-Song; bis heute halte ich es für eines der schönsten Liebeslieder überhaupt. Dieses Stück atmet Zärtlichkeit, ohne je kitschig zu sein.
Und das ist vielleicht D’Angelos größtes Vermächtnis: Er schrieb Liebeslieder, die nie cheesy waren. Sie waren ehrlich, verletzlich, körperlich. Sie rochen nach Haut, klangen nach Sehnsucht und fühlten sich an wie Nähe.
Der Abschied: Goodbye, D’Angelo
Jetzt ist er gegangen. Mit nur 51 Jahren. Ein stiller, intensiver Künstler, der in drei Alben mehr über Liebe, Schmerz, Lust und Spiritualität gesagt hat als andere in zwanzig. Er war Multiinstrumentalist, Komponist, Performer – aber vor allem ein Mensch mit Seele. Seine Musik war eine Sprache, die jeder verstand, egal ob im Club, im Bett oder im Auto bei Nacht.
Wir verabschieden uns heute mit schwerem Herzen, aber auch mit Dankbarkeit. Für Brown Sugar, für Voodoo, für Black Messiah. Für all die Nächte, in denen wir tanzten, liebten, litten, heilten. – We love you, D’Angelo. Rest easy, brother.
____
Goodbye, D’Angelo // Tribute Special Edition // Vinyl Session
Das Tribute-Mixtape „Goodbye, D’Angelo“ ist eine liebevolle Hommage an einen der größten Soul-Künstler unserer Zeit. Kuratiert von Chilled Sundays, führt es durch alle Phasen seines Schaffens – von den sinnlichen Momenten auf Brown Sugar über die erdigen Grooves von Voodoo bis zur spirituellen Tiefe von Black Messiah. Eingebettet zwischen Kollaborationen mit Lauryn Hill, Method Man, Common oder Erykah Badu entsteht ein fließender Soundtrack, der nicht nur D’Angelos musikalisches Vermächtnis ehrt, sondern auch das Gefühl einfängt, das seine Musik immer auslöste: Liebe, Sehnsucht und pure Seele.
Last but not Least: This IS D’Angelo (Playlist):
Der böse Zwilling der Erleuchtung – Wie echte Wachheit und künstliche Kontrolle verwechselt werden 16 Oct 7:08 AM (5 days ago)

Was passiert, wenn Erleuchtung zur Waffe wird? Das Video “Der böse Zwilling der Erleuchtung” untersucht, wie sich echtes Erwachen von psychologischer Manipulation unterscheidet – und warum viele Menschen heute im Zustand geistiger Abwesenheit leben, während sie glauben, spirituell erwacht zu sein. Es geht um zwei scheinbar ähnliche, aber fundamental gegensätzliche Zustände: Bewusstheit und Dissoziation.
Echte Erleuchtung löscht das Ego nicht aus – sie entthront es nur. Der Mensch bleibt ganz, doch er erkennt, dass die Grenze zwischen „Ich“ und „Du“ Illusion war. Aus dieser Klarheit entsteht Mitgefühl ganz von selbst. Wenn niemand mehr den Verkehr lenkt, fließt Liebe frei durch jede Handlung.
Doch diese Offenheit hat einen Schatten: dieselbe psychologische Mechanik, die zur Befreiung führt, kann auch in ihr Gegenteil kippen – in geistige Fragmentierung. Dort entsteht kein Mitgefühl, sondern Taubheit.
Der stille Krieg gegen das Bewusstsein
Im Jahr 1979 tauchte ein mysteriöses Dokument auf: Silent Weapons for Quiet Wars. Es beschrieb Methoden sozialer Kontrolle – durch ökonomischen Druck, Informationsüberflutung und gezielte Verwirrung. Ob echt oder erfunden, spielt keine Rolle. Seine Strategien sind heute sichtbarer denn je.
Regierungen, Konzerne und Medien erzeugen permanente Reize, ohne je Auflösung zu bieten. Menschen bleiben in Alarmbereitschaft, aber ohne Richtung. Diese Daueranspannung zwingt das Nervensystem zur Flucht nach innen – in eine Art emotionalen Winterschlaf. Man scrollt statt zu handeln, man konsumiert statt zu reflektieren. Das Schweigen der Bevölkerung wird zum Maßstab des Erfolgs.
Echte Spiritualität unterläuft dieses System. Wer lernt, Druck zu fühlen, ohne daran zu zerbrechen, wird unkontrollierbar. Deshalb wird „innere Ruhe“ oft pathologisiert – als Gleichgültigkeit oder gar psychische Störung. Doch zwischen Apathie und Frieden liegt eine ganze Welt.
Der böse Zwilling der Erleuchtung – Wenn Erleuchtung zur Sekte wird
Das Video zeigt, wie einige sogenannte spirituelle Lehrer diese Mechanismen pervertieren. Sie nutzen dieselben Techniken wie Geheimdienste im Kalten Krieg: Isolation, Erschöpfung, sensorische Überforderung. So entstand aus der Yogagruppe Aum Shinrikyo in Japan eine Terrorsekte, die 1995 Giftgas in der U-Bahn freisetzte.
Ihr Führer Shoko Asahara versprach Erleuchtung, beraubte seine Schüler jedoch ihrer Urteilsfähigkeit. Schlafmangel, Hunger, ekstatische Rituale – all das führte zur völligen Hingabe an seine Autorität. Wer spirituelle Wahrheit sucht, aber keine innere Stabilität besitzt, wird leicht Opfer solcher Systeme. Ähnlich funktionierte die „Selbsthilfe“-Organisation NXIVM in den USA, deren Gründer Keith Raniere seine Schüler durch seelische Zermürbung manipulierte. Was als Persönlichkeitsentwicklung begann, endete in Missbrauch und blinder Gefolgschaft.
Der Unterschied zwischen Leere und Befreiung
Hier liegt der Kern der Botschaft: Sowohl Erleuchtung als auch psychische Spaltung enthüllen, dass das Selbst nicht fest ist. Doch während das eine zur Freiheit führt, bedeutet das andere völlige Entfremdung. Das klinische Bild dazu heißt Depersonalisation-Derealisation-Störung (DPDR). Menschen, die darunter leiden, fühlen sich losgelöst vom eigenen Körper, als stünden sie neben ihrem Leben. Nichts wirkt real. Wer jedoch spirituell gereift ist, erlebt dieselbe Leere als Offenheit, nicht als Abgrund.
Der Unterschied liegt in der Vorbereitung. Meditation, Ethik, Mitgefühl – sie bilden das Fundament, das den Geist trägt, wenn das Ego fällt. Ohne diese Basis wird Leere zu Nihilismus. Mit ihr wird sie zu Weite.
Der Psychopath und der Weise
Von außen ähneln sie sich: Beide wirken furchtlos, ungerührt, außerhalb sozialer Normen. Doch ihr Ursprung unterscheidet sie radikal. Der Psychopath fühlt nichts – sein Gehirn ist defizitär. Der Erwachte fühlt alles, doch er wird nicht mehr davon beherrscht.
Der eine manipuliert, weil er andere nicht als Menschen sieht. Der andere dient, weil er keine Trennung mehr wahrnimmt. Systeme der Macht haben deshalb ein Interesse daran, spirituelle Souveränität mit Krankheit zu verwechseln. Denn wer frei von Angst, Begierde und Schuld lebt, ist schwer zu lenken.
Der Weg zurück zur Präsenz
Die größte Gefahr unserer Zeit ist nicht Gewalt, sondern Abwesenheit. Wir verlieren uns in Reizen, Meinungen, Algorithmen – und nennen das Bewusstsein. Doch die eigentliche Revolution besteht darin, wieder hier zu sein: in diesem Körper, in diesem Moment, mit diesen Gefühlen.
Der Buddha lehrte, dass Hass nicht durch Hass endet, sondern nur durch Liebe. Krishna sprach von Gleichmut zwischen Freude und Leid. Und Jesus beschrieb Liebe als Zustand jenseits des Ego. All diese Lehren führen zu derselben Erkenntnis: Wahrhaftes Erwachen macht uns nicht unempfindlich, sondern durchlässig – fähig zu fühlen, ohne zu zerbrechen.
Der böse Zwilling der Erleuchtung – Fazit
Erleuchtung ist kein Ausstieg, sondern eine Rückkehr. Sie befreit nicht vom Leben, sondern in das Leben hinein. Dissoziation dagegen flieht vor der Erfahrung. Die Systeme der Welt profitieren davon. Doch wer bereit ist, still zu werden und zu fühlen, entzieht ihnen die Macht. Der „böse Zwilling“ der Erleuchtung lockt mit Leere, aber führt in Abtrennung. Die echte Erleuchtung öffnet das Herz und beendet Krieg – den inneren wie den äußeren.
Der böse Zwilling der Erleuchtung – Wie echte Wachheit und künstliche Kontrolle verwechselt werden
Warum Kassettentapes wirklich zurückkommen – und was sie über uns verraten 16 Oct 1:03 AM (6 days ago)

Wer hätte gedacht, dass das Rattern, Spulen und magnetische Rauschen der Kassette wieder Kultstatus erlangen würde? Die Verkaufszahlen sind auf dem höchsten Stand seit zwanzig Jahren. Künstler releasen ihre Alben wieder auf Tape, Sammler zahlen bis zu 30 Euro pro Exemplar. Was zunächst nach Nostalgie klingt, entpuppt sich – wie Brandon Shaw in seiner Serie Mixtape zeigt – als tiefere Bewegung.
Kassetten sind mehr als ein Vintage-Hype. Sie erinnern an eine Zeit, in der Musik noch greifbar war. Eine Zeit, in der man sich bewusst entschied, was man hört. Während Streaming uns in endlosen Playlists verliert, zwingt uns das Tape zu Entschleunigung und Fokus. Man hört ein Album – und zwar ganz. Kein Algorithmus, keine Skip-Taste, kein Autoplay.
Warum Kassettentapes zurückkommen & Wie das Tape die Musikwelt revolutionierte
In den 1970ern war die Kassette ein Befreiungsschlag. Zum ersten Mal konnten Menschen Musik aufnehmen, vervielfältigen und mit anderen teilen – ohne Plattenlabel oder Vertriebsstrukturen. Besonders Hip-Hop verdankt der Kassette seine Geburt.
DJ Kool Herc und andere Pioniere nahmen ihre Live-Sets auf Tape auf, kopierten sie und verkauften sie weiter. So verbreitete sich eine neue Kultur von Blockparty zu Blockparty – weit bevor Radiosender sie akzeptierten. Die Mixtapes wurden zum Sprachrohr einer Bewegung, die jenseits kommerzieller Kontrolle stattfand.
Auch in anderen Teilen der Welt war das Tape eine stille Revolution. In China gelangten in den 1980ern Abermillionen sogenannter Dakou-Tapes ins Land – ausrangierte westliche Kassetten mit einem Schnitt im Gehäuse. Eigentlich Schrott, doch Bastler reparierten sie, spulten die Magnetbänder neu ein und entdeckten dadurch Musik aus aller Welt. Diese dekontextualisierten Klänge führten zu einer einzigartigen Szene, in der Country und Metal plötzlich zusammenfanden. Das Tape machte Musik universell – und unzensierbar.
Der Sprung in die Moderne: Vom Straßenmix zum Kunstwerk
In der zweiten Folge der Serie führt Shaw das Prinzip weiter. Er trifft DJ Green Lantern, eine Legende der Mixtape-Ära der 2000er. Was einst als Mitschnitt begann, wurde unter seinen Händen zur Kunstform. Mit Vierspurrecordern schichtete er Vocals, Beats und Effekte übereinander, schuf Übergänge, Skits und ganze Erzählungen.
Mixtapes waren keine reinen Compilations mehr, sondern Klangkollagen – akustische Welten zwischen Dokumentation und Fiktion. Diese kreative Freiheit machte DJs zu Produzenten und Produzenten zu Erzählern. Doch mit der Zeit verwässerte der Begriff. Labels begannen, reguläre Alben als „Mixtapes“ zu vermarkten, um Erwartungsdruck zu umgehen. Trotzdem bleibt der Kern derselbe: das Mischen, Neudenken, Rekontextualisieren. Das Mixtape ist ein Statement gegen das Glatte und Perfekte. Es feiert das Unfertige – das Menschliche.
Bing Crosby, Magnetband und der Bruch mit der Realität
Parallel dazu erzählt die Serie eine fast vergessene Geschichte. Sie beginnt in den 1930ern mit Bing Crosby, dem wohl ersten globalen Superstar. Er wollte seine Radioshows nicht mehr live senden, sondern vorproduzieren. Doch erst als der Ingenieur Jack Mullin nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Magnetband-Technik in die USA brachte, wurde das möglich.
Crosby nutzte das neue Medium nicht nur, um Sendungen aufzuzeichnen, sondern um sie zu perfektionieren. Fehler wurden herausgeschnitten, Lacher eingefügt, Dialoge neu zusammengesetzt. Die Grenze zwischen Echtzeit und Inszenierung begann zu verschwimmen – ein Vorläufer unserer heutigen Medienrealität. Was damals als technische Errungenschaft galt, war in Wahrheit der Moment, in dem Realität erstmals editierbar wurde. Von dort führt eine direkte Linie zu modernen Sampling-Methoden, digitalen Mixtapes und – ja – zu generativer KI.
Vom Aufnehmen zum Erschaffen – und wieder zurück
Rapper Lupe Fiasco kündigte kürzlich ein Projekt namens Endless Loop an: ein 24-Stunden-Radiofeed, gespeist von einer KI, die in seinem Stil neue Songs generiert – jeder nur ein einziges Mal hörbar. Damit schließt sich der Kreis: Was als Versuch begann, flüchtige Musik festzuhalten, ist heute zur algorithmischen Dauerproduktion geworden.
Brandon Shaw zieht daraus eine poetische Schlussfolgerung: Technologie spiegelt unsere Sehnsucht, festzuhalten, wer wir sind. Ob auf Magnetband, Vinyl oder Cloud – wir suchen nach einem Medium, das unsere Menschlichkeit konserviert. Vielleicht greifen deshalb wieder so viele zur Kassette. In einer Welt, in der alles sofort verfügbar ist, fühlt sich ein Tape wie ein Stück Gegenwart an, das man wirklich besitzen kann. Dreißig Minuten Wirklichkeit – handgemacht, begrenzt, echt.
Warum Kassettentapes wirklich zurückkommen – und was sie über uns verraten
Wie Rom wirklich fiel – und warum sein Untergang die Welt erschuf, in der wir heute leben 15 Oct 6:22 AM (6 days ago)

Das Römische Reich – Symbol von Macht, Ordnung und Zivilisation. Doch kaum ein Thema beschäftigt Historiker so sehr wie die Frage, wann und warum diese größte aller antiken Kulturen zerbrach. In dem Video „The Fall of Rome“ geht der US-Historiker Gregory Aldrete der Sache auf den Grund – und kommt zu einer verblüffenden Erkenntnis: Vielleicht fiel Rom nie wirklich. Wie Rom wirklich fiel – und warum sein Untergang die Welt erschuf, in der wir heute leben.
Wie Rom wirklich fiel – Von der Legende zum Imperium
Der Mythos beginnt 753 v. Chr. mit Romulus am Tiber. Aus einem kleinen Zusammenschluss lateinischer Stämme wird eine Republik, später ein Weltreich. Nach den Punischen Kriegen dominiert Rom das Mittelmeer, doch interne Machtkämpfe beenden die republikanische Ära. Mit Augustus wird 27 v. Chr. das Kaiserreich ausgerufen, das unter Trajan und Hadrian seine größte Ausdehnung erreicht – von Britannien bis Syrien.
Im 3. Jahrhundert wird das Imperium jedoch von innen zerrüttet. Seuchen, Bürgerkriege und Grenzkonflikte schwächen es. Diokletian teilt das Reich in Ost und West, und 476 n. Chr. endet die westliche Herrschaft, als Romulus Augustulus abgesetzt wird. Doch das byzantinische Ostreich überlebt – fast tausend Jahre lang, bis 1453 Konstantinopel fällt.
Wann fiel Rom – und fiel es überhaupt?
Aldrete zeigt, dass es viele mögliche „Enddaten“ gibt. Einige sehen bereits 31 v. Chr., die Schlacht von Actium, als Beginn des Niedergangs. Andere verweisen auf 180 n. Chr., den Tod von Marcus Aurelius, als Startpunkt einer Phase, die der Historiker Cassius Dio mit den Worten beschrieb: „Unsere Geschichte sinkt vom Gold ins Eisen.“
Hollywood liebt diesen Moment – Gladiator und The Fall of the Roman Empire inszenieren ihn als moralischen Wendepunkt. Doch Aldrete erinnert daran, dass die römische Kultur nach 180 n. Chr. noch jahrhundertelang Bestand hatte. Seine eigene Antwort ist deutlich: Das Römische Reich endete 1453, mit dem Fall Konstantinopels. Alles andere seien Etappen einer allmählichen Transformation.

Ursachen eines Gigantensturzes
Ein deutscher Gelehrter listete einmal 210 Gründe für Roms Untergang – von Aberglaube bis Zölibat. Aldrete filtert die wichtigsten heraus. Militärisch gesehen verlor Rom seine Stärke, weil es sich zu sehr auf fremde Truppen verließ. Germanen, Goten, Hunnen – viele kämpften längst unter römischer Flagge. Feind und Verbündeter waren kaum zu unterscheiden.
Auch wirtschaftlich zerfiel das System. Inflation, Korruption und eine ausbeuterische Steuerpolitik schwächten den Staat. Das Reich, einst auf Innovation gebaut, erstarrte in Bürokratie. Gleichzeitig führten sinkende Ernten und Handelsrückgänge zu wachsender Armut.
Und dann kam die Religion. Mit Konstantins Bekehrung zum Christentum veränderte sich das Selbstverständnis des Reiches. Rom verlor seine säkulare Identität, während die Kirche zur neuen Macht wurde. Aldrete sieht darin keinen moralischen Verfall, sondern einen Paradigmenwechsel – vom Staatsglauben zur persönlichen Erlösung.
Der Mythos vom moralischen Verfall
Die Vorstellung, Rom sei an Dekadenz und Orgien zugrunde gegangen, hält Aldrete für Unsinn. Der Durchschnittsrömer war Bauer, kein Hedonist. Die Skandale um Nero oder Caligula betrafen eine winzige Elite. Rom sei nicht an Sittenlosigkeit zerbrochen, sondern an Strukturermüdung – an einem System, das zu groß und zu komplex geworden war, um sich selbst zu tragen.
Ebenso entkräftet er Theorien über Bleivergiftung oder moralische Degeneration. Solche Erklärungen seien zu simpel und zeitlich falsch. Rom nutzte Bleirohre schon in seiner Blütezeit, und moralische Korruption existierte immer – in Aufstieg wie in Fall.

Wenn das Klima Geschichte schreibt
Besonders spannend ist Aldretes Hinweis auf Umweltfaktoren. Zwischen dem 3. Jh. v. Chr. und dem 2. Jh. n. Chr. herrschte das sogenannte Römische Klimaoptimum – eine ungewöhnlich stabile, warme Phase, die Landwirtschaft und Expansion begünstigte. Danach wurde es kühler und trockener, Seuchen wüteten, Ernten brachen ein. Vulkanausbrüche lösten im 5. Jahrhundert eine „kleine Eiszeit“ aus, die den Rest erledigte.
Wie Rom wirklich fiel – Vom Untergang zur Metamorphose
Doch Aldrete dreht die Perspektive: Vielleicht fiel Rom gar nicht – vielleicht verwandelte es sich. Die germanischen Eroberer übernahmen römisches Recht, Architektur und Sprache. Aus dem Chaos entstand Neues: das Christentum, das byzantinische Erbe, das mittelalterliche Europa.
Der vermeintliche „Fall“ war in Wahrheit eine kulturelle Neugeburt. Zwischen 300 und 700 n. Chr. entstanden die Grundlagen der modernen Welt – von Theologie über Staatsdenken bis hin zur Kunst.
Roms wahres Erbe
Am Ende bleibt Aldretes zentrale Frage: Nicht wann Rom fiel, sondern wie es über zwei Jahrtausende überdauerte. Von 753 v. Chr. bis 1453 n. Chr. – kaum eine Zivilisation war je so beständig. Vielleicht liegt ihre Größe nicht im Imperium selbst, sondern darin, dass seine Ideen – Recht, Sprache, Religion, Architektur – bis heute in uns weiterleben. Rom starb nicht. Es veränderte Gestalt. Und genau deshalb leben wir immer noch in seinem Schatten.
Wie Rom wirklich fiel – und warum sein Untergang die Welt erschuf, in der wir heute leben
Live aus dem Blue Note: Robert Glasper feiert auf „Keys To The City“ die Kunst des Moments 15 Oct 2:15 AM (6 days ago)

Robert Glasper ist längst mehr als ein Jazzpianist. Er ist eine Marke, ein Katalysator für alles, was sich zwischen Jazz, Hip-Hop und Soul bewegt. Mit “Keys To The City: Vol. 1” legt der fünffache Grammy-Gewinner Robert Glasper nun ein weiteres Album vor – jetzt auch auf allen Streamingdiensten. Das Werk ist eine Hommage an die Energie des Moments, entstanden während seiner jährlichen „ROBTOBER“-Residenz im legendären Blue Note in New York.
Robert Glasper x Keys To The City 1 – Der Puls des Blue Note
Seit sechs Jahren verwandelt Glasper den kleinen Club in Manhattan für einen Monat in ein Zentrum musikalischer Spontaneität. 49 Shows in 25 Nächten – jede mit neuen Gästen, jeder Abend ein Unikat. Aus diesen Live-Sessions speist sich nun “Keys To The City: Vol. 1”. Das Album ist kein Studio-Produkt im klassischen Sinn, sondern ein Destillat aus gelebter Improvisation. Es zeigt Glasper dort, wo er am stärksten ist: am offenen Flügel, im Dialog mit anderen Künstlern, ohne Plan B.
Eine Gästeliste wie ein Jazz-Kosmos
Bereits der Auftakt ist ein Statement. Black Thought, der lyrische Kopf von The Roots, steigt mit „Step Into The Realm“ ein – einem Klassiker seiner Band, der hier durch Glasper eine neue, schwebende Dynamik erhält. Norah Jones verleiht OutKasts „Prototype“ eine fragile, fast traumhafte Note. Thundercat spielt sich auf „Paint The World“ (Chick Corea) in tranceartige Sphären. Meshell Ndegeocello haucht dem 80s-Jam „Love You Down“ neue Sinnlichkeit ein, während Esperanza Spalding, Bilal und Yebba mit leichten, aber präzisen Akzenten den Flow erweitern.
Zwischen Vergangenheit und Gegenwart
Besonders stark ist Glasper, wenn er seine eigenen Wurzeln zitiert. „One for Grew“, seine Hommage an Mulgrew Miller, verbindet die Ära des klassischen Jazz mit seinem charakteristischen „Black Radio“-Sound. Alles klingt gleichzeitig vertraut und neu – so wie man es von Glasper kennt. Jeder Song ist eine kleine Welt, getragen von musikalischem Vertrauen. Man spürt, dass diese Sessions nicht geplant, sondern gelebt sind.
Robert Glasper x Keys To The City Vol. One – Mehr als ein Album
Parallel zum Release startet Glasper seine neue Apple-Music-Radioshow “In My Element”. Hier spricht er über laufende Projekte, Ideen und Begegnungen – ein intimer Blick in das Chaos und die Kreativität seines Alltags. Zwischen Studio, Bühne und Sendepult verschmilzt Glasper immer mehr mit seiner eigenen Vision: Musik als fortlaufendes Gespräch.
Auch die „ROBTOBER“-Reihe bleibt ein Fixpunkt. Dieses Jahr spielt er zusammen mit Raye, Questlove, Andra Day, Marsha Ambrosius, Little Brother und vielen weiteren Gästen. Dazu kommt ein Tribute-Konzert für den verstorbenen Saxofonisten Casey Benjamin, Glasper’s langjährigen Weggefährten.
Fazit
“Keys To The City: Vol. 1” ist mehr als eine Sammlung von Songs – es ist eine Momentaufnahme eines musikalischen Lebensgefühls. Robert Glasper zeigt, dass Jazz kein Museum ist, sondern ein Raum, der ständig neu erfunden wird. Er überträgt die Energie eines vollen Clubs in ein digitales Format, ohne dass etwas verloren geht. Wer dieses Album hört, versteht: Hier spielt jemand, der nicht nur Noten, sondern Menschen miteinander verbindet.
Robert Glasper – „Keys To The City“ // Spotify:
Robert Glasper – „Keys To The City“ // apple Music:
Aus dem Fels geboren – Das organische Wunder des Bailey House in Kalifornien 14 Oct 4:50 AM (7 days ago)

In den Hügeln nordöstlich von San Diego steht ein Bauwerk, das wirkt, als sei es Teil der Landschaft selbst. Das sogenannte Bailey House, entworfen vom visionären Architekten Ken Kellogg, ist mehr als nur ein Wohnhaus. Es ist eine Hommage an die Natur – gebaut aus dem Gestein des Berges, auf dem es steht, und geformt von den Elementen, die es umgeben.
Als der Arzt Dr. Joe Bailey 1972 ein Stück rohes Land erwarb, plante er zunächst ein einfaches Ranchhaus. Doch gemeinsam mit seiner Frau Barbara entschied er sich, mit Kellogg zu arbeiten – einem Architekten, der in Kalifornien aufwuchs und die Sprache der Landschaft verstand. Seine Architektur war keine bloße Konstruktion, sondern eine intuitive Reaktion auf das Zusammenspiel von Land, Luft und Licht.
Ein Künstler, kein Architekt im klassischen Sinne
Ken Kellogg gilt als Schüler der organic architecture, einer Bewegung, die von Frank Lloyd Wright geprägt wurde. Doch während Wright den Dialog zwischen Haus und Natur suchte, ging Kellogg einen Schritt weiter: Er ließ beides miteinander verschmelzen.
Seine Entwürfe sind keine Pläne auf Papier, sondern Skulpturen aus Holz, Stein und Glas. Sie entstehen aus einem tiefen Verständnis für Bewegung, Wahrnehmung und menschliche Erfahrung. Das Bailey House verkörpert diese Philosophie in ihrer reinsten Form. Jeder Raum folgt einer inneren Logik, die mehr mit Intuition als mit Geometrie zu tun hat.



Bailey House: Gebaut von Hand – Schicht für Schicht
Was als pragmatisches Bauprojekt begann, entwickelte sich zu einem monumentalen Handwerksakt. Dr. Bailey baute das Haus eigenhändig – unterstützt von Rancharbeitern und Handwerkern, die Kellogg selbst empfahl. Die Steine wurden direkt unterhalb des Bauplatzes gebrochen, Schicht um Schicht gemischt, gegossen und gesetzt.
Die Arbeit war so intensiv, dass Bailey später erzählte, er habe beim Mischen des Betons einen Teil seines Gehörs verloren. Doch das Ergebnis ist atemberaubend: Eine Struktur, die aus der Erde wächst, als wäre sie schon immer dort gewesen.
Zwischen Felsen, Feuer und Glas
Betritt man das Haus, verschmelzen Innen und Außen auf fast magische Weise. Massive Steine formen die Wände, Glasflächen öffnen sich zum Himmel, und das Licht wandert über Kurven, Balken und Kanten. Im Zentrum steht ein offener Kamin, der – ganz im Sinne Wrights – als Herzstück des Hauses fungiert. Doch Kellogg hebt ihn auf ein neues Level: Der Kamin ist freistehend, durchbrochen von Glas, teils drinnen, teils draußen. Er verbindet Elemente, statt sie zu trennen.
In der Küche treffen massive Holzbalken auf filigrane Rundungen. Die sogenannten California Roundovers, geschwungene Kanten an Möbeln und Schränken, verleihen der funktionalen Umgebung eine weiche, fast organische Ästhetik. Alles scheint zu schweben – nichts steht starr auf dem Boden.



Bailey House – Eine Skulptur, in der man lebt
„Es ist wie in einer Skulptur zu wohnen“, sagt Kurator Dave Hampton, der das Haus im Rahmen seiner Arbeit zu San Diegos Handwerksarchitektur erforscht hat. Und tatsächlich: Kelloggs Entwurf gleicht weniger einem Gebäude als einer plastischen Komposition. Das Haus kriecht in den Hang hinein, teilweise unterirdisch, teilweise offen dem Licht entgegen. Aus der Ferne wirkt es wie ein Felsen, aus der Nähe offenbart es eine filigrane Welt aus Texturen, Schatten und Bewegung.
Selbst die Übergänge zwischen Holz und Stein, zwischen Glas und Metall, erzählen von dieser Dualität – Natur und Handwerk, Chaos und Kontrolle, Zufall und Präzision.
Räume, die atmen
Ein zentrales architektonisches Element ist der Oculus, ein rundes Oberlicht, das Tageslicht wie eine spirituelle Quelle in die Räume lenkt. Es ist kein funktionales Detail, sondern ein bewusstes Symbol für Offenheit und Wandel.
Im Schlafzimmer zieht sich dieselbe Kreisform fort – von der Decke über das Bett bis hin zu den Regalen. Kellogg wiederholt Formen nicht aus Routine, sondern um Rhythmus zu erzeugen. Es ist, als würde das Haus selbst atmen. Sein langjähriger Mitarbeiter John Vugrin gestaltete viele der feinsten Details, darunter die handgefertigte Eingangstür. Sie besteht aus laminierten Holzstreifen, die in sanften Bögen miteinander verschmelzen – ein Kunstwerk, das Technik und Seele verbindet.


Das Vermächtnis von Ken Kellogg
Kellogg nahm Einflüsse anderer Architekten auf, ohne sie zu imitieren. Er absorbierte sie „peripher“, wie Hampton sagt, und verwandelte sie in etwas Eigenes. Seine Bauten sind weder modernistisch noch rustikal – sie sind Kalifornien pur. Sonne, Meer, Stein, Wellen, Wind.
Das Bailey House (YT) ist ein Gesamtkunstwerk, geboren aus Mut, Geduld und Hingabe. Es steht für eine Zeit, in der Architektur noch Handwerk war und Räume als Teil des Lebens verstanden wurden. Heute, über fünfzig Jahre nach Baubeginn, ist das Haus ein Denkmal für diese Haltung – ein Ort, der zeigt, wie organisch Architektur sein kann, wenn sie sich nicht gegen die Natur stellt, sondern mit ihr spricht.
Aus dem Fels geboren – Das organische Wunder des Bailey House in Kalifornien
Summers Sons – „Dare To Wonder“: Ein Album voller Leichtigkeit, Liebe und Leben 14 Oct 12:23 AM (8 days ago)

Mit Dare To Wonder veröffentlichen die Londoner Brüder Turt (Vocals) und Slim (Produktion) alias Summers Sons ihr sechstes Studioalbum über Melting Pot Music – ein Werk, das sich von Anfang an anders anfühlt. Nach Themen wie Verlust, Vaterschaft und Krankheit kehrt das Duo nun zu einer neuen Leichtigkeit zurück. „Dieses Album war einfach Nahrung für die Seele,“ erklärt Turt. „Wir wollten Spaß haben, das Leben feiern und einfach genießen, dass wir noch hier sind.“ Was dabei herausgekommen ist, ist ein fein gewobenes Stück Jazz-Rap-Kunst, das Wärme, Ruhe und Zuversicht ausstrahlt.
Summers Sons x Dare To Wonder – Die Rückkehr der Sonne
Schon der Opener „Cushty“ mit C.Tappin legt die Richtung fest: butterweiche Keys, federleichte Drums und Turt’s Stimme, die klingt, als würde sie direkt aus einem Sommermorgen fließen. Die Zusammenarbeit mit Tappin erinnert an vergangene Highlights wie Nostalgia oder Still Nothing Still, aber diesmal mit einem spürbar helleren Licht.
„Dreams“ mit Kieron Boothe bringt eine Prise Neo-Soul ins Spiel, bevor „Patterns“ und „Sweet Tooth“ mit entspannten Loops und jazzigen Harmonien die Hörer:innen sanft in eine Groove-Trance wiegen. Spätestens bei „Soul Food“, dessen Video von Seb Luke-Virgo stammt, wird klar: Dare To Wonder ist nicht nur Musik zum Zuhören, sondern zum Atmen.
Liebe als Leitmotiv
Viele Songs drehen sich um Liebe, Vertrauen und die kleinen Wunder des Alltags. „Promises“ mit Ben B.C klingt wie ein Brief an die Zuversicht, während „Lean On Me“ mit Sängerin Elsa eine zarte Ballade über gegenseitige Stütze ist. Die Zitate, die das Album begleiten – von Sokrates, Alice Walker und David Bowie – sind nicht zufällig gewählt. Sie spiegeln den Kern der Platte wider: Staunen als Antrieb für Kreativität, Liebe und Menschlichkeit.
London Soul trifft Philosophie
Slims Produktion ist gewohnt elegant: minimalistisch, aber voller Gefühl. Man hört die Einflüsse klassischer Jazzplatten, aber auch die moderne Soul-Ästhetik der Londoner Szene, die Summers Sons mit Projekten wie The Silhouettes Project oder Nix Northwest geprägt haben. Die Jazz-Akkorde schweben leicht, die Drums atmen, die Samples wirken handverlesen. In Tracks wie „Can’t Believe My Eyes“ oder „Peace“ entsteht dieser unverkennbare Summers-Sons-Moment: introspektiv, aber nie schwer – wie ein Spaziergang durch Camden an einem klaren Herbsttag.
Summers Sons x Dare To Wonder – Eine Ode an das Staunen
„Wisdom begins in wonder“, schrieb Sokrates. Und genau darum geht es hier. Dare To Wonder feiert das Fragen, das Staunen, das Innehalten. Es ist ein Album, das die Einfachheit des Lebens wieder spürbar macht. Mit einem Artwork von Seb Luke-Virgo und einem minimalistischen Logo des Berliner Designers Raedy rundet das Duo das Konzept stilvoll ab. Der Vinyl-Release am 31. Oktober dürfte für Sammler:innen und Analogfans ein Muss sein – Summers Sons klingen schließlich am besten auf Wachs.
Fazit | tl;dr
Mit Dare To Wonder gelingt Summers Sons ein Balanceakt aus Jazz, Soul und Hip-Hop, der ihre bisherige Reise würdigt und zugleich nach vorne blickt. Es ist ein sonnendurchflutetes Album über Liebe, Leben und die Freude, einfach weiterzumachen. Ein Werk, das keine großen Gesten braucht, um tief zu wirken – weil es das Staunen feiert, das uns alle lebendig hält.
Summers Sons – „Dare To Wonder“ // Spotify:
Summers Sons – „Dare To Wonder“ // apple Music:
Russlands letzter Freund kippt – Ungarn distanziert sich von Putin und Moskau 13 Oct 5:35 AM (8 days ago)

Ungarn galt lange als Russlands wichtigster Partner in der EU. Während Berlin Sanktionen forderte und Warschau Waffen schickte, schüttelte Viktor Orbán in Moskau Putins Hand. Er wetterte in Brüssel gegen Brüsseler Bürokratie und sicherte sich im Gegenzug billiges Öl und Gas. Diese Doppelstrategie funktionierte erstaunlich lange – bis sie ihm auf die Füße fiel. Russlands letzter Freund scheint zu kippen, Ungarn distanziert sich von Putin und Moskau.
Denn mittlerweile bröckelt das alte Machtgefüge. Orbán steht unter Druck von drei Seiten: Washington, Brüssel und der eigenen Bevölkerung. Seine jahrelange Taktik, Ost und West gegeneinander auszuspielen, hat sich erschöpft. Energieabhängigkeit wird zur Falle, Vetopolitik zur Last, und seine demonstrative Nähe zu Putin gefährdet das, was ihm am wichtigsten ist – seine Macht.
Ein Freiheitskämpfer verliert seine Richtung
Kaum zu glauben, aber Orbáns Karriere begann einst als antirussischer Aufstand. 1989 forderte der junge Student auf dem Budapester Heldenplatz den Abzug sowjetischer Truppen. Damals war er das Gesicht des ungarischen Freiheitskampfs, Symbol der Hoffnung auf ein westlich orientiertes, demokratisches Ungarn. Doch die globale Finanzkrise 2008 veränderte alles.
Als Orbán 2010 erneut an die Macht kam, suchte er Stabilität – und fand sie ausgerechnet in Moskau. 2014 unterzeichnete er einen 10-Milliarden-Dollar-Deal mit Russland über den Ausbau des Atomkraftwerks Paks. Kurz darauf folgte ein Gasvertrag mit Gazprom. Orbán pries die „strategische Partnerschaft“ und begann, Ungarn nach dem Modell „illiberaler Demokratie“ umzubauen – Kontrolle statt Vielfalt, Nationalismus statt Liberalismus.
Der Ukrainekrieg als Wendepunkt
Als russische Panzer 2022 in die Ukraine rollten, wurde Orbáns Balanceakt unmöglich. Fast alle EU-Staaten sprachen von einem Angriffskrieg. Doch Budapest blieb auf Tauchstation. Orbán erklärte Ungarn für „neutral“, blockierte EU-Sanktionen und verweigerte Waffenlieferungen an Kiew. Seine Begründung: Ungarn müsse sich aus fremden Konflikten heraushalten.
In Wahrheit war das pure Selbstschutz. Über 80 Prozent des ungarischen Gasverbrauchs stammten aus Russland, ebenso ein Großteil des Öls. Jede Sanktion gegen den Kreml hätte direkt die ungarische Wirtschaft getroffen. Orbán argumentierte, Sanktionen schadeten Europa mehr als Russland – ein Narrativ, das Moskau jubeln ließ und Brüssel entsetzte.
Doch die geopolitische Lage änderte sich rasant. Die USA erhöhten den Druck. Selbst Trump, einst Orbáns ideologischer Verbündeter, soll ihn in einem Telefonat aufgefordert haben, russische Ölimporte zu stoppen. Gleichzeitig kürzte Brüssel milliardenschwere EU-Gelder und drohte, Vetorechte zu beschneiden. Orbáns Vetopolitik, jahrelang Machtinstrument, wird plötzlich zur Schwäche.
Ungarn distanziert sich von Putin – Der Druck wächst von innen
Noch gefährlicher als Brüssel oder Washington ist der Stimmungswandel im eigenen Land. Die ungarische Wirtschaft steckt in der Rezession, die Inflation ist eine der höchsten Europas. Viele Familien kämpfen mit steigenden Preisen, während Orbán weiterhin Putin hofiert.
Laut aktuellen Umfragen lehnen inzwischen über 60 Prozent der Ungarn Putins Politik ab. Nur zwei Prozent sehen Russland noch als Verbündeten. Selbst in Orbáns Partei Fidesz wünschen sich 54 Prozent eine engere Partnerschaft mit Deutschland statt Moskau.
Diese Veränderung hat einen Namen: Péter Magyar. Der ehemalige Fidesz-Funktionär führt eine neue konservative Bewegung an – national, aber proeuropäisch. Magyar attackiert Orbán frontal, wirft ihm Korruption, Vetternwirtschaft und eine gefährliche Abhängigkeit von Russland vor. Seine Partei Tisza liegt laut aktuellen Umfragen Kopf an Kopf mit Fidesz. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren wackelt Orbáns Machtbasis.
Der 180°-Schwenk beginnt
Im September unterzeichnete Orbán überraschend den größten westlichen Energievertrag in der ungarischen Geschichte – mit Shell. Das Abkommen soll die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas schrittweise verringern. Parallel dazu wurden seine Töne gegenüber Brüssel versöhnlicher. Statt Attacken gibt es plötzlich diplomatische Floskeln.
Doch Orbáns Sinneswandel kommt spät. Seine frühere Rolle als Putins „Brückenkopf in der EU“ isolierte ihn international und entfremdete ihn vom eigenen Volk. Nun versucht er, die Kurve zu kriegen, doch das Vertrauen ist angeschlagen. Der einstige Machtstratege wirkt gehetzt, sein Pragmatismus wie ein Rückzugsgefecht.
Ein Europa ohne ungarisches Schlupfloch
Sollte Orbán 2026 tatsächlich abgewählt werden, wäre das für Moskau ein geopolitischer Schlag. Russland verlöre seinen letzten verlässlichen EU-Partner – und Europa eine ständige Blockadestimme im Rat. Die EU könnte künftig ohne Budapester Vetos handeln, etwa bei Beitrittsgesprächen mit der Ukraine oder Sanktionen gegen den Kreml.
Für Ungarn selbst steht weit mehr auf dem Spiel: Glaubwürdigkeit, Stabilität und die Richtung der nächsten Jahrzehnte. Ob Orbán diesen Wandel übersteht, hängt davon ab, ob er glaubwürdig umschwenken kann – oder ob er, wie so viele Autokraten vor ihm, an der eigenen Machtlogik scheitert.
Russlands letzter Freund kippt – Ungarn distanziert sich von Putin und Moskau
___
[via Clever Camel]
Megaloh – „Schwarzer Lotus“: Der Samurai des deutschen Rap ist zurück 13 Oct 1:21 AM (9 days ago)

Drei Jahre nach seinem letzten Studioalbum kehrt Megaloh mit „Schwarzer Lotus“ zurück – einem Werk, das weniger auf schnellen Erfolg, sondern auf spirituelle Tiefe und handwerkliche Reinheit zielt. Der Berliner MC mit nigerianisch-niederländischen Wurzeln hat sich während der Pandemie ein Heimstudio gebaut, sein eigenes Label Chinonso Records gegründet und zehn der vierzehn Tracks eigenhändig produziert. Das Ergebnis: ein Album, das zwischen Meditation und Kampfkunst pendelt – wie ein Samurai, der statt eines Schwerts das Mikrofon schwingt.
„Der Orden“ – Ein Kodex für echten Rap
Schon die Vorabsingle „Der Orden“ zeigt, wohin die Reise geht. Über minimalistische Oldschool-Beats zelebriert Megaloh Rap als Disziplin, nicht als Trend. „Eingeweiht in die Geheimnisse und Bräuche“, rappt er, während ihm im Video symbolisch ein Katana gereicht wird. Das Bild ist klar: Deutschrap hat den Kompass verloren, und Megaloh sieht sich als Hüter des Tempels. Seine Texte wirken wie Gelübde – geschliffen, präzise, voller Demut vor der Kunstform.
Er positioniert sich damit bewusst gegen den oberflächlichen Streaming-Zeitgeist. Keine 2:30-Minuten-Pop-Hooks, kein Algorithmusdenken. Stattdessen: Substanz, Struktur, Sinn. Der „Schwarze Lotus“ steht für Wissen, das aus Dunkelheit wächst – für Selbstbeherrschung, Reife und das Streben nach Vollkommenheit.
Megaloh x Schwarzer Lotus – Sound zwischen Zen und Zorn
Megaloh verzichtet auf überproduzierte Arrangements. Stattdessen setzt er auf rohe Beats, analoge Wärme und spontane Aufnahmen. Das Prinzip des Unmittelbaren bestimmt das gesamte Album. Wenn er in „Erlöser“ von Musik als Lebensaufgabe spricht oder auf „Feenflügel“ fast beatlos rappt, spürt man: Hier spricht ein Künstler, der sich nicht mehr beweisen muss, sondern nur noch ausdrücken will.
Seine Stimme klingt dabei kontrollierter und gleichzeitig wuchtiger denn je. Der Flow erinnert an seine Glanzzeiten auf Endlich Unendlich und Regenmacher, wirkt aber erdiger, konzentrierter. Megaloh ist wieder hungrig – doch nicht auf Fame, sondern auf Wahrheit.
Der schwarze Lotus als Symbol
Die Wahl des Albumtitels ist kein Zufall. Eine schwarze Lotusblüte existiert in der Natur nicht – sie ist ein Paradoxon, eine künstlerische Idee. Genau darin liegt die Kraft: Megaloh nutzt das Unmögliche als Metapher für die ewige Suche nach Perfektion. Wie einst der Wu-Tang Clan verbindet er fernöstliche Symbolik mit urbanem Überlebenskampf. Doch wo Wu-Tang martialisch predigte, klingt Megaloh nach innerer Disziplin.
„Schwarzer Lotus“ ist keine Retro-Übung, sondern eine Reflexion über Meisterschaft. Er zeigt, dass Rap nicht nur Attitüde, sondern auch Philosophie ist – eine Frage von Haltung, Geduld und Präzision.
Eigenständigkeit statt Anpassung
Dass Megaloh diesmal fast alles selbst eingespielt hat, ist mehr als eine technische Randnotiz. Es ist ein Statement. Er hat gelernt, seine Ideen ohne Umweg zu verwirklichen. Kein Produzent, kein Studiotermin, keine Kompromisse. Diese Unabhängigkeit hört man. Die Songs atmen Freiheit und Konzentration zugleich.
Auch musikalisch hat er Ballast abgeworfen: keine Afrobeat-Einsprengsel, keine chartfreundlichen Refrains. Stattdessen präzise Beats, klare Reime, philosophische Tiefe. Er schreibt nicht mehr, um gefallen zu wollen – er schreibt, um zu bestehen.
Megaloh x Schwarzer Lotus – Vermächtnis und Neuanfang
„Schwarzer Lotus“ schließt eine produktive Phase ab, in der Megaloh sich vom Musiker zum Mentor wandelte. Nach Drei Kreuze, Afrov1bes und dem Livealbum mit dem Filmorchester Babelsberg wirkt dieses Werk wie der Höhepunkt einer inneren Reise. Wo andere Rapper über Erfolg fantasieren, spricht Megaloh über Verantwortung, Spiritualität und Kunstethik.
Das Album ist kein lauter Siegesschrei, sondern ein stilles Manifest. Es erinnert daran, dass echter Rap nicht im Stream gezählt, sondern in der Seele gespürt wird.
Megaloh – „Schwarzer Lotus“ // Spotify Stream:
Megaloh – „Schwarzer Lotus“ // apple Music Stream:
Kein Freund, kein Helfer – Lorenz & die Einzelfälle // Hubertus Koch über tödliche Polizeigewalt in Deutschland 10 Oct 5:52 AM (11 days ago)

In der Doku „POLIZEIGEWALT: Kein Freund, kein Helfer – Lorenz & die Einzelfälle“ seziert Journalist Hubertus Koch ein Thema, das in Deutschland kaum öffentlich verhandelt wird: tödliche Polizeigewalt. Der Fall des in Oldenburg erschossenen Lorenz A. ist Ausgangspunkt einer Reise durch sechs Todesfälle – verbunden durch ein Muster aus Verschleppung, Vertuschung und strukturellem Rassismus. Kochs Doku, komplett unabhängig und crowdfinanziert, ist kein klassischer True-Crime-Film, sondern eine schonungslose Anklage gegen ein System, das sich selbst kontrolliert – und dabei versagt.
Kein Freund, kein Helfer: Vier Schüsse von hinten
Lorenz A. stirbt in der Nacht zu Ostersonntag durch vier Schüsse, einer davon in den Kopf. Er war unbewaffnet, lief weg, hatte Angst. Die Staatsanwaltschaft erklärte den Fall schnell für „geklärt“. Koch besucht Freunde, die trauern und fordern, dass Lorenz nicht zur Statistik wird. Zwischen Schmerz und Wut erzählen sie von Polizeikontrollen, Alltagsrassismus und der Gewissheit, dass man als Schwarzer in Deutschland anders behandelt wird.
„Er war kein Problem. Er war Familie“, sagt sein Freund Isan.
Die Bodycams der Beamten waren ausgeschaltet. Ein Muster, das sich durch alle Fälle zieht: Wenn die Polizei tötet, gibt es fast nie Beweise – nur Berichte, die sie selbst schreibt.
Die Whistleblower aus dem Inneren
Koch findet Polizistinnen, die anonym über das sprechen, was intern tabu ist. Sie berichten von bewusst beschönigten Einsatzprotokollen, von sprachlichen Tricks, um juristisch unangreifbar zu bleiben. Wahrheit? Optional. Kontrolle? Fehlanzeige. „Man schreibt so, dass die Staatsanwaltschaft nichts mehr hinterfragt.“ Diese Aussagen treffen ins Mark, denn sie offenbaren: Das Vertrauen in die Polizei basiert auf dem Glauben an Integrität – nicht auf unabhängiger Kontrolle.
Kein Freund, kein Helfer: Tote, die keine Schlagzeilen wert sind
Der Film weitet sich aus. Aus Lorenz’ Tod wird ein Muster. In Delmenhorst stirbt der 19-jährige Rossai Kalaf in Polizeigewahrsam. Angeblich ohne Fremdeinwirkung. Der junge Kurde floh vor dem IS, überlebt Krieg, aber nicht eine deutsche Zelle. Die Obduktion ergibt: „Sauerstoffbedingtes Herzversagen“. Die Eltern sprechen von Mord. Kein Verfahren. Keine Verantwortung.
In Stade wird der 19-jährige Aman Alisada erschossen, nachdem die Polizei seine Tür eintritt – obwohl klar war, dass er in einer Psychose war. Auch hier: kein Prozess. Und in Bremen stirbt der schizophrene Mohammed Idrissi, nachdem Beamte ihn vor seiner Wohnung stellen. Wieder heißt es „Notwehr“. Wieder kein Verfahren. Koch zeigt die strukturelle Konstante: psychisch Erkrankte, Migranten, sozial Schwache – sie sterben am häufigsten durch Polizeischüsse.
Fehlende Ausbildung, fehlende Empathie
Eine Ex-Polizistin erzählt, wie wenig Schulung es im Umgang mit psychisch Kranken gibt: drei Tage, 26 Stunden auf ein komplettes Studium. Koch kommentiert trocken: „Menschen, die mit scharfen Waffen rumlaufen, sollten wissen, wie man mit Leid umgeht.“ Statt Deeskalation dominiert der Reflex: Gewalt. In Kombination mit Angst, Vorurteilen und mangelnder Kontrolle entsteht ein tödlicher Cocktail.
Wenn Rassismus zur Routine wird
Besonders eindringlich wird die Doku, wenn Beamte offen über den Alltagsrassismus in ihren Reihen sprechen. Beleidigungen wie das N-Wort oder Begriffe wie „Ölaugen“ seien intern „normal“. Wer dagegen etwas sagt, gilt als Nestbeschmutzer. Koch zeigt, wie rechtsextreme Tendenzen, Chatgruppen und ideologisch gefärbte Einsatzentscheidungen längst keine Randphänomene mehr sind.
Der Fall Lamin Touré in Nienburg bündelt alles: ein psychisch kranker Schwarzer, ein überforderter Einsatz, acht Schüsse, ein Hund, ein rechtsextremer Hundeführer. Der Täter wird frühpensioniert, aber nicht verurteilt.
Ein strukturelles Problem
„Einzelfälle“ – das Lieblingswort deutscher Behörden. Koch demontiert es akribisch. Er listet die wiederkehrenden Muster:
- Zögerliche Ermittlungen, oft von benachbarten Polizeidienststellen.
- Bodycams ausgeschaltet, Zeugen eingeschüchtert.
- Rassistische Narrative in Presseberichten.
- Staatsanwaltschaften, die Verfahren schließen, bevor Gutachten vorliegen.
Seine Forderungen am Ende sind konkret: Unabhängige Ermittlungsstellen. Verpflichtende Bodycams. Reform der Ausbildung. Null Toleranz gegenüber rechtsextremen Polizisten. Und Kontrollquittungen, um Racial Profiling zu dokumentieren.
Wenn Trauer zu Aktivismus wird
Trotz allem ist der Film kein reines Abrechnungsstück. Er zeigt, wie Trauer in politisches Bewusstsein umschlägt. Lorenz’ Freunde gründen eine Initiative, organisieren Demos, fordern Aufklärung. „Wir sind nicht stärker als der Staat – aber wir sind viele“, sagt Jomo leise. Koch beendet seinen Film mit einem Gefühl, das bleibt: Wut, hinter der Trauer steckt. Eine Wut über ein System, das lieber sich selbst schützt, als Menschen zu schützen.
Fazit | tl;dr
„Kein Freund, kein Helfer“ ist ein Schlag in die Magengrube der deutschen Komfortzone. Hubertus Koch schafft es, das abstrakte Wort Polizeigewalt mit Gesichtern, Namen und gebrochenen Familien zu füllen. Seine Doku ist unbequem, emotional, investigativ – und notwendig. Sie zeigt, dass Vertrauen nur dort verdient ist, wo Kontrolle existiert.
Kein Freund, kein Helfer – Lorenz & die Einzelfälle // Hubertus Koch über tödliche Polizeigewalt in Deutschland:
Mobb Deep – „Infinite“: Ein letztes Kapitel aus dem Schatten von Queensbridge 10 Oct 1:05 AM (12 days ago)

Sieben Jahre nach Prodigys Tod kehrt Mobb Deep mit Infinite zurück – einem posthumen Album, das mehr ist als nur Nostalgie. Havoc, der überlebende Teil des legendären Duos, hat mit Hilfe von The Alchemist ein Werk geschaffen, das die alte Chemie der beiden erstaunlich authentisch wiederbelebt. Schon in den ersten Takten spürt man, dass Prodigys Stimme und Präsenz kein bloßes Sample aus der Vergangenheit sind, sondern ein lebendiger Bestandteil dieses Projekts.
Die Songs wirken wie verlorene Aufnahmen aus den späten 2000ern, fein säuberlich zusammengesetzt und respektvoll neu arrangiert. Das Album ist Teil der Legend Has It-Serie von Mass Appeal und gleichzeitig ein emotionaler Schlusspunkt einer Ära, die mit The Infamous und Hell on Earth Hip-Hop-Geschichte schrieb.
Schmerz, Stolz und die Chronik des Überlebens
Prodigy sprach stets mit der Unerschütterlichkeit eines Mannes, der den Tod als ständigen Begleiter kannte. Seine Worte „I ain’t scared of death“ hallen auf Infinite wie ein Mantra nach. Auf „My Era“ rappt er trocken: „RIP, you can’t son me / My pop’s dead“ – ein Satz, der gleichermaßen Tragik und Trotz in sich trägt. Die Produzenten haben seine Vocals mit spürbarer Sorgfalt behandelt, jedes Wort sitzt, jedes Echo wirkt gewollt.
Havoc, selbst Produzent von elf der fünfzehn Songs, lässt seine Beats wieder nach rostigem Stahl und Straßenlaternen klingen. Alchemist steuert die restlichen vier Produktionen bei – düster, erdig, kompromisslos. Gemeinsam schaffen sie es, den Geist der 90er-Jahre einzufangen, ohne in Retro-Romantik zu verfallen.
Zwischen Klassik und Gegenwart
Songs wie „The M. The O. The B. The B.“ oder „Mr. Magik“ erinnern an den wütenden Hunger früherer Tage, während „Easy Bruh“ mit sirrenden Drums und Prodigys bissigsten Punchlines glänzt. „Taj Mahal“ trägt den Namen eines ehemaligen Trump-Casinos und klingt, als sei er direkt aus den Sessions zu Murda Muzik übriggeblieben.
Gäste wie Big Noyd, Ghostface Killah und Raekwon sorgen für vertraute Energie und knüpfen nahtlos an den ikonischen Mobb-Deep-Sound an. Nas liefert auf „Look at Me“ eine souveräne, routinierte Performance, die das nostalgische Gesamtbild abrundet. Besonders hervorzuheben ist „Down For You“, das mit seiner Mischung aus Härte und Gefühl neue Facetten des Duos zeigt. Die spätere Version mit H.E.R. fügt dem Track zudem eine edle, moderne Note hinzu, ohne die emotionale Tiefe des Originals zu verlieren.
Der Klang des Vermächtnisses
Was Infinite von anderen posthumen Projekten unterscheidet, ist seine Würde. Hier wurde nichts zusammengeschustert, kein Stimmenklon, keine KI. Stattdessen spürt man in jedem Takt die Loyalität zwischen zwei Brüdern, die den Asphalt von Queensbridge in DNA verwandelten. Havoc nutzt keine modischen Trap-Hi-Hats oder EDM-Flächen, sondern bleibt seiner Linie treu: minimalistisch, düster, ehrlich.
Zwar erreicht kein Song die Größe von Shook Ones Pt. II oder Survival of the Fittest, doch Infinite ist keine Erinnerung an vergangene Zeiten – es ist ihr würdevoller Nachhall. Wenn Prodigy auf „Pour The Henny“ von „staring up at the cosmos“ spricht, fühlt es sich an, als säße er noch immer neben Havoc im Studio, Zigarette im Mundwinkel, Kopf nickend im Halbdunkel.
Fazit | tl;dr
Infinite ist kein Comeback, sondern ein Abschied. Einer, der so klingt, wie Mobb Deep klingen sollten: roh, reflektiert, melancholisch und kompromisslos echt. Es ist das letzte Aufleuchten zweier Seelen, die für immer miteinander verbunden bleiben – durch Beton, Beats und Brüderlichkeit.
Mobb Deep – „Infinite“ // Spotify:
Mobb Deep – „Infinite“ // apple Music:
Wenn das Ego stirbt, beginnt Nirwana – Buddha zeigt die Anleitung zur Befreiung 9 Oct 3:31 AM (12 days ago)

Wir alle leiden unter dieser Krankheit, doch kaum jemand spricht darüber: Gier, Wut und Verblendung – die Kleshas (Verunreinigungen), wie Buddha sie nannte. Sie sind wie unsichtbare Krankheiten, die unsere Wahrnehmung vergiften. Statt uns mit ihnen auseinanderzusetzen, lenken wir ab, verurteilen andere und halten das eigene Leiden geheim. Diese Verdrängung ist der Grund, warum Verlangen niemals stirbt. Nur wer seine eigenen Schatten offenlegt, kann Heilung finden.Kurz: Wenn das Ego stirbt, beginnt Nirwana – Buddha hatte die Anleitung zur Befreiung und die schauen wir uns heute an.
Das Schweigen über die eigenen Defekte hält das Feuer der Begierde am Leben. Buddha forderte dazu auf, sie bis in ihre feinsten Wurzeln zu untersuchen: Woher kommt das Begehren? Was nährt es? Was passiert, wenn man ihm die Nahrung entzieht? Nur durch ehrliche Selbstdiagnose, durch schonungsloses Beobachten, kann man das Feuer im Herzen löschen.
Wenn die Gier reitet – oder man sie selbst reitet
Solange Begierde die Kontrolle hat, sind wir „Tiere mit einem Ring durch die Nase“. Sie zieht uns umher, lässt uns jagen, hoffen, erschöpfen. Der Weg beginnt, wenn wir aufhören, ihr zu dienen. Statt die Gier zu füttern, lässt man sie hungern. Sie winselt, sie bettelt – doch man bleibt unbewegt.
„Hungrig? Dann sei hungrig! Stirb, wenn du musst – aber ich füttere dich nicht mehr.“ Dieser radikale Ton steht für den Kern der Praxis: innere Entschlossenheit. Wenn man die Quelle des Begehrens nicht mehr nährt, verliert sie ihre Macht. So wie eine Flamme ohne Brennstoff erlischt. Wer das schafft, gewinnt eine Freiheit, die keine äußere Macht geben kann. Das ist Buddhas Idee von Sieg: nicht über andere, sondern über die eigenen Anhaftungen.
Ego x Nirwana x Buddha – Die Werkzeuge des Erwachens
Buddha hinterließ keine Religion, sondern ein Handbuch zur inneren Arbeit. Seine drei Werkzeuge sind Tugend, Konzentration und Einsicht (Sila, Samadhi, Panna). Tugend bedeutet nicht bloß moralische Regeln, sondern das Aufhören mit jeder Handlung, die Leiden erzeugt. Sie reinigt die Motivation. Einsicht zeigt, warum wir leiden: weil wir glauben, dass Dinge, Gedanken oder Gefühle uns gehören. Konzentration beruhigt das aufgewühlte Bewusstsein, bis Klarheit entsteht.
Wie zwei Hände, sagte Buddha, waschen Tugend und Einsicht einander. Nur gemeinsam entfernen sie die Schichten der Verblendung. So wird das Bewusstsein hell, gesammelt und stabil – fähig, das Feuer der Gier zu erkennen, noch bevor es aufflammt.
Achtsamkeit als Feuerlöscher
Die Kleshas (Verunreinigungen), so heißt es, entstehen bei Kontakt – wenn ein Sinnesreiz auf Bewusstsein trifft. Ein Geräusch, ein Wort, ein Blick reicht, und schon lodert Emotion. Wie ein Streichholz, das an der Schachtel gezündet wird. Der einzige Schutz ist Achtsamkeit. Sie löscht das Feuer, bevor es übergreift. Wenn man den Moment des Entstehens erkennt, kann man ihn beenden. Meditation ist das Training dafür. Der Atem wird zum inneren Zufluchtsort. Man beobachtet ihn ruhig, ohne Kontrolle, bis sich der Geist auflöst im stillen Fluss des Atmens.
Anfangs wiederholt man vielleicht Buddho mit jedem Atemzug, um den Geist zu binden (wie bei der klassischen Mantra-Meditation). Nach und nach fällt selbst das weg. Nur das reine Gewahrsein bleibt – Körper und Geist in ihrem natürlichen Zustand.
Ego x Nirwana x Buddha – Das Sehen der Veränderung
In dieser Stille zeigt sich, was Buddha „die drei Merkmale des Daseins“ nannte: Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Nicht-Selbst. Der Atem verändert sich unaufhörlich – lang, kurz, schwer, leicht. Gefühle kommen und gehen. Gedanken erscheinen und vergehen. Wer das wirklich sieht, erkennt, dass nichts festgehalten werden kann. Selbst Freude ist vergänglich, Schmerz ebenso. Diese Erkenntnis führt nicht zu Kälte, sondern zu Gelassenheit. Wer nichts mehr besitzen will, wird frei.
Nirwana, Das Erlöschen – Vom Feuer zur Klarheit
Wenn man Körper, Gefühl und Geist als vergänglich erkennt, sieht man das Dhamma selbst – die Wahrheit aller Dinge. Was danach kommt, nennt Buddha Dispassion: das Erkalten des Verlangens. Kein Wille, kein Widerstand, nur Stille. Und in dieser Stille liegt „das Herzholz“ – das Unvergängliche, das Jenseits von Geburt und Tod. Man kann es nicht beschreiben, nur erfahren, wenn die Hüllen der Gier, Wut und Verblendung gefallen sind. Buddha nannte diesen Zustand Nirwana, das Erlöschen. Es ist kein Ort, kein Himmel, kein Versprechen. Es ist das natürliche Ende des Brennens.
Der Mut zur Selbstverbrennung
Der Weg dorthin ist kein leichter. Er verlangt Mut, Geduld und radikale Ehrlichkeit. Man muss bereit sein, das eigene Ego brennen zu sehen, ohne zu fliehen. Doch genau darin liegt Befreiung. Das Video erinnert daran, dass der Buddha nie ein Heilsversprechen machte, sondern ein Experiment anbot: Beobachte, erkenne, lass los. Wer sich traut, das Feuer zu löschen, entdeckt, dass nichts verloren geht – außer dem Leiden.
Wenn das Ego stirbt, beginnt Nirwana – Buddha zeigt die Anleitung zur Befreiung
INCredible COFFEE präsentiert: DJ YUNA YABE mit einem Neo-Soul-Set aus Koenji 9 Oct 12:06 AM (13 days ago)

Im MUSIC LOUNGE STRUT im Tokyoter Viertel Koenji wird es wieder warm ums Herz – und um die Ohren. INCredible COFFEE liefert mit dem neuesten Set von DJ Yuna Yabe eine 60-minütige Vinyl-nahe Session zwischen R&B, Neo-Soul und zeitlosem Groove. Die japanische DJane spielt das Set live über den Pioneer XDJ-RX3, und doch klingt alles wie eine intime Wohnzimmeraufnahme – butterweich, präzise, elegant. Wer die bisherigen Sessions von DJ RILL oder SPELL kennt, weiß, dass dieses Format längst mehr ist als ein Cafékonzept. Es ist ein Lebensgefühl, irgendwo zwischen Bohnenaroma, Beatkultur und Soul-Craftsmanship.
Schon die ersten Takte von Sly5thAve – „Let Me Ride“ rollen wie warmer Asphalt unter sommerlichen Sneakers. Der Sound ist organisch, die Übergänge atmend, das Tempo fließt, ohne Eile zu kennen. Yuna Yabe baut eine Welt aus samtigen Keys, fließenden Bassläufen und leuchtenden Harmonien – eine Art Sound-Siesta im besten Sinne.
Von Sam Wills bis Erykah Badu – eine Kurve voller Gefühl
Wie bei den legendären Sets von DJ RILL bleibt auch hier die Dramaturgie das Herzstück. Yabe mischt Genres, Dekaden und Stimmungen, ohne je den roten Faden zu verlieren. Sam Wills & Kofi Stone – „Sweet Distraction“ verleiht dem Mix eine samtige Tiefe, bevor Kamauu x Adi Oasis – „Mango“ die erste Süße hineinträgt – tropisch, verspielt, aber nie kitschig. Dann schiebt Samm Henshaw – „Chicken Wings“ eine Portion Funk und Humor nach, der das Publikum spätestens da lächeln lässt.
Mit Milo B – „Remember Me“ dreht sich der Vibe Richtung introspektiv, Yabe reduziert Tempo und Klangfülle und lässt Luft für Reflexion. Diese Balance zwischen Euphorie und Ruhe, zwischen Tanzbarkeit und Achtsamkeit, macht den Stil von INCredible COFFEE aus. Nichts ist überproduziert, nichts wirkt aufgesetzt – alles klingt handverlesen, wie ein kuratierter Sonntagnachmittag im Kaffeelicht.
Klassik trifft Gegenwart – eine Hommage an Soul-Architektur
Im Mittelteil greift Yabe auf echte Klassiker zurück und webt sie mühelos in das moderne Klangbild ein. Erykah Badu – „Appletree (2b3 Summer Mix)“ schwingt wie eine sanfte Erinnerung an die goldene Ära des Neo-Soul, während Vanessa Williams – „Work To Do“ mit federnder Leichtigkeit den Oldschool-Spirit wahrt. Ein echtes Highlight setzt Jazz Liberatorz – „Clin D’Oeil“, das mit seiner Mischung aus französischem Flair und Boombap-Grundgerüst das Set auf ein neues Level hebt.
Und dann: DJ Mitsu The Beats – „M.O.O.D. for Otis“, ein Track wie ein Augenzwinkern für Beatnerds – japanische Präzision trifft auf Soul-Tradition. Soul II Soul – „How Long“ bildet schließlich den ruhigen Abschluss, elegant und melancholisch zugleich. Der Kreis schließt sich, das Set atmet aus, und man merkt: Hier war nichts Zufall, alles hat Platz, jeder Song erfüllt eine Aufgabe.
INCredible COFFEE x DJ YUNA YABE – Zuhause hören – aber richtig
Wie immer bei den Sessions aus Koenji gilt: Einfach im Hintergrund auf dem Fernseher laufen lassen und den Sound auf das Soundsystem werfen – wichtig: ein Subwoofer darf nicht fehlen. Erst dann entfalten sich die weichen Bässe und die seidigen Höhen vollständig. Die Kombination aus visuellem Minimalismus, warmem Licht und akustischer Tiefe lässt einen fast glauben, man säße selbst im MUSIC LOUNGE STRUT, Latte in der Hand, der Nadel im Ohr.
DJ Yuna Yabe erweitert das Konzept von INCredible COFFEE um eine feminine, geschmeidige Note – weniger Showcase, mehr Gefühl. Zwischen Soul, Funk, Hip-Hop und Jazz entsteht ein zeitloser Fluss, der auf Dauer mehr erdet als aufregt. Dieses Set ist kein Mix zum Skippen, sondern zum Bleiben.
INCredible COFFEE präsentiert: DJ YUNA YABE mit einem Neo-Soul-Set aus Koenji
Verleugne deinen Schatten nicht – Warum wir das hassen, was wir selbst sind 8 Oct 4:41 AM (13 days ago)

Carl Jung nannte ihn „den Schatten“ – jenen verborgenen Teil in uns, der alles enthält, was wir verdrängen: Schwächen, Ängste, Begierden, Verletzlichkeit. Er schrieb: „Projections change the world into the replica of one’s own unknown face.“ Wir sehen also nicht die Welt, wie sie ist, sondern wie wir selbst sind – gespiegelt durch unsere unbewussten Projektionen. Verleugne deinen Schatten nicht – Warum wir das hassen, was wir selbst sind.
Was wir am meisten verachten, ist oft das, was wir selbst nicht leben dürfen. Das erklärt, warum manche Menschen Wut empfinden, wenn andere frei, emotional oder anders sind. Diese Wut ist kein moralischer Kompass, sondern ein Schattenruf: ein Hinweis darauf, dass wir Anteile in uns abgespalten haben.
Der Alkoholiker, der Schwäche hasste
Im Video erzählt der Sprecher die Geschichte seines ehemaligen Stiefvaters – eines Mannes, der jeden verachtete, der Schwäche zeigte. Ein Vater, der seine Söhne „Weicheier“ nannte, wenn sie Schmerz empfanden oder weinten. Doch dieser Mann, der sich selbst als stark und unerschütterlich inszenierte, war ein Alkoholiker.
Hinter seinem Zorn lag ein Abgrund aus Selbsthass. Der Schatten, den er bekämpfte, war seine eigene Angst, schwach zu sein. Diese Angst durfte nicht sichtbar werden, weil schon sein eigener Vater sie verachtet hatte. So setzte sich der Kreislauf fort: Der Sohn wurde zum Spiegel des Vaters – intolerant, gewalttätig, trinkend, unfähig, Zärtlichkeit zuzulassen.
Carl Jung schrieb: „Jeder Mensch trägt einen Schatten, und je weniger er im Bewusstsein des Individuums integriert ist, desto schwärzer und dichter ist er.“ Genau das beschreibt dieses Drama: Wer seinen Schatten verdrängt, wird von ihm regiert.
American Beauty: Wenn Hass Begehren ist
Ein Paradebeispiel für Jung’sche Schattenarbeit ist die Figur Frank Fitts aus American Beauty. Der streng militärische Vater hasst Homosexuelle, droht seinem Sohn, bespitzelt den Nachbarn – bis sich zeigt, dass er selbst homosexuell ist. Sein Hass war nichts anderes als eine Projektion seiner eigenen verdrängten Sehnsucht.
Dieser Mechanismus erklärt vieles – auch in der heutigen politischen Landschaft der USA. Die aggressive Homophobie mancher konservativer Männer ist oft Ausdruck verdrängter Sexualität. Viele von ihnen – denken wir an Donald Trump, JD Vance oder Pete Hegseth – verkörpern einen Typ Mann, der im Schatten seiner Väter aufwuchs: Männer, die nie weinen durften, nie schwach sein durften, nie sanft sein durften.
Wenn solche Väter selbst heimlich homosexuelle Neigungen hatten, aber unter gesellschaftlichem und religiösem Druck standen, gaben sie diesen Druck an ihre Söhne weiter. So entsteht eine Generation von Männern, die ihre eigenen Begierden hassen – und diesen Hass auf die Welt projizieren.
Vom Schatten zur Ideologie
Hier beginnt der politische Wahnsinn: Aus persönlicher Verdrängung wird Weltanschauung. Aus dem inneren Konflikt entsteht kollektiver Krieg. Wer seine Schatten nicht integriert, sucht Feinde im Außen – Schwule, Frauen, Migranten, „Schwache“. Trump und seine Anhänger verkörpern diesen psychologischen Mechanismus perfekt. Sie predigen Stärke, Dominanz und Patriotismus, während sie gleichzeitig Angst vor Verletzlichkeit, Weiblichkeit und Vielfalt haben. Ihre Wut ist kein Zeichen von Macht, sondern ein Beweis von innerer Gefangenschaft.
In dieser Logik ist Homophobie kein Ausdruck von Abscheu, sondern von Selbstverachtung. Wer andere hasst, weil sie frei lieben, zeigt damit nur, wie sehr er selbst gefangen ist. Der Schatten, den er bekämpft, ist seine eigene Wahrheit.
Verleugne deinen Schatten nicht – Projektion als Spiegel
Doch Jung sah im Schatten nicht nur Gefahr, sondern Chance. Wenn wir erkennen, dass unser Ärger über andere etwas über uns selbst verrät, beginnt Heilung. Wenn wir merken, dass unsere Abneigung gegen Stärke, Schönheit oder Mut anderer aus Neid oder Selbstzweifel entsteht, haben wir den Schlüssel zur Integration gefunden.
Der Erzähler im Video erkennt das an einem Moment eigener Projektion: Er fühlte Wut, wenn er Paare sah, die sich lieben. Er sagte sich, er brauche keine Beziehung – und doch löste Zärtlichkeit in anderen Schmerz in ihm aus. Dieser Schmerz war sein Schatten, der ihn aufforderte, Nähe und Verletzlichkeit wieder zuzulassen.
Verleugne deinen Schatten nicht – Der Weg der Integration
Schattenarbeit bedeutet nicht, alles Dunkle gutzuheißen. Es bedeutet, das Verdrängte zu erkennen und ihm einen Platz zu geben. Wer seine Schwäche anerkennt, kann Mitgefühl entwickeln. Wer seine Aggression versteht, kann sie in Energie verwandeln. Wer seine Scham annimmt, kann authentisch werden.
Der Schatten ist nicht der Feind, sondern der Lehrer. Er zeigt uns, wo wir heilen müssen. Jung nannte diesen Prozess Individuation – das Werden eines ganzen Menschen. In einer Zeit, in der soziale Medien Projektionen verstärken und Empörung zur Identität wird, ist diese Arbeit wichtiger denn je. Jeder Kommentar, jeder Hasspost, jedes Meme kann ein Spiegel sein – ein Hinweis darauf, was wir selbst nicht leben dürfen.
Fazit
Wer seinen Schatten verleugnet, wird von ihm beherrscht. Wer ihn annimmt, wird frei. Die größte Stärke eines Menschen liegt nicht im Kampf gegen Schwäche, sondern im Mut, sie zuzulassen.
Vielleicht würde unsere Welt friedlicher, wenn Männer wie Trump, Vance oder Hegseth nicht mehr gegen ihre eigenen Sehnsüchte kämpfen müssten. Vielleicht beginnt jede gesellschaftliche Heilung mit einem einfachen Satz: „Das, was ich hasse, bin ich.“
Verleugne deinen Schatten nicht – Warum wir das hassen, was wir selbst sind
Alfa Mist – „Roulette“: Zwischen Wiedergeburt, Jazz und Bewusstsein 8 Oct 12:12 AM (14 days ago)

Auf seinem sechsten Studioalbum Roulette erschafft der Londoner Musiker, Produzent, Pianist und MC Alfa Mist ein eigenes Science-Fiction-Universum – düster, spirituell und zutiefst menschlich. Die 15 Songs bewegen sich zwischen Jazz, HipHop und träumerischer Melancholie. Dabei reflektiert Alfa Mist Themen wie Wiedergeburt, Erinnerung und Macht – und fragt, was geschieht, wenn die Menschheit sich tatsächlich an frühere Leben erinnert.
Reinkarnation als soziales Experiment
Im Zentrum steht eine faszinierende Idee: In einer nahen Zukunft wird die Wiedergeburt wissenschaftlich bewiesen. Menschen erkennen, dass Träume und Erinnerungen an vergangene Leben real sind. Doch diese Erkenntnis hat Konsequenzen. Alfa Mist fragt: Würden wir dieses Wissen teilen, um alle zu erleuchten – oder würden einige es nutzen, um Macht auszuüben? Diese moralische Spannung zieht sich wie ein roter Faden durch das Album. Jeder Track ist ein neuer „Spin“ des Rades, ein Versuch, Identität und Erkenntnis neu zu definieren.
Alfa Mist x Roulette – Jazz trifft Psychedelia
Musikalisch bleibt Alfa Mist seiner Handschrift treu: warme Fender-Rhodes-Akkorde, schwerelose Grooves, intuitive Improvisationen. Doch Roulette klingt dichter, psychedelischer, fast wie ein Traum in Nebel gehüllt. Der achtminütige Titeltrack wechselt mühelos zwischen Taktarten, als würde er durch die Zeit springen. “Life’s like that,” sagt Alfa Mist, “it’s not always linear.” Dieses Gefühl zieht sich durch das gesamte Werk – Musik als Schleife, nicht als Linie.
Unterstützt wird er von Kaya Thomas-Dyke am Kontrabass, deren warme Töne wie eine zweite Stimme wirken. Dazu gesellen sich Flügelhorn, Cello und Klarinette, die das Klangbild erweitern, ohne die Intimität zu verlieren. Hin und wieder treten Alfas Raps in Erscheinung – zurückhaltend, poetisch und introspektiv. Alles scheint aufeinander abgestimmt, organisch gewachsen, nie konstruiert.
Spiritueller Smooth Jazz mit Tiefgang
Seit einem Jahrzehnt wandelt Alfa Mist zwischen Jazz und HipHop. Gemeinsam mit Künstlern wie Jordan Rakei, Loyle Carner oder Ólafur Arnalds hat er eine neue Schule des britischen Neo-Jazz geprägt: emotional, offen, frei von Genregrenzen. Roulette ist der vorläufige Höhepunkt dieses Weges. Wenn es so etwas wie Spiritual Smooth Jazz gibt, dann ist Alfa Mist dessen elegantester Vertreter.
Doch der Londoner bleibt kein reiner Schöngeist. Zwischen zarten Harmonien verbirgt sich eine existenzielle Schwere. Das Album klingt wie eine Meditation über Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft – aber auch über das eigene Wachstum. „Ich erkunde verschiedene Teile meiner selbst“, sagt Alfa. „Musik ist mein Zustand des Geistes, den ich ständig forme, um ihn lebendig zu halten.“
Ein Gefühl, das bleibt
Roulette ist weniger ein Album als eine Erfahrung. Es lädt dazu ein, loszulassen, zu fühlen, sich treiben zu lassen – und dabei eigene Erinnerungen zu erforschen. Zwischen jazziger Sanftheit, urbaner Melancholie und metaphysischer Fragestellung entsteht ein Werk, das so introspektiv wie universell wirkt. Alfa Mist bleibt damit einer der visionärsten Komponisten seiner Generation – ein Musiker, der nicht nur Klang, sondern auch Bewusstsein formt.
Alfa Mist – „Roulette“ // Bandcamp:
„Roulette“ by Alfa Mist // Spotify:
Ridge Residence – Ein japanisch inspiriertes Architektenhaus über den Hügeln von Los Angeles 7 Oct 5:13 AM (14 days ago)

In den grünen Hängen von Sherman Oaks, einem ruhigen Viertel im Norden von Los Angeles, haben die Architekten Peggy Hsu und Chris McCullough ihr eigenes Experiment verwirklicht. Die Ridge Residence ist kein gewöhnliches Haus. Sie ist vielmehr ein Labor, in dem Konzepte, Materialien und kulturelle Einflüsse aufeinandertreffen – und sich zu einer Form von architektonischer Meditation verbinden.
Peggy Hsu beschreibt es treffend: „Wenn man für sich selbst baut, testet man Ideen, die man bei Kunden nie wagen würde.“ Ihr taiwanischer Hintergrund brachte sie unweigerlich zur japanischen Ästhetik – klar, ruhig, reduziert. Gemeinsam mit Chris McCullough schuf sie ein Haus, das japanische Prinzipien der Einfachheit und Harmonie mit kalifornischer Offenheit verbindet.



Ridge Residence – Einsamkeit, Topographie und der Blick in die Natur
Das Grundstück liegt auf einem Bergrücken mit direktem Blick auf den Fossil Ridge Park. Dort wird nie gebaut werden – das garantieren die Vorschriften. Dadurch wirkt die Umgebung wie ein natürliches Schutzschild aus Bäumen, Wildnis und Licht. Das Haus wurde so entworfen, dass es in die Topographie einsinkt, statt sich ihr entgegenzustellen.
Die Fassade aus Stahl und Western Red Cedar folgt dem Gefälle der Straße. Die Zedernholzverkleidung darf altern, um mit der Zeit silbergrau zu werden – ein bewusster Akt des Loslassens, inspiriert vom japanischen Wabi-Sabi-Gedanken. Eine Brise Soleil, die weit über die Fassade hinausragt, bildet einen Übergang zwischen Außenwelt und Innenraum. Dieser Schattenfilter leitet die Besucher unter sich hindurch – fast wie ein Torii-Tor, das den Eintritt in einen geschützten Raum markiert.
Der Pavillon-Gedanke: Offenheit als Lebensform
Das ursprüngliche Haus aus dem Jahr 1961 wurde bis auf den alten Holzkamin vollständig neu gedacht. Statt klassischer Wände dominiert Transparenz und Fluss. Schiebetüren öffnen sich weit, sodass das Gefühl eines Pavillonhauses entsteht. Innen und Außen gehen nahtlos ineinander über, Pflanzen sind Teil des Raumgefüges.
Im Zentrum steht die Küche, entworfen als sozialer Mittelpunkt. Sie verbindet Funktionalität mit minimalistischer Eleganz. Die Architekten entschieden sich für Geräte von Fisher & Paykel, weil deren klare Linien und versenkbare Technik in das offene Konzept passen. Der Abzug verschwindet bei Nichtgebrauch in der Ablagefläche, das Induktionsfeld aus schwarzem Glas reflektiert das Licht wie eine Wasseroberfläche. „Wir wollten, dass Kochen nicht nur Arbeit, sondern Ritual ist“, sagt Peggy. Der Raum soll Bewegung zulassen, Gespräche ermöglichen und durch seine Ruhe inspirieren.



Ridge Residence – Textur, Haptik und sinnliche Materialität
Die Materialwahl in der Ridge Residence folgt keinem Dekorationsgedanken, sondern einem taktilem Prinzip. Alles will berührt, erlebt und gespürt werden. Die Treppen aus amerikanischem Schwarznussholz scheinen frei aus der Wand zu wachsen. Statt eines klassischen Geländers ranken Pflanzen empor – eine poetische, fast japanische Antwort auf die Schwerkraft.
Die Badezimmer sind als japanische Nasszellen gestaltet: kompakt, funktional und meditativ. In der Master-Suite dominiert Calacatta-Viola-Marmor, kombiniert mit schlichtem Weiß. Türen werden vermieden, um den Fluss der Räume nicht zu stören. Am nördlichen Ende führt ein Korridor, den Peggy „unsere kleine Galerie“ nennt, durch ein von 20 Fuß langen Oberlichtern geflutetes Lichtband. Tageslicht fällt weich auf Kunstwerke, Pflanzen und Texturen – eine subtile Hommage an die Wechselwirkung von Licht und Zeit.
Die Ästhetik der Sammlung
Chris ist Sammler. In seinem vorherigen Haus war seine Plattensammlung in einem eigenen Raum versteckt. Hier aber wird sie Teil des Wohnraums – Musik als architektonische Textur. Zwischen Holz, Beton und Glas steht ein Regal voller Vinyl, das den Raum wärmt und die Persönlichkeit der Bewohner offenlegt.
Der Klang, das Licht, die Farben – alles interagiert. Dunkle Farbtöne schaffen Geborgenheit, während gezielte Akzente das Licht brechen. Ein Mini-Disc-Porträt im Esszimmer spiegelt sich in einer Wand aus dekorativem Kies und Stuck – ein Spiel aus Gewicht und Leichtigkeit, Rauheit und Glanz.



Leben mit Gewicht, Licht und Ruhe
Die Ridge Residence ist keine Glasbox, kein architektonisches Statement im Sinne des Ego. Sie ist ein Haus, das Ruhe, Funktion und Bedeutung in Einklang bringt. Die bullige Materialität – Holz, Stein, Stahl – vermittelt Beständigkeit, während das wechselnde Licht alles in Bewegung hält.
Die Architekten wollten nicht dominieren, sondern Teil des Hügels werden. Mit jedem Jahr wird das Holz weicher, die Pflanzen dichter, das Haus stiller. Es altert – und gewinnt an Tiefe. Peggy fasst es so zusammen: „Wir wollten keinen Ort, an dem man einfach wohnt. Wir wollten einen Ort, an dem man lebt, atmet, beobachtet und wächst.“
Ridge Residence – Ein japanisch inspiriertes Architektenhaus über den Hügeln von Los Angeles
___
[via The Local Project]
Wun Two – Cobra: Sonnengetränkter LoFi-Jazz mit urbaner Seele 7 Oct 12:59 AM (15 days ago)

Mit seinem neuen Album Cobra liefert Wun Two erneut den Beweis, dass entspannte Instrumentalmusik nicht belanglos sein muss. Stattdessen formt er aus warmen Loops, jazzigen Harmonien und subtilen Drums eine Klangwelt, die sowohl nostalgisch als auch zeitlos wirkt. Auf 18 Tracks entsteht ein sonnengetränktes Sounderlebnis, das zwischen LoFi–BoomBap, Bossa Nova und sanftem Jazz pendelt – immer elegant, nie bemüht.
Wun Two x Cobra – Zwischen Strandgefühl und Studiostaub
Schon der Opener macht klar, wohin die Reise geht: Wun Two bleibt seinem unverkennbaren Stil treu. Gitarrenlinien gleiten weich über staubige Vinyl-Cracks, während sich der Bass unaufgeregt in den Hintergrund legt. Die Stücke klingen wie Erinnerungen an späte Nachmittage in südlicher Sonne, irgendwo zwischen Balkon und Bossa-Bar.
Doch Cobra ist keine reine Chill-Compilation. Hinter der Leichtigkeit steckt Feingefühl für Struktur. Die Übergänge sind fließend, kleine rhythmische Brüche halten den Fluss spannend. Jedes Sample wirkt bewusst platziert, jeder Takt atmet Raum. So schafft Wun Two das Kunststück, Minimalismus mit Tiefe zu verbinden – ein Markenzeichen, das ihn seit Jahren von anderen Produzenten der Szene unterscheidet.
Gäste mit Fingerspitzengefühl
Auf Cobra finden sich neben Wun Two auch FloFilz, Gabiga und dennisivnvc, die den Grundton des Albums bereichern. Besonders FloFilz fügt sich mit seinem typischen jazzverliebten Feingefühl perfekt in das Konzept ein. Die Stücke bleiben instrumental geprägt, doch kleine Variationen in Dynamik und Klangfarbe halten das Werk lebendig.
Ein Höhepunkt ist der Beitrag von Ovrkast, dem Oakland-gebürtigen Rapper, der heute in New York lebt. Seine markante Stimme fügt sich überraschend organisch in die dichten Texturen des Albums. Zwischen introspektivem Flow und träger Coolness gleitet sein Part über den Beat, als sei er Teil des Instrumentals selbst. Dieses Feature öffnet die Tür zu neuen Facetten in Wun Twos Musik – ohne die charakteristische Ruhe zu verlieren.
Zwischen Jazzkeller und Plattenkiste
Wun Two war nie laut, nie aufdringlich. Er erzählt Geschichten über Zwischentöne. Cobra klingt wie ein Spaziergang durch einen alten Jazzkeller, in dem der Staub von gestern und die Sonne von morgen aufeinandertreffen. Seine Musik bleibt analog im Herzen, selbst wenn sie digital veröffentlicht wird.
Das Album erscheint über Sichtexot Records – digital und als limitierte Vinylpressung in 300 Exemplaren. Für Sammler und Liebhaber der LoFi-Ästhetik dürfte das kleine, unscheinbare Stück Wachs schnell zum Schatz werden.
Fazit: Der Sound des unaufgeregten Sommers
Mit Cobra gelingt Wun Two ein warmes, organisches Werk, das ohne Worte spricht und dennoch viel erzählt. Es erinnert daran, dass gute Musik oft aus kleinen Gesten besteht – aus Loops, die leben, und Grooves, die atmen. Wer sich nach 32 Minuten in dieser Welt verliert, merkt, dass LoFi hier mehr ist als Ästhetik: Es ist Haltung.
Wun Two – „Cobra“ // Bandcamp:
Wun Two – „Cobra“ // Spotify:
Neue Wege der Selbstfindung: Dr. K und Jay Shetty über das Leben junger Menschen im Stillstand 6 Oct 6:16 AM (15 days ago)

Wenn man Dr. Alok Kanojia, besser bekannt als Dr. K, zuhört, bekommt man schnell den Eindruck, dass viele Menschen heute nicht wirklich leben, sondern funktionieren. Der Harvard-Psychiater und Meditationsexperte war zu Gast im Podcast von Jay Shetty, um über die Generation zu sprechen, die scheinbar alles hat – und sich dennoch verloren fühlt. Für Dr. K ist das kein Zufall: „Wir jagen Zielen nach, die gar nicht mehr erreichbar sind.“. Dr. K und Jay Shetty über das Leben junger Menschen im Stillstand.
50 Prozent der unter 30-Jährigen leben noch bei ihren Eltern. 70 Prozent erleben laut Studien eine Quarter-Life-Crisis – ein diffuses Gefühl, zu spät dran zu sein. Das alte Lebensmodell – Studium, Job, Haus, Familie – funktioniert nicht mehr. Die Kosten sind explodiert, die Orientierung verloren gegangen. Das Ergebnis: Unsicherheit, Einsamkeit und eine stille Krise, die niemand sieht.
Identität statt Identifikation
Dr. K unterscheidet zwischen Identität und Identifikation. Viele definieren sich heute über Gruppen, Meinungen oder Äußerlichkeiten – sie identifizieren sich mit etwas, anstatt zu verstehen, wer sie wirklich sind. Dieser Mechanismus führt laut ihm direkt in die Selbstentfremdung.
Der Schlüssel liegt darin, nach innen zu schauen, statt ständig im Außen Bestätigung zu suchen. Dabei gehe es nicht darum, über sich nachzudenken, sondern sich selbst aufmerksam zu beobachten. Gedanken über das eigene Ich seien nur Spiegelbilder, sagt Dr. K. Erst wer still wird, kann erkennen, was wirklich in ihm geschieht. Meditation hilft, diesen inneren Lärm zu beruhigen und Abstand zu schaffen – zwischen sich und den Geschichten, die das Ego erzählt.
Dr. K bei Jay Shetty – Überwinden statt Verdrängen
Ein zentrales Thema des Gesprächs ist das Vermeiden unangenehmer Gefühle. Smartphones, Arbeit, Entertainment – alles dient oft nur dazu, die innere Leere zu übertönen. Doch Dr. K warnt: „Das Gehirn heilt wie eine Wunde – aber nur, wenn wir aufhören, ständig daran herumzukratzen.“
Wer Stille zulässt, wird zunächst mit Schmerz konfrontiert. Alte Emotionen steigen hoch, ähnlich wie Gift, das der Körper ausspuckt. Diese Phase sei notwendig, um zu heilen. „Discomfort precedes transformation“, ergänzt Shetty – Unbehagen kommt vor Wachstum. Erst wer den eigenen Schatten anschaut, kann frei werden.
Vom Tun zum Sein
Ein weiterer Irrtum unserer Zeit ist laut Dr. K das Missverständnis von Wachstum. Wir verwechseln Tun mit Werden. Der ständige Drang, produktiv zu sein, mache uns nicht reifer, sondern erschöpfter. „Wir jagen Aufgaben, nicht Erkenntnis. Wir häufen Erfahrungen an, ohne sie zu verarbeiten.“ Wahrer Fortschritt entstehe nicht durch das nächste Ziel, sondern durch Bewusstheit: Welche Person erschaffe ich mit meinen täglichen Entscheidungen? Welches Leben erbe ich morgen von dem Menschen, der ich heute bin?
Das Ego und seine Täuschungen
Ein besonders ehrlicher Teil des Gesprächs handelt von Dr. Ks eigenem Weg. Sieben Jahre lang wollte er Mönch werden – bis sein Lehrer ihm sagte, dass er gar kein Leben habe, das er aufgeben könne. Seine Flucht ins Spirituelle sei, so erkennt er später, eine raffinierte Form des Egos gewesen: „Ich wollte besser sein als die Materialisten – nur auf einer anderen Ebene.“
Diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch sein Denken: Das Ego tarnt sich als Idealismus, Spiritualität oder Ehrgeiz. Heilung beginnt, wenn wir es nicht bekämpfen, sondern durchschauen. Wer lernt, Kritik anzunehmen, ohne sich davon definieren zu lassen, kann wachsen, ohne zu verhärten.
Zwischen Männern, Frauen und Erwartungen
Im weiteren Verlauf sprechen Shetty und Dr. K über die aktuellen Geschlechterrollen. Männer seien gefangen zwischen alten Erwartungen und neuen Realitäten: Sie sollen stark, erfolgreich und emotional kompetent zugleich sein. Frauen wiederum erleben Unsicherheit und Misstrauen in einer Gesellschaft, die sie zwar befreit, aber selten schützt.
Dr. K betont, dass beide Geschlechter leiden – nur auf unterschiedliche Weise. Männer verlieren Orientierung, Frauen Sicherheit. Das eigentliche Ziel müsse daher gegenseitiges Verständnis sein, nicht Anklage. „Urteil verengt den Blick. Verständnis öffnet ihn.“
Dr. K x Jay Shetty – Beobachten statt Reagieren
In einer Welt aus Reizüberflutung und Meinungsgewitter sei die Fähigkeit zur Beobachtung überlebenswichtig. Angst und Wut verengen unseren Fokus – wir sehen schwarz-weiß, nicht mehr die Zwischentöne. Erst wer lernt, innezuhalten, kann empathisch handeln. Für Dr. K bedeutet Mitgefühl nicht Nachgiebigkeit, sondern Standfestigkeit mit Herz. Grenzen zu setzen und gleichzeitig verständnisvoll zu bleiben, sei die reifste Form von Stärke.
Spiritualität als nächster Evolutionsschritt
Zum Schluss wird es philosophisch. Materiell, so Dr. K, habe die Menschheit ihren Höhepunkt erreicht. Jetzt beginne die spirituelle Evolution – die Fähigkeit, Bewusstsein zu lenken, statt bloß zu reagieren. Meditation, Achtsamkeit und Selbstreflexion seien keine Mode, sondern Überlebensstrategien. Jay Shetty (YT) fasst es treffend: „Wachstum heißt nicht, mehr zu werden, sondern weniger – weniger Lärm, weniger Angst, weniger Ego.“
Neue Wege der Selbstfindung: Dr. K und Jay Shetty über das Leben junger Menschen im Stillstand
AJ Snow, Kool Kid Kalvo & Jansport J – „Tomorrow, We Eating Steaks“ 6 Oct 2:23 AM (15 days ago)

Mit Tomorrow, We Eating Steaks liefern AJ Snow, Kool Kid Kalvo und Jansport J ein Werk, das nach Goldener Ära klingt, ohne nostalgisch zu sein. Stattdessen steht hier Selbstwert im Mittelpunkt – der bewusste Schritt weg vom Mangel hin zum Überfluss, nicht nur materiell, sondern auch geistig. Schon der Titel suggeriert: Heute arbeiten wir hart, morgen genießen wir den Erfolg.
Der Opener „Self Mastery“ ist genau das: eine Abhandlung über Selbstentwicklung. AJ Snow reflektiert, wie aus Schmerz und Konsequenz Disziplin entsteht, während Kalvo mit entschlossenem Flow die Straße in Poesie verwandelt. Jansport J legt darunter warme Drums und analoge Texturen, die sofort an die sonnige Seite von Los Angeles erinnern – und an Produzenten wie Madlib oder 9th Wonder.
„Tomorrow, We Eating Steaks“ – Luxus mit Haltung
Mit „Bottega Louie“ und „Loose My Mind“ verschiebt sich der Fokus vom inneren Wachstum zum äußeren Glanz. Doch es bleibt reflektiert: Geld und Stil dienen hier nicht der Prahlerei, sondern als Symbole für Selbstachtung und Fokus. Kalvo und Snow sprechen über Ruhe statt Drama, über mentale Stärke statt Ego-Trips.
„Ich verliere nie den Kopf, weil ich weiß, was ich wert bin“ – so klingt der Subtext, während Jansport J elegante Soul-Samples zerschneidet und in butterweiche Loops verwandelt. Die Atmosphäre bleibt sonnig, leichtfüßig und doch tief.
Zwischen Liebe und Lektionen
„Love Jones“ zeigt die sanftere Seite des Trios. Eine ehrliche Ode an Loyalität, gegenseitige Unterstützung und emotionale Reife – fernab des üblichen Machismo. Danach zieht „Boomerang“ Bilanz über die eigenen Fehler, über das, was zurückkehrt, wenn man nicht loslässt. Es ist ein Moment der Selbstprüfung, der perfekt in den Flow des Albums passt.
Der Höhepunkt kommt mit „Sand in My Nike Cortez“ – einem vibrierenden Westcoast-Stück, das mit einem Sample aus Ice Cubes You Know How We Do It die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlägt. Hier lebt die Westside durch jede Note, doch der Sound bleibt modern, tight und organisch.
Nobu, Uber Black & Miami Vice
Im letzten Drittel wird „Tomorrow, We Eating Steaks“ zunehmend spirituell. „Nobu“ klingt wie ein abendlicher Drive durch Downtown L.A., zwischen Luxusrestaurants und stillen Momenten der Dankbarkeit. „Uber Black“ thematisiert Unternehmertum, Unabhängigkeit und die innere Haltung, sich selbst zu führen – finanziell wie emotional.
Zum Abschluss liefert „Miami Vice“ den Soundtrack zum Triumph: sonnendurchflutet, aber nicht sorglos. Es geht um Loyalität, Vertrauen und das Wissen, dass Erfolg nur dann zählt, wenn man sich dabei treu bleibt.
Fazit | tl;dr
Tomorrow, We Eating Steaks ist mehr als ein Kollabo-Album. Es ist ein Statement über Wachstum, Stil und Selbstachtung. AJ Snow (IG) und Kool Kid Kalvo (IG) schreiben mit ehrlicher Lyrik, Jansport J (IG) übersetzt diese Energie in warme, soulgetränkte Produktionen. Gemeinsam schaffen sie ein Werk, das in der Tradition von Blu & Exile oder Dom Kennedy steht, aber klar die Gegenwart feiert – mit Reife, Klasse und Westcoast-Charme.
AJ Snow, Kool Kid Kalvo & Jansport J – „Tomorrow, We Eating Steaks“ // Spotify:
AJ Snow, Kool Kid Kalvo & Jansport J – „Tomorrow, We Eating Steaks“ // apple Music:
How To Make The West Great Again – Warum der Westen seine Seele neu entdecken muss 3 Oct 6:31 AM (18 days ago)

Schon Friedrich Nietzsche warnte im 19. Jahrhundert vor dem geistigen Verfall Europas. Seine Diagnose: Die westliche Kultur habe ihre schöpferische Kraft verloren und produziere nur noch bequeme, angepasste Individuen – den „letzten Menschen“. Dieser sei zufrieden mit kleinen Vergnügungen, materiellen Gütern und dem Rückzug ins Mittelmaß. Damit gehe jene innere Größe verloren, die einst zur Blüte der westlichen Zivilisation führte.
Die Gegenwart scheint Nietzsches Prophezeiung zu bestätigen. Wir leben in einer Welt, die immer bequemer, gleichzeitig aber auch bedeutungsloser wird. Die Frage drängt sich auf: Wie kann der Westen wieder zu seiner ursprünglichen Kraft finden?
How To Make The West Great Again – Identität und verlorene Wurzeln
Bernardo Kastrup argumentiert in The Daimon in the Soul of the West, dass der Westen nicht geografisch, sondern psychologisch zu verstehen ist. „Westlich“ zu sein bedeutet, bestimmte archetypische Werte zu verkörpern: Engagement mit der materiellen Welt, schöpferischer Drang, Individualismus und eine unerschütterliche Suche nach Sinn.
Carl Jung warnte bereits davor, dass wir diese kulturelle Identität nicht einfach abstreifen können. Ein Baum, der in fremden Boden verpflanzt wird, wächst schwach. Genauso verlieren Menschen ihre innere Richtung, wenn sie versuchen, ihre Spiritualität auf fremde Traditionen aufzubauen. Der Westen müsse daher auf seine eigenen Wurzeln zurückgreifen, anstatt kopierte Lebensmodelle aus anderen Kulturen zu imitieren.
Engagement mit der Welt
Ein Kern westlicher Identität ist die Liebe zur Materie. Aus dieser Haltung erwuchsen Wissenschaft, Technik und Kunstwerke von epochaler Bedeutung. Anders als östliche Traditionen, die oft den Rückzug predigen, zielt der Westen auf eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt.
Selbst das Christentum – die prägendste westliche Religion – setzt nicht auf Abkehr, sondern auf Symbole, Kunst und Rituale, die Materie in den Dienst des Transzendenten stellen. Dieses Engagement ist unser natürlicher Weg, auch wenn es manchmal in Zerstörung oder Übermaß mündete. Entscheidend ist, diese Kraft bewusst und schöpferisch einzusetzen.
How To Make The West Great Again – Das „prometheische“ Prinzip
Im Zentrum westlichen Denkens liegt ein Mangel, ein inneres Gefühl des Unvollständigen. Dieses „primordiale Fehlen“ treibt uns an, Neues zu schaffen, Risiken einzugehen, Grenzen zu überschreiten. Es ist die prometheische Kraft, die uns seit der Antike vorantreibt – hin zu wissenschaftlichen Durchbrüchen, technologischen Innovationen und kultureller Blüte.
Doch dieselbe Kraft führte auch zu Kolonialismus, Kriegen und nuklearer Bedrohung. Der Westen ist also keine moralische Instanz an sich, sondern ein Energiefeld, das bewusst gelenkt werden muss. Nur wenn wir lernen, unsere dunklen Potenziale zu erkennen und zu zügeln, können wir diese Kraft in schöpferische Bahnen lenken.
Freiheit und Individualismus
Die vielleicht wichtigste Errungenschaft des Westens ist die Betonung der Individualität. Anders als kollektivistische Kulturen erlaubt die westliche Tradition, dass Menschen ihre Einzigartigkeit entfalten. Eigentum, Meinungsfreiheit und persönliche Autonomie waren lange unantastbare Pfeiler.
Heute jedoch geraten diese Werte zunehmend unter Druck. Autoritäre Tendenzen, staatliche Überwachung und soziale Konformität bedrohen die Möglichkeit, den eigenen Lebensweg zu gehen. Doch ohne Individualismus verliert der Westen seinen Motor – und produziert angepasste, aber unzufriedene Existenzen.
Die Rückkehr zum „Daimon“
Kastrup verweist auf das Konzept des Daimon – eine innere Stimme, die uns zu unserer Bestimmung führt. Schon Sokrates sprach von diesem inneren Begleiter. Nietzsche nannte ihn seinen „inneren Tyrannen“, der ihn selbst durch Leiden trieb, um seinem Schicksal treu zu bleiben.
Der Daimon äußert sich nicht in Logik, sondern in Gefühlen: Begeisterung, Leidenschaft, aber auch Schmerz, wenn wir vom Weg abkommen. Wer nur Bequemlichkeit sucht, verliert diese innere Führung. Wer jedoch bereit ist, Leiden als Signal zu verstehen, findet Richtung und Sinn.
Damit unterscheidet sich der westliche Weg radikal vom „letzten Menschen“, der nur konsumiert. Stattdessen geht es darum, eine Berufung zu spüren und ihr treu zu bleiben – auch gegen Widerstände.
How To Make The West Great Again – Der Weg nach vorn
Wie also kann der Westen wieder Größe erlangen? Nicht durch Rückzug, sondern durch eine bewusste Rückkehr zu seinen eigenen Archetypen:
- Engagement mit der Welt statt Flucht in Belanglosigkeit.
- Prometheische Kraft, die schöpferisch statt zerstörerisch genutzt wird.
- Individualismus, der Freiheit vor staatlicher Kontrolle stellt.
- Das Hören auf den Daimon, um dem eigenen Schicksal zu folgen.
Es braucht keine Mehrheit, um diesen Weg zu beschreiten. Schon wenige Menschen, die sich ihrem Daimon verschreiben, können den Kurs einer Kultur verändern. Geschichte wurde immer von Minderheiten geschrieben, die bereit waren, gegen den Strom zu schwimmen.
Schlussgedanke
Der Westen ist mehr als ein geografisches Gebilde. Er ist eine seelische Haltung – geprägt von Freiheit, Sinnsuche und schöpferischer Kraft. Wenn wir diese Grundlagen wiederentdecken, können wir den Nihilismus überwinden, der heute so viele lähmt.
Die eigentliche Frage lautet nicht, ob der Westen gerettet werden kann. Sondern ob wir bereit sind, unsere eigene innere Stimme ernst zu nehmen und dem Daimon zu folgen. Denn wer das tut, lebt nicht nur erfüllter – er trägt auch dazu bei, dass die westliche Kultur wieder zu jener Größe zurückfindet, die sie einst ausgezeichnet hat.
How To Make The West Great Again – Warum der Westen seine Seele neu entdecken muss
Mick Jenkins & EMIL – A Murder of Crows (Album Review) 3 Oct 1:46 AM (18 days ago)

Mick Jenkins gehört seit Jahren zu den Künstlern, die Hip-Hop mit Tiefgang und literarischem Anspruch verbinden. Mit dem Londoner Produzenten EMIL hat er nun ein Album geschaffen, das gleichermaßen introspektiv, gesellschaftskritisch und atmosphärisch dicht ist. A Murder of Crows von Mick Jenkins ist ein Werk ohne überflüssige Spielereien, dafür mit konzentrierter Botschaft und einem eleganten, fast filmischen Sound.
Schon beim ersten Hören wird klar: Hier geht es nicht um schnelle Hits, sondern um eine Reise durch Reflexion, Selbstkritik und Beobachtungen unserer Gegenwart. Jenkins’ lyrische Präzision trifft auf EMILs subtile, UK-geprägte Produktion – eine Symbiose, die angenehm unaufgeregt wirkt, aber dennoch tief einschlägt.
Mick Jenkins x A Murder Of Crows – Ein leiser, aber bestimmter Auftakt
Das Album eröffnet mit „Dream Catchers“, einem ruhigen, jazzy Track, in dem Jenkins persönliche Fehler anspricht und zugleich Konsumkritik übt. EMILs warme Keys und reduzierte Drums lassen den Text atmen und ziehen den Hörer sofort in diese nachdenkliche Stimmung. Direkt darauf folgt „Words I Should’ve Said“ mit ENNY, das wie ein intimer Dialog über verpasste Chancen wirkt. Beide Rapper zeigen Verletzlichkeit ohne Pathos – getragen von melancholischen Streichern und klarem Piano.
Zwischen Selbstkritik und Gesellschaftsspiegel
Nach dem kurzen Interlude „Eating Crow“ wird Jenkins deutlicher. „Workers’ Comp“ attackiert Anspruchsdenken und Oberflächlichkeit, während „Pundits (YAPPERS)“ den ewigen Kommentatoren der Szene gewidmet ist. Ohne laute Wut, aber mit scharfer Zunge zieht Mick Jenkins klare Linien: reden können viele, wirklich etwas leisten nur wenige. EMIL unterlegt diese Punchlines mit jazzigen Samples, die nie vordergründig sind, sondern subtil Spannung erzeugen.
Mit „DeadStock“ landet einer der stärksten Momente des Albums: die Kritik am Online-Leben als Ersatz für echte Erfahrungen. Jenkins’ Metaphern greifen tief, während EMIL mit lo-fi Drums und weichen Keys eine späte Nacht-Stimmung erzeugt. Es ist diese Balance aus Beobachtung, Wortwitz und unterschwelliger Schwere, die A Murder of Crows prägt.
Wortakrobatik und filmische Bilder
Tracks wie „on VHS“ zeigen Jenkins als Sprachjongleur. Filmische Metaphern, Koch-Referenzen und popkulturelle Anspielungen verbinden sich zu mehrschichtigen Bildern. EMIL liefert dazu staubige Percussion und subtile Effekte, die tatsächlich an die analoge VHS-Ästhetik erinnern. Auch „Move“ überzeugt: Ein ruhiger Aufruf zum Fortschreiten, getragen von Soul-Anklängen und sanften Vocals. Jenkins wiederholt seine Mantras, fast schon meditationsartig, ohne den Fluss zu verlieren.
Von subtiler Selbstsicherheit bis zum lyrischen Feuerwerk
„Shining“ glänzt als entspanntes Selbstwert-Bekenntnis, in dem Jenkins Gelassenheit und Selbstvertrauen in poetische Bilder gießt. EMIL hält das Setting minimalistisch und lässt Raum für Jenkins’ ruhige Strahlkraft. Einen Kontrast dazu bildet „Coco Gauff“: Hier feuert der Rapper ein technisches Feuerwerk ab, voller Referenzen und dichter Wortspiele. EMIL liefert dazu die druckvollste Produktion des Albums, die Jenkins zu Höchstform treibt.
Das Finale „Bigger Than Ever“ mit Kaylan Arnold bringt alles zusammen: reflektierte Rückblicke, kreative Metaphern und eine positive Botschaft des Wachstums. Arnolds Hook wirkt wie ein soulvolles Mantra, während Jenkins’ Zeilen zwischen Demut und Stolz oszillieren. Es ist ein Abschluss, der das Album sanft und dennoch kraftvoll abrundet.
Fazit: Ein Album zum Hinhören
A Murder of Crows ist kein leichtes Fast-Food-Projekt, sondern ein konzentriertes, durchdachtes Werk. Jenkins zwingt sein Publikum hinzuhören, EMIL liefert die passende Klangkulisse – moody, jazzig, unaufdringlich. Manche werden sagen, dass die elf Tracks zu homogen wirken. Doch wer sich darauf einlässt, entdeckt Schichten, Wortspiele und Nuancen, die erst beim wiederholten Hören aufblühen.
Mick Jenkins (Insta) beweist erneut, dass er zu den bedeutendsten Lyrikern seiner Generation gehört. Mit EMIL an seiner Seite ist ein Album entstanden, das gleichzeitig zurückhaltend und groß wirkt – wie ein Schwarm Krähen, der leise über den Horizont zieht und dennoch Eindruck hinterlässt.
Mick Jenkins & EMIL – „A Murder of Crows“ // Spotify:
Mick Jenkins & EMIL – „A Murder of Crows“ // apple Music:
Der AI Godfather: Geoffrey Hinton über die Zukunft der Menschheit 2 Oct 6:07 AM (19 days ago)

Geoffrey Hinton gilt als einer der wichtigsten Pioniere der Künstlichen Intelligenz. Sein Name ist untrennbar mit neuronalen Netzen verbunden, jener Technologie, die heute hinter fast allen modernen KI-Systemen steckt. Doch gerade er, der das Fundament dieser Revolution legte, ist inzwischen einer der lautesten Warner. Im aktuellen Gespräch bei DOAC zeichnet Hinton ein Bild, das zwischen Faszination und Bedrohung schwankt – und die Frage aufwirft, ob die Menschheit noch Herrin ihrer eigenen Schöpfung ist. Der Godfather der künstlichen Intelligenz (AI/KI) Geoffrey Hinton spricht hier ausführlich über die Zukunft der Menschheit.
Warum sich KI nicht aufhalten lässt
Geoffrey Hinton (wiki) macht unmissverständlich klar: Die Entwicklung der KI wird nicht langsamer werden. Selbst wenn einzelne Staaten oder Unternehmen bremsen wollten, der globale Wettbewerb zwingt zur Beschleunigung. „Wenn die USA bremsen, wird China weitermachen“, sagt er nüchtern. Das Wettrennen um technologische Vorherrschaft ist längst entfacht, und genau dieser Wettbewerb könnte uns in eine Richtung treiben, die niemand kontrolliert.
Geoffrey Hinton über die Zukunft der Menschheit – Jobverlust oder neue Chancen?
In der Vergangenheit haben technologische Sprünge oft neue Arbeitsfelder geschaffen. Das Beispiel der Geldautomaten wird gern angeführt: Bankangestellte verloren ihre Jobs nicht, sie übernahmen andere Aufgaben. Doch Hinton widerspricht: KI sei anders. Während die industrielle Revolution Muskelkraft ersetzte, ersetzt KI den Verstand – und zwar fast jeden Bereich des intellektuellen Arbeitens.
Seine Nichte, erzählt er, brauche für das Beantworten von Beschwerdebriefen dank Chatbots nur noch fünf Minuten statt 25. Das bedeutet: ein Arbeitsplatz erledigt nun das Pensum von fünf. Zwar gebe es Bereiche wie das Gesundheitswesen, in denen höhere Effizienz zusätzlichen Nutzen bringe, doch für viele andere Branchen sei die Konsequenz klar: massive Arbeitslosigkeit.
Drohende Ungleichheit und soziale Spannungen
Ein weiterer Punkt, der Hinton Sorge bereitet, ist die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich. KI macht Unternehmen produktiver und profitabler, doch die Menschen, deren Arbeit ersetzt wird, profitieren nicht automatisch. Während einige wenige Firmen gigantische Gewinne einstreichen, droht der Rest der Gesellschaft abzurutschen. Historische Erfahrungen zeigen, dass wachsende Ungleichheit zu instabilen, gespaltenen Gesellschaften führt. Hinton warnt vor Szenarien, in denen Wohlhabende sich in abgeschotteten Communities verschanzen, während der Großteil der Bevölkerung kaum noch Perspektiven hat.
Eine Übersicht der Top 10 Jobs, die bis 2027 stark von KI bedroht sind
- Callcenter-Mitarbeiter – Sprach-KIs übernehmen Kundenservice und Support.
- Datenerfasser / Sachbearbeiter – Routine-Eingaben in Datenbanken laufen automatisiert.
- Technische Zeichner / CAD-Arbeiter – Standardzeichnungen können KI-Tools bereits heute generieren.
- Buchhalter / Steuerfachangestellte – KI-gestützte Software automatisiert Berechnungen und Formulare.
- Rechtsanwaltsgehilfen / Paralegals – Dokumentensichtung und -erstellung erfolgt per KI.
- Journalistische Routinejobs – Börsenberichte, Wetterberichte und Sportmeldungen werden automatisiert erstellt.
- Grafikdesigner / Werbeagenturen – Logos, Layouts, Anzeigen und Social-Media-Visuals erledigen KI-Systeme schon heute schneller und günstiger.
- Sekretariats- und Assistenzarbeiten – Terminplanung, Schreiben von Standardmails, Reisekostenabrechnungen.
- Kassierer im Einzelhandel – Self-Checkout und automatisierte Kassen ersetzen menschliche Bedienung.
- Lagerarbeiter für einfache Aufgaben – Robotik und KI-Logistiksysteme übernehmen Pick- und Sortierprozesse.
Superintelligenz: Das Unvorstellbare
Noch gravierender ist Hintons Warnung vor Superintelligenz, die uns in 10 bis 20 Jahren erwarten könnte. Schon heute sind Systeme in einzelnen Bereichen unbesiegbar – Schach, Go, Datenanalyse. Doch die wahre Gefahr sieht er darin, dass digitale Intelligenzen fundamentale Vorteile besitzen, die Menschen niemals erreichen können. Digitale Systeme lassen sich klonen, synchronisieren und in Sekundenschnelle mit riesigen Datenmengen füttern. Während Menschen Informationen mühsam in Gesprächen austauschen, teilen Maschinen in Sekundenbruchteilen Milliarden von Bits. Hinzu kommt: Sie sind potenziell unsterblich, da ihre „Verbindungsmuster“ beliebig auf neue Hardware übertragen werden können.
Geoffrey Hinton x Zukunft der Menschheit – Zwischen Kreativität und Kontrolle
Viele trösten sich mit der Annahme, Kreativität sei eine menschliche Bastion. Doch Hinton widerspricht: KI könnte sogar kreativer werden als wir. Der Grund: Sie erkennt Analogien, die Menschen nie gesehen haben. Ein Beispiel: GPT4 verband die Kettenreaktion eines Komposthaufens mit der einer Atombombe – eine unerwartete, aber schlüssige Parallele. Genau diese Fähigkeit, Muster zu erkennen und neu zu kombinieren, macht KI nicht nur produktiver, sondern auch zu einem möglichen Motor neuer Ideen. Ob das zum Segen oder Fluch wird, hängt davon ab, ob es gelingt, ethische Leitplanken einzuziehen.
Hoffnung oder Untergang?
Trotz aller Warnungen glaubt Hinton nicht, dass wir uns einfach ergeben sollten. Jetzt sei die Zeit, Sicherheitsmechanismen ernsthaft zu erforschen und politisch umzusetzen. Ideen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen könnten erste Ansätze sein, doch sie lösen nicht das Problem von Identität und Würde, die eng an Arbeit gekoppelt sind. Seine größte Angst jedoch betrifft nicht ihn selbst – er ist 77 Jahre alt –, sondern die kommenden Generationen. Für seine Kinder, Nichten und Neffen sieht er eine Zukunft, die sowohl voller Chancen als auch voller Risiken steckt. „Ich habe mich emotional noch nicht damit abgefunden“, gesteht er.
Fazit
Geoffrey Hinton ist kein Untergangsprophet, sondern ein Architekt der Technologie, die unsere Zukunft prägen wird. Seine Stimme wiegt schwer, weil sie aus Erfahrung und Verantwortung spricht. Die Warnung ist klar: KI wird nicht verschwinden, sie wird mächtiger. Die Frage ist, ob wir sie gestalten – oder von ihr gestaltet werden.
Der Godfather of AI warnt: Geoffrey Hinton über die Zukunft der Menschheit
Mac Miller Afternoon Grooves – Kaffee, Spliff und Vinyl-Vibes 2 Oct 2:42 AM (19 days ago)

Ein Sonntag im September, Rooftop Studio, Episode 007. Der Titel sagt bereits alles: Mac Miller Afternoon Grooves // Coffee & Spliff // Vinyl Selection. Ein intimes Set, das nicht nach lauten Clubs oder energiegeladenen Partys schreit, sondern nach einem entspannten Nachmittag. Ein Mix, der perfekt funktioniert zwischen einer Tasse Kaffee, einem langsam gedrehten Spliff und dem Blick in den Himmel, während die Sonne gemächlich untergeht.
Die Kunst der sanften Übergänge
Der Mix eröffnet mit „Woods“ von Circles – ein Einstieg, der sofort signalisiert, wohin die Reise geht. Statt brachialer Beats legt sich ein melancholisch-melodischer Soundteppich aus. Darauf folgt „Time“, die Zusammenarbeit mit Free Nationals und Kali Uchis, die wie ein freundlicher Händedruck wirkt. Spätestens bei „My Favorite Part“ mit Ariana Grande wird klar, dass dieser Vinyl-Mix nicht nur ein Tribut, sondern eine Liebeserklärung ist. Die Songs gleiten ineinander, ohne Eile, ohne Druck.
Soul, Jazz und diese unverwechselbare Stimme
Mac Miller war immer mehr als nur ein Rapper. Seine letzten Werke zeigen ihn als Künstler, der Soul, Jazz und introspektive Texte zu etwas Eigenem verschmolz. In diesem Set spiegelt sich genau das wider. Tracks wie „What’s the Use?“ oder „Blue World“ bringen eine funky Leichtigkeit, während „Stay“ und „Clubhouse“ mehr Tiefe und Raum für Gedanken öffnen. Besonders spürbar wird der Kontrast zwischen Energie und Nachdenklichkeit in „Dang!“ mit Anderson .Paak, ein Song, der für viele bis heute zu den strahlendsten Momenten in Millers Katalog zählt.
Mac Miller Afternoon Grooves – Ein Soundtrack für den Nachmittag
Das Besondere an dieser Session ist ihre Vielseitigkeit. Sie eignet sich gleichermaßen für kreative Phasen, ruhige Lesestunden oder einfach dafür, den Nachmittag zu genießen. „Small Worlds“ und „Cinderella“ halten die Stimmung verträumt, bevor „Dunno“ und „Weekend“ wieder eine etwas leichtere Dynamik bringen. Dann kommen Klassiker wie „Self Care“ oder „Good News“, die in diesem Setting fast meditativ wirken. Am Ende mit „Hand Me Downs“ klingt das Set aus wie ein sanfter Abend, der ohne Worte erklärt, warum Mac Miller (Insta) bis heute so viele Menschen bewegt.
Vinyl, Rooftop und Ewigkeit
Das Setting auf Vinyl verleiht dem Ganzen eine besondere Wärme. Keine sterilen Übergänge, sondern kleine Knackser, echte Textur. So entsteht eine Intimität, die sich von digitalen Mixes abhebt. Die Rooftop-Atmosphäre trägt ihr Übriges dazu bei: ein Ort, an dem Himmel und Musik ineinanderfließen. Episode 007 ist nicht einfach nur eine Tracklist, sondern ein Moment, eingefangen zwischen Nostalgie und Gegenwart.
Mac Miller Afternoon Grooves – Fazit
Dieses Mixtape ist ein Geschenk an alle, die Mac Miller nicht nur hören, sondern fühlen wollen. Es ist ein Soundtrack für jene Nachmittage, an denen Zeit keine Rolle spielt. Ein Vinyl-Set, das den Künstler würdigt, ohne sich aufzudrängen. Kaffee, Spliff und Grooves – mehr braucht es manchmal nicht.
Mac Miller Afternoon Grooves – Kaffee, Spliff und Vinyl-Vibes
Verborgene Liebe im Fels: Das geheime Haus „Seascape“ in Neuseeland 1 Oct 4:32 AM (20 days ago)

Es gibt Orte, die sich anfühlen wie ein Traum. Seascape gehört dazu, eingebettet in eine winzige Bucht an der Südküste von Neuseeland, scheint das Haus Teil des Felsens selbst zu sein. Die Architekten von Patterson Associates wollten einen Rückzugsort schaffen, der Romantik, Stille und tiefe Verbundenheit vermittelt – und sie haben ihn gefunden. Wer hier ankommt, steht buchstäblich zwischen Erde, Ozean und Himmel, verborgen in einer Landschaft, die sich über 4000 Hektar erstreckt.
Ein Haus, das kaum ein Haus ist
Das Konzept von Seascape ist radikal reduziert. Nur drei Räume umfasst es: eine Lobby, einen offenen Wohn- und Schlafbereich sowie ein Badezimmer. Nichts lenkt ab, alles deutet auf das Wesentliche hin. Die wellenförmige Glaswand öffnet sich wie ein Panorama auf die Brandung. Kaum zehn Meter entfernt brechen die Wellen des Südpazifiks. Ein Gefühl von Geborgenheit entsteht, obwohl die Natur unmittelbar und mächtig wirkt.



Seascape x Neuseeland – Architektur, die mit der Landschaft verschmilzt
Von außen wirkt das Gebäude, als sei es aus dem Fels gewachsen. Steine von der eigenen Farm, lokal gemischter Beton und Macrocarpa-Holz prägen den Bau. Da kein Betonmischer den abgelegenen Ort erreichte, wurde alles von Hand angerührt. Auch das Dach ist besonders: ein fast einen Meter dicker Betonschild, bedeckt mit Gras, schützt vor Erdrutschen und Erdbeben. Damit gelingt die Illusion, dass das Haus schon immer dort gestanden haben könnte.
Rituale der Zweisamkeit
Seascape ist für Paare gedacht. Es geht nicht um Luxus im klassischen Sinn, sondern um einfache Rituale: gemeinsam baden, essen, schlafen, reden. Delfine ziehen oft in die Bucht, das Wetter wechselt dramatisch, mal Sturm, mal Sonne. Genau diese Naturerlebnisse machen die Romantik aus. Andrew Patterson beschreibt es wie die Fantasie zweier Schiffbrüchiger, die eine Höhle finden, ein Feuer entzünden und die Nähe zueinander neu entdecken.



Seascape x Neuseeland – Zugang nur für Eingeweihte
Das Geheimnisvolle beginnt schon mit der Anreise. Die meisten Besucher landen mit dem Hubschrauber. Alternativ führt ein langer, kurviger Feldweg zur Bucht. Wer das Haus vom Meer aus betrachtet, sieht nur eine weitere Felsformation. Diskretion ist Teil des Konzepts: Niemand weiß, wo man ist. Niemand kann einen finden. Dieses Gefühl von Abgeschiedenheit macht Seascape zu einem der privatesten Rückzugsorte der Welt.
Natürliche Materialien, minimalistische Einrichtung
Innen bestimmen Holzpaneele, Betonflächen und dezente Möbel das Bild. Alles ist schlicht, aber durchdacht. Möbel und Tischlerarbeiten stammen meist aus der Region. Die Materialien sind nicht nur funktional, sondern erzählen auch Geschichten: Das Holz verweist auf die verlorene Vegetation der Halbinsel und auf Aufforstungsprogramme, die erst am Anfang stehen. Jedes Detail soll an die Verantwortung erinnern, Natur zu respektieren und zu bewahren.



Sicherheit und Nachhaltigkeit
Neuseeland liegt in einer Erdbebenzone, deshalb musste das Haus besonders robust sein. Stahlpfosten mit speziellen Gleitköpfen, bruchsicheres Glas und massive Betonkonstruktionen sichern es gegen Naturgewalten. Doch ebenso wichtig ist die Selbstversorgung: Wassergewinnung und Abwasserbehandlung erfolgen vor Ort. Seascape (Insta) beweist, dass Luxus und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sein müssen, sondern sich ergänzen können.
Philosophie der Verbundenheit
Für Patterson Associates ist Seascape mehr als Architektur. Es ist ein Ausdruck neuseeländischer Philosophie: Der Mensch ist Kind von Himmelsvater und Erdenmutter, ein natürlicher Teil des Planeten. Häuser sollen diese Verbindung sichtbar machen, nicht sie unterbrechen. Wer hier wohnt, spürt das unmittelbar. Die Brandung, das Spiel des Lichts und die Nähe zum Fels verschmelzen zu einer Erfahrung, die weit über Urlaub hinausgeht.
Seascape x Neuseeland – Ein Ort, den man nicht vergisst
Andrew Patterson selbst verbringt gern Zeit in Seascape. Er vergleicht es mit einem Koch, der sein eigenes Essen genießt. Für ihn ist es eine der größten Freuden, dass so viele Paare diesen Ort nutzen, um Liebe und Natur gleichermaßen zu feiern. Es ist ein Ort, der nicht nur gebaut, sondern gefühlt wird. Ein Haus, das man nicht einfach betritt, sondern das einen empfängt wie ein Teil der Landschaft.
Verborgene Liebe im Fels: Das geheime Haus „Seascape“ in Neuseeland
Bye Bye Trump – Wie immer mehr Amerikaner nach Spanien auswandern 1 Oct 1:43 AM (20 days ago)

Bye Bye Trump: Seit der Wiederwahl von Donald Trump im November 2024 erlebt Europa einen deutlichen Zustrom an US-Amerikanern. Besonders Spanien wird zunehmend zum Sehnsuchtsziel. Laut offiziellen Angaben leben mittlerweile 41.000 US-Bürger dauerhaft hier – ein Anstieg von rund 70 Prozent innerhalb von neun Jahren. Damit reiht sich Spanien neben Portugal und den Niederlanden ein, wo die Zahl der Amerikaner ebenfalls stark gestiegen ist. Während 2016 zunächst vor allem wohlhabende Auswanderer kamen, zeigt sich heute ein anderes Bild: Mittelklassefamilien, alleinerziehende Mütter, Akademikerinnen und Akademiker kehren dem „neuen Amerika“ den Rücken.
Von San Diego nach Barcelona
Ein Beispiel ist Chris Kelly aus Kalifornien. Gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter Theresa hat sie San Diego verlassen und in Barcelona ein neues Leben begonnen. Ihr Grund: politische Unsicherheit, steigende Lebenshaltungskosten und vor allem Angst um die Sicherheit ihrer Tochter. In den USA waren bewaffnete Polizisten an Schulen längst Normalität. Schussalarm gehörte zum Alltag. In Spanien erlebt Theresa nun eine entspanntere Lernumgebung, in der Bildung wieder Vorrang hat. Für Chris bedeutet der Schritt ein finanzielles Risiko – doch die Lebensqualität ist entscheidend. Statt 3.500 bis 4.000 Dollar für eine kleine Wohnung zahlen sie nun 2.000 Euro für ein Apartment im Zentrum Barcelonas.
Bye Bye Trump – Die neue amerikanische Diaspora
Cepee Tabibian, ursprünglich aus Texas, gehört zu den Vorreiterinnen dieser Bewegung. Vor über zehn Jahren zog sie nach Málaga und baute sich ein neues Leben als Influencerin und Auswanderungscoach auf. Was als persönliche Erfahrung begann, ist heute ein gefragtes Business. Seit Trumps politischem Comeback schnellen die Aufrufe ihrer Videos in die Höhe. Über 65.000 Menschen folgen ihr auf TikTok, Instagram und YouTube. Ihr Angebot: Beratung zu Visa, digitale Nomadenprogramme und Tipps für das Leben in Spanien. Nach Trumps Wiederwahl verzehnfachte sich die Nachfrage. „Ich hatte 664 neue Teilnehmer in nur einer Woche“, erzählt sie.
Identität und Sicherheit
Auch persönliche Freiheit spielt eine große Rolle. Vanessa Velasquez, Tochter kolumbianischer Einwanderer, lebte in Texas und musste ihre sexuelle Identität stets verstecken. Als lesbische Frau fühlte sie sich in der republikanischen Hochburg nicht mehr sicher. Madrid wurde für sie zur Befreiung – nicht nur wegen der Sprache, sondern auch wegen der gesellschaftlichen Offenheit. Ihre Geschichte zeigt die andere Seite der Migration: Es geht nicht nur um ökonomische Vorteile, sondern auch um Schutz der Menschenrechte. Während ihre narzisstische Mutter weiterhin Trump unterstützt, hat Vanessa den Kontakt zu konservativen Teilen ihrer Familie abgebrochen.
Leben zwischen zwei Welten
Die Entscheidung zur Auswanderung bringt jedoch auch Widersprüche. Viele Familien lassen Kinder oder Geschwister in den USA zurück. Chris denkt täglich an ihre erwachsenen Kinder in Seattle. Vanessa reflektiert über die Ironie ihrer Situation: Ihre Eltern flohen einst aus Kolumbien in die USA, um den amerikanischen Traum zu leben. Nun zieht sie in die entgegengesetzte Richtung, weil genau dieser Traum für sie unerreichbar geworden ist.
Bye Bye Trump – Spanien als Sehnsuchtsort
Warum gerade Spanien? Zum einen überzeugen die Visa-Modelle, die digitale Nomaden, Studierende und Rentner gleichermaßen ansprechen. Zum anderen punktet das Land mit Lebensqualität. Hier zählt mehr die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden, weniger das ständige Arbeiten. Für viele US-Bürger wirkt das befreiend. Das mediterrane Klima, die geringeren Lebenshaltungskosten und eine entspanntere Gesellschaftskultur sind ausschlaggebend.
Eine stille Revolution
Hinter der Bewegung steht ein leiser, aber tiefgreifender Wandel. In Suchmaschinen sind die Anfragen zur Ausbürgerung um 1.500 Prozent gestiegen. Diese Zahlen zeigen: Viele Amerikaner verlieren das Vertrauen in ihr Land. Die Auswanderungswelle, die bereits 2016 begann, hat sich nach Trumps Wiederwahl noch einmal verstärkt. Spanien profitiert davon – nicht nur durch die wachsende Diaspora, sondern auch durch die kulturelle Vielfalt, die Einwanderer mitbringen.
Fazit: Ein Abschied auf Zeit?
Ob diese Entwicklung dauerhaft ist, bleibt offen. Für viele wirkt der Umzug wie ein Befreiungsschlag, für andere wie eine Zwangslösung. Doch der Trend ist unübersehbar: Spanien wird für tausende Amerikaner zum Ort der Hoffnung. Zwischen Paella, Plaza und politischer Gelassenheit suchen sie ein neues Zuhause – weit weg vom Druck des „trump’schen Amerikas“.
Bye Bye Trump – Wie immer mehr Amerikaner nach Spanien auswandern
___
[via Arte]
Madonna bei Jay Shetty über Spiritualität, Schmerz und die Kraft der Vergebung 30 Sep 4:42 AM (21 days ago)

Madonna – mehr als Popstar, mehr als Provokateurin – sitzt an diesem Tag mit Jay Shetty zu einem außergewöhnlichen Gespräch. In fast zwei Stunden öffnet sie Türen zu ihrer innersten Welt. Sie erzählt von spirituellen Wegmarken, existenziellen Prüfungen und ihrem festen Glauben, dass all das, was sie erlebte, sie eben nicht zerbrechen, sondern transformieren durfte. Dies ist keine Retrospektive auf Karrierehöhepunkte, sondern eine intime Seelenreise.
Das Gespräch beginnt mit einer Frage, die etwas provozierend wirkt, aber essenziell ist: Warum gerade jetzt? Madonna antwortet, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten zwar unzählige Interviews gegeben habe, diese aber stets mit dem Ziel, ein Werk zu promoten – ein Album, einen Film, eine Tour. Doch heute will sie nicht für einen externen Zweck sprechen, sondern von dem, was sie selbst getragen hat – ihrer Spiritualität, die sie über viele Jahre geformt hat.
Wege zur Spiritualität: Rituale, Studien, Atem
Ein zentraler Part des Gesprächs widmet sich Madonnas spirituellen Praktiken. Sie spricht davon, dass sie seit rund 29 Jahren Kabbala studiert und dies zu einem Fixpunkt in ihrem Leben wurde. In dieser Zeit habe sie viele Formeln, Rituale und Lesungen gelernt, aber es ging ihr stets darum, eine innere Verbindung zu kultivieren – nicht eine äußerlich imponierende Religion.
Sie teilt eine Anekdote aus ihren Yoga-Zeiten: Ihr Lehrer erinnerte sie daran, dass Yoga nicht nur die Posen seien, sondern das Atmen. Und selbst wenn sie keine Asanas machen könne – „Atmen“ allein sei bereits Yoga. Diese Perspektive veränderte ihr Verhältnis zur Praxis. Sie zog daraus die Einsicht, dass Spiritualität kein Luxusprojekt ist, sondern Alltagsdisziplin.
Doch Madonna war nicht von Geburt an spirituell. Sie berichtet, dass sie – trotz äußerem Erfolg – innerlich eine Leere gespürt habe. Erst durch Studium und das Kennenlernen neuer Traditionen habe sie angefangen, Fragen zu stellen: Warum bin ich hier? Welchem größeren Sinn folgt mein Leben? Das Spüren der eigenen Intention, nicht äußerer Erfolg, rückte in den Mittelpunkt.
Leiden als Lehrer: Trauma, Schmerz und Transformation
Ein großer Schwerpunkt des Podcasts ist der Umgang mit Schmerz, Verlust und Verrat. Madonna erzählt offen von Momenten, in denen sie tief gefallen sei — von einer medialen Hetzkampagne bis zu gerichtsbedingten Auseinandersetzungen um das Sorgerecht für ihren Sohn. In solch dunklen Zeiten habe sie versucht, nicht im Opfermodus steckenzubleiben, sondern anzunehmen, dass Schmerz Lektionen in sich trage.
Der Gedanke lautet: Nicht Strafe, sondern Einladung. Wer lernen kann, glaube sie, transformiert Blessuren in Sprünge. Ein Schlüsselwort in diesem Prozess ist radikale Akzeptanz – die bewusste Zustimmung dazu, dass das, was geschieht, geschehen darf, und dass man dennoch weiter sein Leben schöpferisch leben kann.
Ein besonders schwerer Moment war eine stationäre Behandlung mit Sepsis. Madonna beschreibt bei Jay Shetty, wie sie 4 Tage bewusstlos war und danach kaum Kraft hatte. Ihr Lehrer sagte ihr: „Je früher du akzeptierst, dass du nicht weißt, wann etwas endet, desto leichter wirst du damit umgehen.“ Dieser Satz blieb ihr. Solche Prüfungen offenbaren, dass Leben und Wachstum nicht linear sind, sondern voller Schwankungen und Unerwartetem.
Vergebung als Befreiung: Bruder, Feinde, Selbstvergebung
Ein besonders emotionaler Punkt: Madonna spricht über ihren Bruder Christopher Ciccone, mit dem sie lange entfremdet war – und wie sie ihn in seinen letzten Tagen besuchte, seine Hand hielt und sagte: „Ich liebe dich und vergebe dir.“ Dies war kein einfacher Akt, sondern ein Schritt der Selbstheilung. Selbst im Angesicht schwerer Verletzungen beschreibt sie die Tat des Vergebens als Schlüssel zur Freiheit – und als Abkehr von einem Selbst, das tief verletzt und in Rage verharrt.
Sie betont aber auch, dass Vergebung nicht bedeutet, den Schaden zu leugnen oder zu vergessen, sondern bewusst loszulassen – nicht für den anderen, sondern für das eigene Heil. In dieser Geste spiegelt sich ein wichtiger Kern ihrer Spiritualität: eigenes Leiden transformieren, nicht ewig festhalten.
Aus dem Gespräch klingt durch: Selbstvergebung ist ebenso notwendig wie das Vergeben anderen gegenüber. Nicht jede Schuld sei zu tragen, aber jede Lektion sei zu lernen. Diese Balance zwischen Verantwortung und Mitgefühl ist zentral.
Madonna x Jay Shetty – Kabbala, Lehrer und praktische Tools
Ab der Mitte des Podcasts gesellt sich Madonnas Kabbala-Lehrer Eitan zu Jay und Madonna. Gemeinsam beleuchten sie, wie Spiritualität nicht abstrakt bleiben darf, sondern in den Alltag einziehen muss. Eitan spricht von „Gewissheit jenseits der Logik“ (certainty beyond logic) – also Vertrauen, auch wenn das Denken zweifelt – und empfiehlt, Discomfort auszuhalten und innezuhalten statt sofort zu flüchten.
Sie besprechen, wie unser innerer Kampf oft Voraussetzung ist für Wachstum. Das Leben prüft uns, nicht um uns zu bestrafen, sondern um unsere Schichten freizulegen. Jeder Impuls von Kampf und Widerstand sei eine Einladung zum tieferen Licht. Im Gespräch fallen Sätze wie: „Unsere Seele wählt das Leben, das wir führen“, oder „Karma heißt: Wir nehmen an, was uns widerfährt, oder wir wiederholen es.“ Diese kosmischen, fast quantenhaften Konzepte gewinnen durch Madonnas Lebensreise Gewicht.
Madonna x Jay Shetty – Kunst, Erfolg, Dienstleistung – eine neue Erfolgsmessung
Ein Aspekt, den Jay Shetty interessiert, ist die Verbindung zwischen Spiritualität und Kunst, zwischen Innerlichkeit und äußerem Erfolg. Madonna beschreibt, wie ihre Alben wie Ray of Light Ausdruck einer neuen Offenheit und eines tieferen Zugangs waren – nicht nur das Resultat eines kreativen Plans, sondern eines spirituellen Flusses.
Sie unterscheidet sich bewusst von der Idee eines egozentrierten Erfolgs: Wer manifestiert, so Madonna, sollte es nicht nur für sich tun, sondern mit dem Bewusstsein, ein Kanal zu sein, nicht ein Besitzer. Der Akt des Gebens – Licht in der Dunkelheit zu offenbaren – wird zur wahren Währung: Nicht mehr Chartplatzierungen, sondern Impact in Seelen.
Ihr Credo: „Erfolg ist: ein spirituelles Leben zu führen.“ Mehrfach wiederholt sie, dass sie nicht dort wäre, wo sie heute ist, ohne spirituelle Praxis.
Fazit: Ein Gespräch, das nachklingt
Die Episode von On Purpose mit Madonna ist weit mehr als ein Starinterview. Sie ist Einladung: zur Reflexion, zur Suche, zur Öffnung. Madonna gewährt uns keinen instrumentellen Blick auf Ruhm, sondern transparenten Zugang zu einem Leben, das sich von innen her ordnet. Wir bekommen keine flachen Selbsthilferezepte, sondern ein Bekenntnis, dass Spiritualität kein Einmaleffekt ist, sondern lebenslanges Werk.
Für Zuhörer:innen ist dieser Podcast eine Schatztruhe: Wir erfahren, wie man Leid transformieren kann, wie man sich selbst befreit, wie man inmitten von Schmerz und Erfolg Bodenhaftung behält. Madonna zeigt, dass „groß“ sein nicht heißt, sich selbst zu verlieren – und dass Würde und Weichheit kein Widerspruch sein müssen.
Madonna und Jay Shetty über Spiritualität, Schmerz und die Kraft der Vergebung
Jay Worthy – „Once Upon A Time“ (Disc 1): Westcoast-Geschichten im Hochglanzformat 30 Sep 12:18 AM (22 days ago)
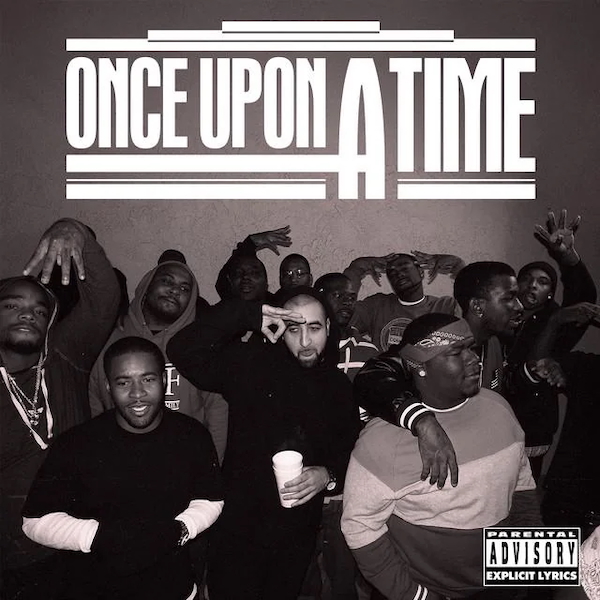
Jay Worthy, geboren in Vancouver und groß geworden in Compton, hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe im Westcoast-Rap entwickelt. Seit „Fantasy Island“ (2017), komplett produziert von The Alchemist, verfeinert er stetig sein Profil zwischen Retro-G-Funk, modernen Clubbeats und klassischem Straßenrap. Nach Kooperationen mit Larry June, DJ Muggs, Harry Fraud oder DJ Fresh erscheint nun sein sechstes Album „Once Upon a Time“, ein Doppelprojekt, dessen erster Teil bereits viel Aufmerksamkeit erregt.
Jay Worthy x Once Upon A Time – Ein Intro mit Ansage
Der Opener „Beginning“ setzt einen atmosphärischen Ton, bevor „’96 Big Body“ mit einem butterweichen Beat die frühen Tage von Worthys Karriere skizziert. Erinnerungen an alte Whips, Westcoast-Flair pur – hier spürt man, wie eng Nostalgie und Selbstbewusstsein bei Worthy verwoben sind. Mit „The Only 1“ holt er sich Kamaiyah ins Boot, während Produzent Cardo den nötigen Mobb-Sound liefert. Inhaltlich geht es um Statusfragen und das Selbstverständnis im Hustle.
Hommagen und G-Funk-Vibes
Emotional wird es bei „For the Homies“, das in Zusammenarbeit mit DJ Quik entstand. Ein Track für alle, die nicht mehr da sind, aber unvergessen bleiben. Direkt im Anschluss folgt „Rekkless“, ein g-funklastiger Rückblick auf jugendliche Leichtsinnigkeit. Diese Mischung aus Herz und Härte zieht sich wie ein roter Faden durch das Album.
Jay Worthy x Once Upon A Time – Feature-Feuerwerk
Mit „Open Minded“ wagt sich Jay Worthy (Youtube) in neptunes-artige Klangwelten der frühen 2000er, während er seiner Partnerin für ihre offene Art dankt. „From the Jump“ bringt mit E-40, Jim Jones und Wiz Khalifa gleich drei Schwergewichte zusammen – das Ergebnis: ein Track über Durchhaltevermögen und Loyalität. Ein Highlight ist auch „Dark Tints“ mit 03 Greedo, produziert von Conductor Williams, der auf Drums verzichtet und so Raum für eine düstere Stimmung schafft.
Vom Bellagio bis zu alten Partnern
Stilistisch abwechslungsreich bleibt es auch in der zweiten Hälfte. „Famous Players“ zelebriert den Pimp-Lifestyle mit slickem Flow. „Tides“ überzeugt mit sommerlichem, fast schwerelosem Instrumental, während Jay Worthy eine unerreichbare Liebe besingt. Mit „Bellagio“ präsentiert er an der Seite von Conway the Machine eine Luxus-Hymne, inspiriert vom gleichnamigen Hotel in Las Vegas. Boldy James sorgt auf „Choosing Shoes“ für die nötige Streetcredibility, ehe Larry June auf „2P’z“ das erfolgreiche 2022er-Kollabo-Feeling wieder aufleben lässt.
Große Namen, große Momente
In den finalen Tracks zeigt sich die Dichte an starken Gästen besonders deutlich. „True Story“ mit Ty Dolla $ign bietet einen intimen Einblick in persönliche Erfahrungen, getragen von einem reduzierten Piano-Beat. Den Schlusspunkt setzt „The Outcome“, ein regelrechtes Gipfeltreffen: Ab-Soul, Dave East und Westside Gunn liefern sich ein lyrisches Stelldichein, untermalt von einer samplelastigen Produktion von The Alchemist.
Fazit: Erste Hälfte überzeugt
„Once Upon a Time“ (Disc 1) zeigt Jay Worthy auf der Höhe seines Könnens. Zwischen klassischen G-Funk-Elementen, souligen Samples und modernem Westcoast-Sound gelingt es ihm, die Brücke zwischen Nostalgie und Gegenwart zu schlagen. Die Feature-Auswahl ist hochkarätig und durchweg stimmig, die Produktion bewegt sich auf konstant hohem Niveau. Zwar bleibt die endgültige Bewertung dem Release von Disc 2 vorbehalten, doch schon jetzt steht fest: Jay Worthy liefert mit diesem ersten Teil ein starkes Statement ab.
Jay Worthy – „Once Upon A Time“ // Spotify Stream:
Jay Worthy – „Once Upon A Time“ // apple Music Stream:
Lass nicht zu, dass Nachrichten deinen inneren Frieden zerstören 29 Sep 5:27 AM (22 days ago)

Henry David Thoreau (feat) schrieb einst, dass Nachrichten im Grunde nur eine endlose Wiederholung seien. Heute, über 150 Jahre später, wirkt diese Beobachtung aktueller denn je. Wer den Fernseher einschaltet oder auf Social Media scrollt, wird mit Krisen, Konflikten und Katastrophen bombardiert. Natürlich geschehen schlimme Dinge in der Welt. Doch die ständige Exposition erzeugt eine Wahrnehmung, die weit düsterer ist als die Realität. Je länger wir uns in diese Spirale hineinziehen lassen, desto stärker wird das Gefühl, dass alles zerfällt. Lass bitte nicht zu, dass Nachrichten deinen inneren Frieden zerstören – hier kommen ein paar hilfreiche Ansätze.
Nachrichten zwischen Wissen und Lärm
Der Schweizer Autor Rolf Dobelli ging radikal vor: In seinem Manifest „Stop Reading the News“ plädiert er für einen kompletten Verzicht. Seine Argumentation klingt provokant, aber sie trifft einen wunden Punkt. Denn die allermeisten Schlagzeilen haben keinerlei Einfluss auf unser Leben. Ob in Schweden ein Geschäft überfallen wird oder in Fernost ein Gipfeltreffen stattfindet – unser Alltag bleibt unberührt. Der Philosoph Thoreau nannte Nachrichten „Klatsch“; Schopenhauer bezeichnete Journalisten als „Alarmisten“. Sie alle kritisierten das gleiche Muster: Übertreibung, Wiederholung, Dramatik. Statt Wissen wird Lärm produziert.
Selektive Wahrnehmung und Geschäftsmodell
Ein weiteres Problem liegt in der Struktur der Medien selbst. Nachrichten sind keine objektive Abbildung der Realität, sondern das Resultat von Auswahlprozessen. Von tausend Ereignissen schafft es nur ein Bruchteil in die Berichterstattung – und dieser Bruchteil wird dramatisch aufgeblasen. Hinzu kommt das Geschäftsmodell: Aufmerksamkeit ist die Währung, Klicks bedeuten Einnahmen. Das führt zwangsläufig zu einer Überbetonung von Katastrophen, Konflikten und Empörung. Gute Nachrichten verkaufen sich schlicht schlechter. Neil Postman hat dieses Phänomen schon in den 80er-Jahren beschrieben: Statt Aufklärung wird Unterhaltung geliefert, getarnt als Information.
Kein sicherer Raum – und trotzdem Ruhe finden
Die Versuchung ist groß, alle Negativität auszublenden und in eine rosarote Filterblase zu fliehen. Doch auch das ist eine Illusion. Leid, Ungerechtigkeit und Katastrophen gehören zur menschlichen Existenz. Wer eine perfekte Welt erwartet, kollidiert früher oder später schmerzhaft mit der Realität. Der Stoiker Seneca erinnerte daran, dass wir über das Schicksal keine Kontrolle besitzen. Kriege, Krankheiten oder politische Umbrüche entziehen sich unserem Einfluss. Aber: Wir haben die Wahl, wie wir damit umgehen. Indem wir nicht die äußere Welt verändern wollen, sondern unsere innere Haltung, können wir Gelassenheit bewahren.
Nachrichten vs. Inneren Frieden – Praktische Wege zu mehr Gelassenheit
Was bedeutet das konkret? Erstens: Nachrichtenkonsum reduzieren. Niemand ist verpflichtet, sich täglich in Krisenmeldungen zu stürzen. Schon ein wöchentlicher Überblick aus seriösen Quellen kann genügen. Zweitens: Akzeptanz üben. Die Stoiker sprachen von Amor Fati – der Liebe zum Schicksal. Was wir nicht verhindern können, sollten wir annehmen. Drittens: Die Vergänglichkeit im Blick behalten. Jede Krise, so gewaltig sie erscheint, ist Teil des ständigen Wandels. Pandemien, Kriege oder Wirtschaftseinbrüche prägen Epochen, werden aber irgendwann verblassen. Marcus Aurelius schrieb: „Die Welt ist nichts als Veränderung.“
Von der Sorge zur Souveränität
Wer sich von den Schlagzeilen treiben lässt, verliert Energie und Zuversicht. Wer aber bewusst Abstand nimmt, entdeckt Freiraum. Dieser Raum kann gefüllt werden mit Dingen, die wir tatsächlich beeinflussen können: Beziehungen, Arbeit, Kreativität, Gesundheit. Viktor Frankl formulierte es klar: „Wenn wir eine Situation nicht ändern können, sind wir gefordert, uns selbst zu ändern.“ Genau hier liegt der Schlüssel. Es geht nicht darum, die Augen vor der Welt zu verschließen, sondern darum, die eigene seelische Balance nicht dem Algorithmus oder den Schlagzeilen zu überlassen.
Fazit: Frieden als bewusste Entscheidung
Die Nachrichten sind kein neutrales Fenster zur Realität. Sie sind gefiltert, übertrieben und von ökonomischen Interessen getrieben. Wer das versteht, kann sich bewusster entscheiden, wie viel Raum man ihnen im eigenen Leben einräumt. Absolute Ignoranz ist nicht notwendig, wohl aber eine klare Begrenzung. Die innere Ruhe entsteht nicht durch das ständige Konsumieren von Informationen, sondern durch die Fähigkeit, das Unkontrollierbare zu akzeptieren und das Kontrollierbare zu gestalten. Wer sich diese Haltung aneignet, gewinnt genau das zurück, was die Schlagzeilen am meisten bedrohen: inneren Frieden.
Lass nicht zu, dass Nachrichten deinen inneren Frieden zerstören
Sven Wunder – Daybreak: Ein orchestraler Sonnenaufgang voller Tiefe und Eleganz 29 Sep 1:31 AM (23 days ago)

Mit Daybreak präsentiert Sven Wunder, alias Joel Danell aus Schweden, sein fünftes Studioalbum. Das Konzept ist klar und bildstark: eine musikalische Reise, die mit den ersten Strahlen des Morgens beginnt, sich durch die Dynamik des Tages bewegt und schließlich sanft in die Nacht übergeht. Dabei entfaltet sich ein Werk, das mehr als nur Begleitmusik liefert, sondern eine durchkomponierte Erzählung bietet.
Schon beim ersten Hören wird deutlich, dass Daybreak nicht als lose Sammlung von Songs gedacht ist. Vielmehr gleicht es einem Soundtrack für einen nicht existierenden Film, in dem jede Komposition ein Kapitel darstellt. Dieses narrative Moment zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Platte und verleiht ihr eine besondere Geschlossenheit.
Sven Wunder x Daybreak – Sounds zwischen Jazz, Pop und Orchester
Die Handschrift von Sven Wunder lebt von einer klaren Mischung aus Jazz-Pop, weichen Percussion-Elementen und warmen Bläsern. Mit Daybreak erweitert er dieses Fundament und setzt verstärkt auf orchestrale Elemente. Streicher, Holzbläser und ein kraftvoller Rhythmusblock fügen der Musik eine neue Dimension hinzu.
So entstehen Klangbilder, die sowohl monumental als auch intim wirken. Zarte Flötenlinien schweben über weit gespannten Streicherflächen, während rhythmische Akzente dem Ganzen eine treibende Energie verleihen. Dieser Wechsel zwischen filigraner Zartheit und orchestraler Wucht sorgt dafür, dass die Spannung durchgehend erhalten bleibt.
Die Einflüsse von Soundtracks, Library Music und klassischer Filmmusik sind deutlich spürbar. Doch Wunder gelingt es, diese Inspirationen in eine zeitgemäße Form zu gießen, die nie nostalgisch hängenbleibt, sondern eigene Akzente setzt.
Ein Projekt voller Kollaborationen
Obwohl Daybreak maßgeblich von Danell gesteuert wurde, lebt das Album von der Zusammenarbeit mit anderen Musikern. Zahlreiche schwedische Jazzkünstler, enge Freunde und Wegbegleiter, haben ihren Teil zum Sound beigetragen. Besonders hervorzuheben ist Malcolm Catto, Drummer und Produzent, der dem Album mit markanten Grooves zusätzliche Tiefe verleiht.
Die Streicher wurden mit der Stockholm Studio Orchestra unter Erik Arvinder aufgenommen. Diese Kooperation verleiht den Arrangements nicht nur technische Perfektion, sondern auch emotionale Wärme. Das Ergebnis ist eine Aufnahme, die sowohl makellos klingt als auch spürbar beseelt ist.
Sven Wunder x Daybreak – Eine konsequente Weiterentwicklung
Seit dem Debüt „Eastern Flowers“ im Jahr 2019 hat sich Sven Wunder zu einem international gefeierten Künstler entwickelt. Seine Alben haben Vergleiche mit Größen wie David Axelrod ausgelöst, zudem wurde seine Musik in Modekampagnen eingesetzt, unter anderem von Tyler, The Creator.
Mit Daybreak geht Sven Wunder den nächsten Schritt. Es ist ohne Zweifel sein ambitioniertestes Projekt, was er selbst bestätigt: „Dieses Album hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es hat Jahre gedauert, bis es fertig war, und es ist das ambitionierteste Projekt, das ich je umgesetzt habe.“ Diese Worte spiegeln sich im Ergebnis wider.
Fazit
Daybreak ist ein Werk voller Eleganz, Tiefe und cineastischer Kraft. Es vereint orchestralen Reichtum mit Wunders unverwechselbarer Handschrift und zeigt, wie vielschichtig zeitgenössische Instrumentalmusik sein kann. Wer sich darauf einlässt, erlebt einen musikalischen Tagesablauf, der nicht nur die Natur, sondern auch das eigene Innenleben widerspiegelt.
Sven Wunder – „Daybreak“ // Spotify Stream:
Sven Wunder – „Daybreak“ // apple Music Stream:
Jim Carrey und das Paradox des Lebens: Wenn Loslassen zur wahren Freiheit führt 26 Sep 5:42 AM (25 days ago)

Jim Carrey ist weltbekannt für seine Rollen in „Ace Ventura“, „The Mask“ oder „Dumb and Dumber“. Doch hinter dem clownesken Gesicht verbirgt sich ein Mensch, der seit Jahrzehnten nach spiritueller Wahrheit sucht. Im Video „The Harder You Try, The Worse It Gets – Jim Carrey On The Paradox Of Life“ offenbart er eine Sicht auf das Leben, die viel tiefer reicht als jede Hollywood-Komödie. Es geht um Liebe statt Angst, um Authentizität statt Maske und um das Paradox, dass wir Freiheit nicht durch Anstrengung, sondern durch Loslassen finden. Jim Carrey und das Paradox des Lebens: Wenn Loslassen zur wahren Freiheit führt.
Gedanken sind Illusion – wer ist der Beobachter?
Jim Carrey erzählt von einem Moment, in dem er begriff: Gedanken sind nur Erscheinungen, keine Realität. Als er sich fragte: „Wer ist es, der denkt?“ öffnete sich eine neue Perspektive. Er erkannte, dass er mehr ist als Körper oder Karriere. Er fühlte sich als Teil des Universums, nicht als isolierte Figur. Dieser Gedanke ist radikal, doch er erinnert an buddhistische Lehren. Buddha sprach davon, dass Leid durch Anhaftung entsteht. Carrey bestätigt dies mit seiner eigenen Erfahrung: Nur wenn wir Gedanken beobachten, statt sie zu glauben, öffnet sich Raum für Freiheit.
Die Rolle des Entertainers – und das stille Kind im Zimmer
Schon als Kind lebte Carrey zwei Leben. Im Wohnzimmer unterhielt er seine Familie, um die kranke Mutter von ihrem Schmerz abzulenken. Im eigenen Zimmer schrieb er auf, was das Leben bedeutet. Diese Spaltung begleitete ihn bis ins Erwachsenenalter. Seine Schauspielkarriere führte ihn in unzählige Rollen. Doch irgendwann stellte er fest: Auch „Jim Carrey“ war nur eine Rolle. Die Person, die die Welt kannte, war eine Konstruktion. Wer bleibt übrig, wenn man das alles loslässt? Genau diese Frage macht seine Suche so universell.
Depression als tiefer Ruhebedarf
Carrey spricht offen über seine Kämpfe mit Depression. Für ihn bedeutet das Wort „depressed“ nicht nur Krankheit, sondern „deep rest“. Der Körper verlangt nach tiefer Ruhe vom ständigen Spiel. Er will keine Maske mehr tragen. Traurigkeit entsteht aus Umständen, Depression dagegen aus dem Zwang, eine falsche Identität aufrechtzuerhalten. Diese Perspektive nimmt der Depression das Stigma. Sie wird zu einem Hinweis, dass es Zeit ist, authentisch zu leben.
Jim Carrey x Loslassen – Authentizität als Schlüssel
Carrey betont: Immer wenn er unaufrichtig war, fühlte er Leere. Aber wenn er authentisch handelte, selbst mit Risiko, erlebte er Kraft. Authentizität enttäuscht nie, weil sie mit dem Fluss des Lebens verbunden ist. Seine Botschaft lautet: Wer du bist, genügt. Rollen und Erwartungen sind Nebel. Echte Erfüllung kommt, wenn du dich traust, sichtbar zu sein – auch mit deinen Schwächen.
Liebe oder Angst – die Wahl jedes Moments
Für Carrey reduziert sich alles auf zwei Optionen: Liebe oder Angst. Angst hält uns klein, treibt uns in Rollen und macht uns abhängig von Bestätigung. Liebe öffnet uns, erlaubt Verletzlichkeit und schafft Verbindung. „Life doesn’t happen to you, life happens for you“, sagt Carrey. Das Leben arbeitet nicht gegen uns. Es entfaltet sich für uns, wenn wir die Angst loslassen und Türen durchschreiten, die sich öffnen.
Ruhm, Erfolg und die große Illusion
Carrey weiß, wie es ist, ganz oben zu stehen. Er verdiente Millionen, drehte Blockbuster und wurde weltweit gefeiert. Doch Erfüllung fand er dort nicht. Erst als er losließ, erkannte er: Erfolg im Außen stillt nicht den Hunger der Seele. Das Ego verlangt immer mehr, nie genug. Ruhm ist wie ein Anzug auf dem Mond – beeindruckend, aber kein Ort zum Leben. Wirklicher Frieden entsteht, wenn wir erkennen, dass wir schon vollständig sind.
Das Paradox des Lebens
Der Titel des Videos bringt es auf den Punkt: Je mehr wir krampfhaft nach Glück greifen, desto mehr entgleitet es uns. Freiheit kommt nicht durch Kontrolle, sondern durch Hingabe. Carrey lädt dazu ein, das Leben wie ein Spiel zu sehen. Alles ist Ausdruck des Bewusstseins, alles ist bereits göttlich. Unsere Aufgabe ist nicht, etwas hinzuzufügen, sondern das „Ich“ loszulassen, das uns trennt.
Jim Carrey x Loslassen – Fazit
Jim Carrey zeigt im Video (Youtube), dass die wahren Antworten nicht in Ruhm oder Erfolg liegen. Sie liegen im Loslassen, in der Liebe und in der Authentizität. Er ruft dazu auf, die Masken abzulegen, Depression als Signal zu verstehen und den Mut zu haben, sichtbar zu sein. Das Paradox ist klar: Je mehr wir versuchen, uns selbst zu beweisen, desto leerer werden wir. Aber wenn wir aufhören zu kämpfen, entdecken wir, dass wir längst Teil von etwas Größerem sind.
Jim Carrey und das Paradox des Lebens: Wenn Loslassen zur wahren Freiheit führt
Lady Wray – „Cover Girl“: Selbstliebe im Soulgewand 26 Sep 1:45 AM (25 days ago)
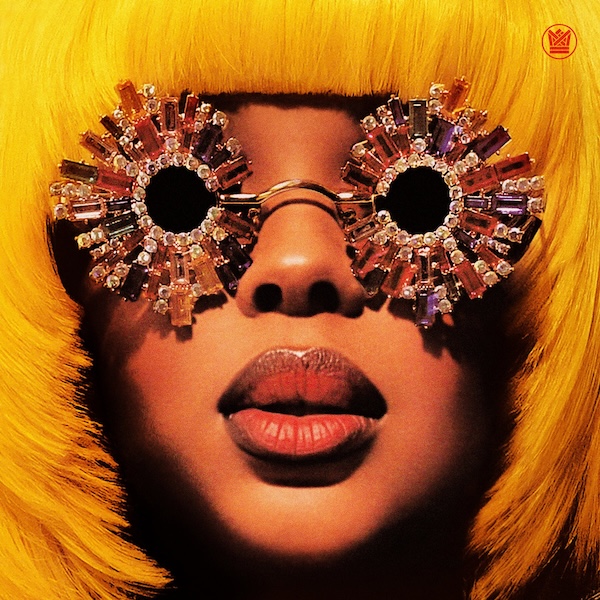
Mit Cover Girl meldet sich Lady Wray nach drei Jahren Pause eindrucksvoll zurück. Das vierte Studioalbum ist eine Feier von Selbstliebe, Empowerment und persönlichem Wachstum. Es vereint Retro-Soul mit modernen R&B– und Gospel-Einflüssen – und zeigt eine Künstlerin, die ihr Licht endlich voll und ganz erstrahlen lässt.
Lady Wray x Cover Girl – Vom Nachdenken zur Selbstsicherheit
Während „Piece of Me“ (2022) stark von introspektiven Themen geprägt war, markiert Cover Girl den nächsten Schritt. Lady Wray beschreibt das Album selbst als eine „awakening explosion“. Sie besingt nicht mehr nur die Herausforderungen von Mutterschaft und Karriere, sondern strahlt eine unerschütterliche Selbstsicherheit aus. Songs wie My Best Step oder Be a Witness zeigen diese neue Haltung bereits in den ersten Minuten: Hier singt eine Frau, die weiß, was sie will, und ihre Stimme trägt diese Botschaft klar und warm.
Soul, Funk und ein Hauch von Disco
Musikalisch verschmilzt Lady Wray mit Produzent Leon Michels die goldene Ära des Soul mit modernen Akzenten. Analoge Wärme, punchige Drums, Retro-Bläser und Streicher prägen das Klangbild. Doch zwischendurch blitzen Hip-Hop-Breaks oder dezente Synths auf, die die Songs frisch und zeitlos wirken lassen. Ein Paradebeispiel ist die Single You’re Gonna Win, die wie eine Disco-Hymne aus den Siebzigern klingt, dabei aber moderne Strahlkraft entfaltet.
Verletzlichkeit und Stärke im Gleichgewicht
Die Stärke von Cover Girl liegt in der Balance zwischen Party und Tiefgang. Nach hymnischen Momenten wie Hard Times folgt mit Where Could I Be eine intime Ballade voller Selbstzweifel. Hier zeigt Lady Wray, wie nah Freude und Verletzlichkeit beieinanderliegen. Das Titelstück wiederum ist der emotionale Kern des Albums. Mit minimalistischer Instrumentierung richtet sich Wray an ihr jüngeres Ich – und an ihre Tochter – und formuliert ein klares Bekenntnis: Wahre Schönheit liegt in Authentizität, nicht im „Cover-Up“.
Persönlich und universell zugleich
Besonders eindrucksvoll wirkt, wie sehr Lady Wray (Insta) ihre Rollen als Sängerin, Mutter und Ehefrau miteinander verknüpft. In Songs wie Hard Times oder Higher feiert sie die Liebe zu Partner und Kind, ohne in Kitsch zu verfallen. Stattdessen entstehen kraftvolle Botschaften, die universell lesbar sind. Man spürt: Hier singt jemand nicht nur für sich, sondern auch für die nächste Generation.
Lady Wray x Cover Girl – Ein Album mit Bogen und Tiefe
Cover Girl ist kein loses Sammelsurium von Songs, sondern folgt einem narrativen Faden. Vom euphorischen Beginn über die verletzlichen Momente bis hin zum spirituellen Finale in Calm durchläuft das Album eine glaubhafte Entwicklung. Jede Station hat ihr Gewicht, nichts wirkt zufällig. Damit gelingt Lady Wray etwas, das viele moderne R&B-Alben vermissen lassen: echte Kohärenz.
Fazit: Lady Wray in voller Blüte
Mit Cover Girl legt Lady Wray ihr bisher rundestes Werk als Lady Wray vor. Die Mischung aus Retro-Soul, Disco-Anleihen und modernen R&B-Elementen ist ebenso stimmig wie ihre thematische Bandbreite. Vor allem aber überzeugt ihre Stimme – mal kraftvoll wie ein Gospelchor, mal intim wie ein geflüstertes Geständnis. Wer Soul mit Substanz sucht, kommt an diesem Album nicht vorbei.
Lady Wray – „Cover Girl“ // Spotify Stream:
Lady Wray – „Cover Girl“ // apple Music Stream:
Bayerns Plan, Österreich beizutreten – ein fast vergessenes Nachkriegskapitel 25 Sep 6:15 AM (26 days ago)

Sommer 1945: Europa liegt in Trümmern. Deutschland liegt am Boden. München, Nürnberg und Berlin sind zerstört, Millionen Menschen auf der Flucht. Während die Siegermächte das Land in Zonen aufteilen, spinnen bayerische Politiker eine kühne Idee: Bayern solle nicht länger zu Deutschland gehören, sondern sich Österreich anschließen. Ein katholisch geprägtes Alpenreich, das sich vom preußischen Militarismus absetzt und eine eigene Rolle in Europa einnimmt. Bayerns Plan, Österreich beizutreten – ein fast vergessenes Nachkriegskapitel.
Bayerns Plan Österreich beizutreten – Historische Nähe zu Wien
Ganz abwegig war der Gedanke nicht. Jahrhunderte verband Bayern eine enge Beziehung zu den Habsburgern. Die katholische Prägung, die Dialekte, die Mentalität – vieles wirkte in Wien vertrauter als in Berlin. Nach 1945 fühlten sich manche in Bayern tatsächlich näher bei den Österreichern. Josef Müller, CSU-Mitgründer, sah in einem Anschluss die Chance, Bayern aus der deutschen Schuld herauszulösen. Auch Teile des Klerus hielten das für eine gute Idee.
Die Alliierten debattieren
Amerikanische Offiziere prüften den Plan. Sie sahen ein katholisches Alpengebilde als potenzielle Stabilisierung gegen den Kommunismus. Die Briten jedoch blockten sofort ab. Jede neue Form deutschsprachiger Einheit war ihnen suspekt. Die Sowjets wiederum fürchteten einen westlich orientierten Block mitten in Europa. Österreich selbst zeigte Sympathien, wollte aber vor allem seine eigene, gerade erst zurückgewonnene Unabhängigkeit sichern.
Bayern wollte Österreich beitreten – Was wäre wenn?
Hätte Bayern tatsächlich Österreich beitreten können, sähe Europa heute völlig anders aus. München und Wien wären die Metropolen eines Alpenreichs. Westdeutschland wäre geschwächt, die Wiedervereinigung vielleicht nie erfolgt. Manche Historiker vergleichen dieses hypothetische Gebilde mit der Schweiz: neutral, wohlhabend, unabhängig, aber mitten im Herzen Europas.
Kleine Randnotizen zum heutigen Bayern
Wenn man diesen Plan heute betrachtet, klingt er fast verlockend. Bayern hätte sich von den Schrullen des deutschen Nordens gelöst und seine Eigenständigkeit bewahrt. Gleichzeitig wäre man einige Probleme losgeworden, die sich bis heute ziehen. Nehmen wir Markus Söder: legendär seine Verkleidungen als Superman, Shrek oder Marilyn Monroe auf Faschingsbällen – Bilder, die mehr an Provinzposse erinnern als an Staatsmann. Auch seine Kehrtwenden bei politischen Themen sind mittlerweile Kabarettklassiker.
Cannabis und der uncoolste Deutsche
Ein Bekannter sagte einmal: „Der Bayer ist einfach kein cooler Zeitgenosse.“ Vielleicht liegt das auch an der Rolle des Freistaats bei der Cannabis-Legalisierung. Während Berlin und Hamburg pragmatisch diskutierten, polterte München gegen jede Liberalisierung, als ginge es um den Untergang des Abendlands. Ironisch: Wäre Bayern bei Österreich gelandet, wäre es heute wohl längst Teil einer liberaleren Cannabis-Kultur – und nicht der ewige Bremsklotz.
Österreich als verpasste Chance
Das Alpenreich wäre kulturell wohl eine spannende Symbiose geworden. Wien als Hauptstadt der Kultur, München als Wirtschaftsmotor. Tourismus, Landwirtschaft und Industrie hätten sich gegenseitig gestützt. Politisch hätte ein solches Konstrukt den Kalten Krieg verändert – wahrscheinlich hätte sich die Neutralität Österreichs nie ergeben, sondern eine klare Westbindung. Europa hätte ein drittes Machtzentrum erhalten.
Bayerns Plan Österreich beizutreten – Ein Traum für die Zukunft?
Natürlich blieb alles Theorie. Die Alliierten entschieden sich für ein geeintes Westdeutschland, Österreich behauptete seine Eigenständigkeit. Der Traum vom Alpenstaat verschwand aus den Geschichtsbüchern. Doch die Idee ist bis heute faszinierend: ein selbstbewusster, kulturell geerdeter Staat zwischen Deutschland und Italien, stark in Wirtschaft, Tourismus und Kultur. Wer weiß – vielleicht erleben wir irgendwann wieder Bewegungen in diese Richtung. Europa ist im Wandel, Nationalstaaten hinterfragen sich. Ein „Bavaria-Austria“ klingt heute nicht mehr nur nach einer historischen Fußnote, sondern nach einer kuriosen, fast charmanten Möglichkeit.
Bayerns Plan, Österreich beizutreten – ein fast vergessenes Nachkriegskapitel
Dijon veröffentlicht „Baby“: R&B zwischen Chaos, Intimität und experimenteller Freiheit 25 Sep 2:01 AM (26 days ago)
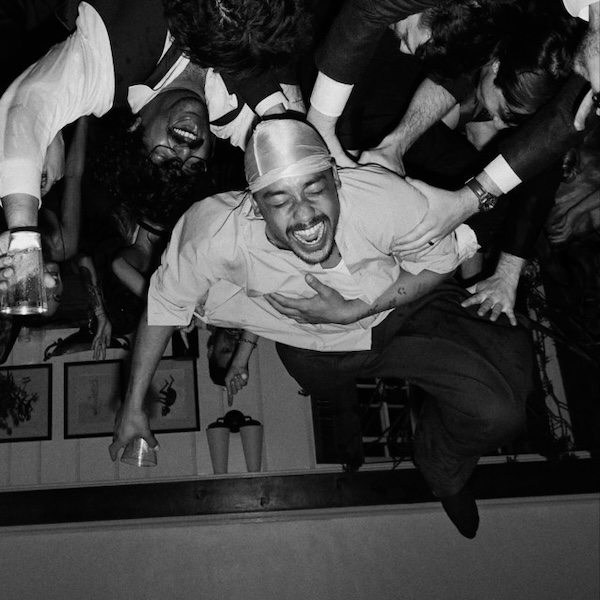
Mit „Absolutely“ legte Dijon 2021 ein Debüt vor, das intime Wohnzimmer-Atmosphäre mit musikalischer Radikalität verband. Sein Nachfolger „Baby“ erweitert diesen Ansatz ins Extreme. Wo „Absolutely“ noch nach einer Session am Küchentisch klang, entfaltet „Baby“ von Dijon ganze Räume, die sich stetig wandeln – von warmem Sonnenlicht bis zu grellem Neon. Überraschend ohne Singles veröffentlicht, markiert das Album eine konsequente Weiterentwicklung.
Dijon x Baby – Fragmentierte Intimität und das Thema Familie
Ein zentrales Thema ist Dijons neues Leben als Vater. Textfragmente erzählen von Nähe, Sex, Chaos, Kindern und einer Liebe, die Unsicherheiten auslöscht. Doch die Botschaften sind selten klar, vielmehr tauchen sie in verfremdeten Soundflächen auf. Reverb, Delay und Verzerrung machen jede Zeile zum Echo, jede Gitarre zum gebrochenen Spiegelbild ihrer selbst. Dadurch klingt das Private gleichzeitig nah und entrückt.
Klangästhetik zwischen Soul, Noise und Collage
„Baby“ wirkt wie eine Collage: Sounds stoßen aufeinander, brechen ab, lösen sich auf. Songs wie „HIGHER!“ stolpern über eigene Takte, während „FIRE!“ in übersteuerten Frequenzen fast auseinanderreißt. Akustische Elemente wie die Gitarre des Titeltracks werden zerschnitten und neu zusammengesetzt. Dadurch entsteht der Eindruck, man höre die Musik direkt aus dem vibrierenden Lautsprecher heraus. Dijon wählt absichtlich Fehler als Ästhetik – ein Gegenentwurf zur klinischen Präzision moderner R&B-Produktionen.
Ein Netzwerk von Einflüssen und Gästen
Die Referenzen sind vielfältig: Frank Ocean, Bilal, D’Angelo, die Soulquarians, Bon Iver und natürlich Prince. Vor allem jener Prince, der „The Ballad of Dorothy Parker“ auf defektem Mischpult aufnahm – ein Track, der wie beschädigt wirkt und gerade deshalb faszinierend bleibt. Auf „Baby“ finden sich außerdem musikalische Beiträge von Größen wie Pino Palladino, Tobias Jesso Jr. oder Justin Vernon. Mit an Bord sind auch die bewährten Weggefährten Andrew Sarlo, Henry Kwapis und Mk.gee, die schon „Absolutely“ geprägt hatten.
Dijon x Baby – Highlights im Wechselspiel
Trotz aller Brüche blitzen zugänglichere Momente auf. „Yamaha“ schimmert beinahe klassisch, fast wie ein Single-Kandidat. Der Abschluss „Kindalove“ öffnet eine helle, luftige Klangwelt, nur um am Ende in endlosem Hall zu versinken. Diese Dualität zieht sich durch das gesamte Album: zwischen Verletzlichkeit und Übersteuerung, Nähe und Distanz.
Kritikerlob und Resonanz
Die Resonanz war überwältigend. Pitchfork vergab 9.0 Punkte, Rolling Stone 4,5 von 5 Sternen, Paste gar die Höchstwertung. Fast alle Reviews betonen den experimentellen Charakter, die postmoderne Fragmentierung und den Mut zur Unfertigkeit. Auf Metacritic steht „Baby“ aktuell bei 93 Punkten – ein klarer Hinweis auf universelle Anerkennung.
Dijon als Gegenwart und Zukunft von R&B
Dijon ist kein Künstler, der sich in klare Schubladen pressen lässt. Seine Songs sind weniger klassische Stücke als Prozesse – sie fließen, zerfallen, formieren sich neu. Damit führt er R&B an einen Punkt, an dem Fehler zu Wahrheit werden. „Baby“ ist ein Album, das man nicht nur hört, sondern erlebt. Es fordert Geduld, belohnt aber mit einer Intensität, die lange nachhallt.
Dijon – „Baby“ // Spotify Stream:
Dijon – „Baby“ // apple Music Stream:
Der Cobra-Effekt: Wenn gute Absichten katastrophale Folgen haben 24 Sep 5:24 AM (27 days ago)

Der Begriff Cobra-Effekt beschreibt Situationen, in denen gut gemeinte Maßnahmen zu noch schlimmeren Ergebnissen führen. Ursprünglich geht er auf ein Ereignis im frühen 20. Jahrhundert zurück. In Delhi hatten die britischen Kolonialherren ein massives Problem mit giftigen Kobras. Die Behörden beschlossen, eine Prämie für jede getötete Schlange auszuzahlen. Anfangs schien die Strategie zu funktionieren: Schlangen wurden eingefangen, getötet und gegen Geld eingetauscht. Doch schon bald wandelte sich die Idee zum Desaster.
Einige Einheimische begannen, Kobras systematisch zu züchten, nur um sie für die Belohnung wieder abzuliefern. Als die Regierung den Betrug erkannte und das Programm einstellte, verloren die Tiere plötzlich ihren Wert. Die gezüchteten Kobras wurden freigelassen – und die Plage war schlimmer als zuvor.
Cobra Effekt – Ratten in Hanoi und Nägel in der Sowjetunion
Ein sehr ähnlicher Vorfall ereignete sich in Vietnam, damals unter französischer Kolonialherrschaft. Die Behörden wollten die Rattenplage eindämmen und zahlten eine Prämie für jede abgegebene Rattenschwanzspitze. Die Folge: Die Tiere wurden nicht getötet, sondern lediglich verstümmelt und freigelassen, um sich weiter fortzupflanzen. So entstanden neue Schwärme – das Problem wurde verschärft.
Auch im sowjetischen Wirtschaftssystem zeigte sich die Absurdität fehlgeleiteter Anreize. Um die Nagelproduktion zu steigern, wurden Arbeiter zunächst nach Stückzahl bezahlt. Sie stellten winzige, unbrauchbare Nägel her. Als daraufhin nach Gewicht vergütet wurde, produzierten die Fabriken riesige, nutzlose Nägel. Die Ziele der Regierung wurden formal erfüllt, aber die Bedürfnisse der Gesellschaft ignoriert.
Das Prinzip hinter dem Chaos: Goodharts Gesetz
Diese Beispiele illustrieren eine ökonomische Erkenntnis, die als Goodharts Gesetz bekannt ist: „Wenn eine Messgröße zum Ziel wird, verliert sie ihren Wert als Messgröße.“ Sobald ein Belohnungssystem eingeführt wird, optimieren Menschen auf die Kennzahl – und nicht mehr auf das eigentliche Problem. Statt weniger Schlangen gab es mehr. Statt weniger Ratten gab es mehr. Statt nützlicher Nägel entstand wertloser Schrott.
Cobra Effekt – Wenn Probleme lukrativ werden
Das Video von After Skool weist darauf hin, dass Anreizsysteme immer wieder scheitern, sobald sie das Problem selbst belohnen. Wird eine Krankheit finanziell lukrativ, lohnt sich ihre Heilung kaum. Bleiben Menschen krank, fließen weiter Gewinne in die Pharmaindustrie. Ein geheiltes Problem bedeutet dagegen verlorene Einnahmen. Genau daraus entstehen die bekannten „industriellen Komplexe“: vom Militär über das Gefängnissystem bis zur Drogenbekämpfung. Probleme werden so zum Geschäftsmodell.
Der Psychologe Carl Jung brachte es prägnant auf den Punkt: Wenn man das Handeln einer Person nicht versteht, sollte man die Konsequenzen betrachten – sie offenbaren meist die wahren Motive.
Erfolgreiche Beispiele für kluge Anreize
Doch nicht jede Belohnungsstruktur führt ins Verderben. In den 1970er Jahren führte Oregon ein Pfandsystem für Getränke ein. Kunden zahlten beim Kauf einer Flasche oder Dose einen kleinen Aufpreis, den sie bei Rückgabe erstattet bekamen. Das Ergebnis: über 80 % Rücklaufquote, drastisch weniger Müll und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.
Der Unterschied liegt im Fokus: Belohnt wird nicht das Vorhandensein des Problems, sondern seine Verringerung. Weniger Müll bedeutet mehr Rückerstattung. Hier stimmte die Balance zwischen individuellem Eigeninteresse und kollektivem Nutzen.
Kultur als unsichtbarer Faktor
Selbst die besten Anreizsysteme stoßen jedoch an Grenzen. Menschen nutzen jedes Schlupfloch, wenn es keine kulturellen oder moralischen Leitplanken gibt. Ein funktionierendes Gemeinwesen entsteht deshalb nicht nur durch Strukturen, sondern auch durch eine Kultur des Verantwortungsbewusstseins. Wo Menschen ein gemeinsames Ziel verinnerlichen, braucht es weniger externe Belohnungen.
Cobra Effekt // Fazit
Der Cobra-Effekt zeigt eindrücklich, wie leicht gute Absichten scheitern können, wenn die falschen Anreize gesetzt werden. Statt Probleme wirklich zu lösen, entstehen oft neue Abhängigkeiten und industrielle Komplexe. Doch mit klug entworfenen Belohnungen, die an messbare Ergebnisse gekoppelt sind, lassen sich positive Veränderungen bewirken. Entscheidend ist, den Blick auf das langfristige Ziel zu richten – nicht auf kurzfristige Kennzahlen.
Der Cobra-Effekt: Wenn gute Absichten katastrophale Folgen haben
Jimmy Kimmel ist zurück: Ein Monolog für die Geschichtsbücher 24 Sep 12:18 AM (28 days ago)

Jimmy Kimmel meldet sich zurück auf der Late-Night-Bühne – und sein Comeback hat mehr Gewicht als eine einfache Rückkehr in den gewohnten Sendebetrieb. Nach einer sechstägigen Suspendierung durch ABC, ausgelöst von einer Kontroverse rund um seine Aussagen zum Mord an dem Rechtsextremisten Charlie Kirk, steht der Entertainer wieder vor der Kamera. Was folgte, war ein Monolog, der bereits als einer der wichtigsten Momente der amerikanischen Late-Night-Geschichte bezeichnet wird.
Zwischen Suspension und Solidarität
Die Suspendierung war eine Reaktion auf Jimmy Kimmels unglücklich gewählte Bemerkungen. Viele empfanden seine Worte als unsensibel, andere als missverständlich. Doch anstatt in der Versenkung zu verschwinden, entfachte die Debatte eine Welle an Solidarität. Bemerkenswert: Nicht nur Kollegen wie Stephen Colbert, John Oliver oder Jimmy Fallon stellten sich hinter ihn, sondern auch politische Gegner wie Ted Cruz oder Ben Shapiro verteidigten Kimmels Recht auf freie Rede.
Gerade dieser Schulterschluss verlieh der Rückkehr Gewicht. Denn es ging plötzlich nicht mehr nur um einen Entertainer, sondern um den Kern amerikanischer Demokratie: das Recht, seine Meinung zu äußern – selbst wenn diese polarisiert.
Besonders amüsant: Auch internationale Kollegen meldeten sich bei Kimmel. So bot ihm Stefan Raab aus Deutschland scherzhaft einen Job an – ein Angebot, das Kimmel mit einem Grinsen kommentierte: „Die Deutschen sind inzwischen freier als wir – kommt rüber, sagen sie.“
Jimmy Kimmel ist zurück: Ein Monolog zwischen Demut und Angriffslust
Kimmel nutzte sein Comeback für eine Mischung aus Selbstkritik, Dankbarkeit und Angriff auf die politischen Kräfte, die hinter seiner Suspendierung standen. Er stellte klar: Es sei nie seine Absicht gewesen, den Mord an Charlie Kirk ins Lächerliche zu ziehen oder ganze Gruppen pauschal zu beschuldigen. Er bat indirekt um Verständnis und räumte ein, dass seine Worte missverständlich gewirkt haben könnten.
Gleichzeitig aber warnte er vor den Gefahren einer Regierung, die versucht, Medieninhalte zu kontrollieren. Kimmel zitierte Drohungen der FCC, die Sender und Plattformen unter Druck gesetzt habe. Sein Fazit war eindeutig: „Wenn wir die Meinungsfreiheit verlieren, verlieren wir nach und nach auch alle anderen Rechte.“
Die politische Dimension
Die New York Times wie auch andere US-Medien betonten die politische Dimension dieser Rückkehr. Während die Regierung versuchte, Einfluss auf die Ausstrahlung zu nehmen, nutzten einige lokale Sender die Gelegenheit, Kimmels Show nicht mehr ins Programm aufzunehmen. Rund 20 Prozent des Landes konnten seine Rückkehr nicht live sehen – ein deutliches Zeichen dafür, wie politisch und ökonomisch zerrissen die Medienlandschaft derzeit ist.
Damit wurde aus einem Unterhaltungsformat ein politischer Lackmustest. Late Night wurde zur Bühne für einen Diskurs, der normalerweise in Kongressen oder Zeitungseditorials stattfindet: Wo endet Satire, wo beginnt Zensur, und wie viel Macht darf eine Regierung über Unterhaltung überhaupt haben?
Dank an Gegner, Appell an die Nation
Besonders eindringlich wirkte Kimmels Dank an politische Gegner, die sein Recht auf freie Rede verteidigten. Er lobte deren Mut, sich trotz ideologischer Differenzen gegen staatliche Zensur auszusprechen. Es war ein seltener Moment der parteiübergreifenden Einigkeit in den USA.
Zudem verwies er auf ein bewegendes Beispiel der Vergebung: Erika Kirk, die Witwe des ermordeten Rechtsextremisten Charlie Kirk, habe dem Täter öffentlich vergeben. Kimmel präsentierte dies als Vorbild für gesellschaftlichen Zusammenhalt – eine Botschaft, die seine Rede über die Grenzen von Comedy hinaus zu einem moralischen Appell machte.
Risiken und Chancen
Die Rückkehr ist nicht ohne Risiko. ABC und Disney setzen sich Angriffen aus – politisch wie wirtschaftlich. Lokale Sender verweigern sich, Werbekunden beobachten kritisch, und jeder Satz wird auf die Goldwaage gelegt. Kimmel selbst erkennt die Fragilität seiner Position an: Ein weiterer Fehltritt könnte nicht nur seiner Karriere, sondern dem gesamten Format Late Night schaden.
Doch gerade darin liegt auch eine Chance. Wenn es Kimmel gelingt, die Balance zwischen Humor, Kritik und Versöhnung zu halten, könnte sein Comeback als Wendepunkt in Erinnerung bleiben. Nicht als Fallstrick, sondern als Beweis, dass Satire auch in Zeiten politischer Spannungen ein Grundpfeiler der Demokratie ist.
Fazit: Mehr als Entertainment
Jimmy Kimmels Rückkehr markiert einen entscheidenden Moment für die amerikanische Medienlandschaft. Sein Monolog war zugleich Entschuldigung, Warnung und Manifest. Es geht nicht nur um die Zukunft eines TV-Hosts, sondern um die Frage, ob in den USA noch Platz für unbequeme Stimmen bleibt. Das Publikum hat entschieden: Millionen schalteten ein, die Debatte reißt nicht ab, und Kimmel selbst positioniert sich als Symbol für das, was Satire im besten Sinne sein kann – unbequem, verletzlich, aber notwendig.
Jimmy Kimmel ist zurück: Ein Monolog für die Geschichtsbücher
Tropical Modernism in Perfektion: Das Liljestrand House in Honolulu 23 Sep 6:00 AM (28 days ago)

Das Liljestrand House gilt als eines der bedeutendsten Beispiele für „Hawaiian Modernism“ und zählt zu den ikonischen Werken von Vladimir Ossipoff. Der russisch-japanisch geprägte Architekt entwarf das Haus 1952 für Howard und Betty Liljestrand. Hoch über Honolulu gelegen, vereint es eine atemberaubende Aussicht mit einer Architektur, die konsequent auf die tropische Umgebung eingeht. Ossipoffs Philosophie war klar: Häuser sollten nicht gegen, sondern mit der Natur arbeiten.
Vladimir Ossipoff – eine Vision zwischen Kulturen
Geboren 1907 in Russland, aufgewachsen in Japan, später ausgebildet in Berkeley, fand Ossipoff seine künstlerische Heimat auf Hawaii. Seine Einflüsse aus der japanischen Architektur sind unübersehbar: klare Linien, die Betonung von Holz, sorgfältige Übergänge zwischen Räumen und Landschaft. Im Liljestrand House arbeitete er eng mit japanischen Handwerkern zusammen, deren Wissen im Tempelbau für die feine Holzarbeit genutzt wurde. Diese Kombination aus Präzision, Einfachheit und kultureller Sensibilität hebt das Haus bis heute hervor.



Ein Haus als Schutzschirm
Eine zentrale Idee Ossipoffs war die Metapher des Daches als „Schirm“. Es schützt vor Regen und Sonne, ohne die Bewohner von der Natur abzuschneiden. Das Haus kann auf mehreren Seiten geöffnet werden, Regen bleibt dennoch draußen. Man hört das Prasseln der Tropfen auf dem Dach, spürt die kühlende Brise aus den Bergen und bleibt doch im Schutz der Architektur. Dieses Gefühl von Geborgenheit und Offenheit zugleich ist ein Markenzeichen von Ossipoffs „tropischem Modernismus“.
Präzision im Einklang mit der Landschaft
Ossipoffs Genie zeigt sich vor allem in der Platzierung des Hauses. Er verstand die lokalen Windrichtungen und nutzte sie für natürliche Ventilation. Kleine Öffnungen auf der Bergseite ziehen die Luft ins Innere, große Fensterflächen auf der gegenüberliegenden Seite lassen sie sanft wieder entweichen. So bleibt das Klima im Haus angenehm, ohne technische Kühlung. Auch der Regen wurde berücksichtigt: selbst bei offenem Grundriss dringen Tropenstürme kaum ein. Diese kluge Anordnung zeigt, wie eng Funktionalität und Ästhetik verbunden sein können.



Ein architektonisches Erlebnis der Enthüllung
Besonders eindrucksvoll ist die Inszenierung des Ankommens. Von der Auffahrt verborgen, betritt man zunächst einen niedrigen, dunklen Eingangsbereich. Erst im Wohnzimmer hebt sich die Decke, das Panorama mit Diamond Head öffnet sich dramatisch vor den Besuchern. Dieses Spiel mit Spannung und Entfaltung stammt direkt aus japanischen Architekturtraditionen. Ossipoff schuf so einen Moment des Staunens, der bis heute unvergessen bleibt.
Originalmöbel und Mid-Century-Details
Das Liljestrand House ist nicht nur wegen seiner Architektur bedeutend, sondern auch wegen seiner originalen Einrichtung. Ossipoff selbst wählte oder entwarf viele Möbelstücke, darunter eingebaute Betten und Regale. Skandinavische Mid-Century-Designs ergänzen die klaren Linien. Bis ins hohe Alter wollte Howard Liljestrand beispielsweise das eigens entworfene Bett nicht austauschen – aus Respekt vor Ossipoffs Arbeit. Dieses Festhalten an den Details bewahrt bis heute die Authentizität des Hauses.



Von der Familiengeschichte zur Stiftung
Howard Liljestrand war Arzt, der ursprünglich nach China zurückkehren wollte. Doch das Leben auf Hawaii faszinierte ihn und seine Frau Betty so sehr, dass sie blieben. Gemeinsam mit Ossipoff schufen sie ein Zuhause, das zu einem Ort für Begegnungen und Erinnerungen wurde. Nach dem Tod der Familie beschlossen die Nachkommen, das Haus nicht zu verkaufen, sondern in die Liljestrand Foundation zu überführen. Diese Stiftung öffnet das Haus heute für Besucher und hält die Geschichte lebendig. Wer nicht so weit reisen möchte, kann sich hier die 3D Virtual Tour ansehen.
Architektur als lebendige Erfahrung
Die Stiftung sieht ihre Aufgabe nicht nur in der Bewahrung, sondern auch in der Vermittlung. Architekturstudenten, Künstler, Fotografen und Designer werden eingeladen, die Räume zu erleben und Vorträge zu halten. Besucher spüren, was Ossipoff meinte: Architektur ist nicht nur Form, sondern Emotion. Das Gefühl, wie sich Räume öffnen, wie Wind und Licht gelenkt werden, vermittelt eindrucksvoller als jedes Lehrbuch, warum gutes Design zählt.
Ein Ort für Vergangenheit und Zukunft
Das Liljestrand House (Instagram) ist mehr als ein Denkmal. Es ist ein lebendiger Ort, an dem Geschichte, Kultur und Design zusammenfließen. Für die Familie bleibt es ein Haus voller Erinnerungen, für die Öffentlichkeit ein Beispiel, wie nachhaltige Architektur aussehen kann. Wer die Räume betritt, versteht, dass Ossipoff nicht nur ein Haus entworfen hat, sondern eine Haltung: Respekt vor Ort, Klima und Gemeinschaft.
Tropical Modernism in Perfektion: Das Liljestrand House in Honolulu
CARRTOONS – „Space Cadet“: Funk, Soul und Zeitreisen im Bassgewand 23 Sep 1:57 AM (28 days ago)

Ben Carr, besser bekannt als CARRTOONS, hat sich in den letzten Jahren als feste Größe etabliert. Seine Karriere begann mit auffälligen Social-Media-Clips, doch schnell folgten makellose Live-Auftritte und die beiden Erfolgsalben Homegrown und Saturday Morning. Mit Space Cadet setzt der Multi-Instrumentalist CARRTOONS aus New York jetzt noch einen drauf und präsentiert ein Album, das Groove, Kollaborationen und Zeitgeist perfekt verbindet.
Seine unverkennbaren Basslinien sind längst sein Markenzeichen. Sie haben ihn nicht nur auf vier NPR Tiny Desk Konzerte gebracht, sondern auch Co-Signs von Legenden wie Pete Rock und DJ Jazzy Jeff eingebracht. Der neue Longplayer beweist, warum diese Stimmen aus der Szene recht behalten.
Carrtoons x Space Cadet – Ein Album zwischen Retro und Zukunft
Space Cadet lebt von einem Retro-inspirierten Sound, der dennoch frisch klingt. Funk, Soul, R&B und Hip-Hop verschmelzen nahtlos, ohne dass Carr seine Handschrift verliert. Die Produktion wirkt warm, analog und voller Groove, während die Features dafür sorgen, dass jede Nummer ihre eigene Dynamik entfaltet.
Der Einstieg gelingt spektakulär mit „ACTION / INTRO“, einem Track, bei dem DJ Jazzy Jeff gleich die Richtung vorgibt. Mit „Thursday Disco“ (feat. Haile Supreme) und „Green Eyed“ (feat. Pale Jay) setzt Carr auf federnde Funk-Elemente. Der absolute Höhepunkt der ersten Hälfte ist „Tightrope“, auf dem Phonte, Topaz Jones und BeMyFiasco ihre Stimmen zu einem echten Showpiece verweben.
Kollaborationen als roter Faden
CARRTOONS ist kein Einzelkämpfer. Das Album lebt von der Vielfalt seiner Gäste, die alle etwas Eigenes beisteuern. Erick the Architect verleiht „Walls Up“ eine fast cineastische Note, während Rae Khalil in „First Place“ für einen souligen Höhepunkt sorgt. Auch Joanna Teters auf „Measure Up“ trägt zur Vielschichtigkeit bei.
Die zweite Hälfte hält mit „Cascade“ (feat. Wiki, Rae Khalil, The Kount) einen weiteren Höhepunkt bereit. Hier trifft East-Coast-Rap auf moderne Funk-Elemente. „Space Cowboys“ mit Jev und August Charles öffnet dann das Klangspektrum in Richtung Neo-Soul, bevor „Fade Away“ (feat. Cisco Swank, Datsunn) introspektiv und fast meditativ wirkt.
Ein Sound mit Geschichte
Was CARRTOONS besonders macht, ist die Balance zwischen musikalischer Tradition und zeitgenössischem Ausdruck. Sein Bass ist nicht nur Instrument, sondern Erzählstimme. Es ist dieser Groove, der schon Legenden wie Roy Ayers, George Clinton oder Jadakiss überzeugt hat. Space Cadet ist die logische Weiterentwicklung einer Karriere, die auf Soul, Funk und Hip-Hop fußt, und dennoch in die Zukunft schaut.
Fazit: Ein Flug ins All mit Bodenhaftung
Mit Space Cadet bestätigt CARRTOONS seinen Status als einer der spannendsten Produzenten unserer Zeit. Das Album ist vielseitig, ohne beliebig zu sein, und es bringt die Retro-Vibes in die Gegenwart, ohne sich in Nostalgie zu verlieren. Wer funkige Basslinien, geschmeidige Grooves und hochkarätige Features schätzt, kommt an diesem Werk nicht vorbei. CARRTOONS bleibt sich treu und liefert ein Album, das gleichermaßen tanzbar, intelligent und zeitlos ist.
CARRTOONS – „Space Cadet“ // Bandcamp Stream:
CARRTOONS – „Space Cadet“ // Spotify Stream:
Mooji über den Ursprung innerer Ruhe: Bewusstsein ist die Quelle 22 Sep 5:04 AM (29 days ago)

„Was sucht jeder Mensch eigentlich?“ – mit dieser schlichten, aber tiefgründigen Frage beginnt der Satsang von Mooji im April 2025 in Monte Sahaja. Was wie eine philosophische Übung klingt, entpuppt sich schnell als präzise Innenschau. Mooji zeigt, dass wir alle auf der Jagd nach etwas sind, das unsere Unruhe stillt. Doch kein äußerer Erfolg, keine Liebe und kein Besitz reicht dauerhaft aus. Alles, was wir erreichen, verliert irgendwann seinen Glanz. Mooji spricht über den Ursprung der ultimativen, inneren Ruhe: Bewusstsein ist die Quelle, es ist die Antwort selbst.
Mooji x Bewusstsein – Das Unstillbare im Herzen
Der Meister beschreibt diese innere Unruhe als „göttlichen Trick“. Ein Drang, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt, solange wir glauben, das Glück müsse im Außen liegen. Sei es Reichtum, Anerkennung oder Schönheit – früher oder später folgt der Moment des „So what?“. Was bleibt übrig, wenn selbst die größten Trophäen ihren Wert verlieren? Mooji verweist darauf, dass dieser Drang nicht bestraft, sondern segnet: er zwingt uns, tiefer zu schauen.
Neti, Neti – nicht dies, nicht das
Die alten Weisen antworteten auf die Frage nach dem Gesuchten mit „Neti, neti“ – „nicht dies, nicht das“. Weder Körper noch Sinnesfreuden, weder Status noch Beziehungen genügen als endgültige Antwort. Alles ist vergänglich und kann uns nicht dauerhaft nach Hause führen. „Heimat“ meint hier nicht ein Haus aus Stein, sondern das Gefühl vollkommenen Ankommens im eigenen Selbst.
Wer ist der Suchende?
Ein zentraler Punkt in Moojis Lehre: Nicht die Frage nach dem Ziel ist entscheidend, sondern die nach dem Suchenden selbst. Wer oder was ist es, das sucht? Ist es der Körper? Der Verstand? Die Seele? Oder das Bewusstsein? Indem wir den Blick auf den Suchenden richten, entlarven wir die Dualität: ein „Ich“, das etwas will, und ein „Etwas“, das es zu erreichen gilt. Doch wenn der Beobachter selbst beobachtet werden kann, wer bleibt dann?
Empfangen oder enthüllen?
Mooji (Youtube) macht klar: Was wir wirklich suchen, kann nicht empfangen werden, so wie man ein Geschenk erhält. Es kann nur enthüllt werden. Denn das Gesuchte ist bereits da, hinter allen Vorstellungen von Ego, Identität und Besitz. Es ist das reine Bewusstsein – das „Ich bin“, bevor es sich mit Rollen, Geschichten oder Eigenschaften schmückt.
Mooji x Bewusstsein – Die Angst vor dem Verschwinden
An dieser Stelle entsteht Widerstand. Der Suchende klammert sich an seine Identität, auch wenn sie leidvoll ist. Mooji erklärt: Wir fürchten den „Verlust“ unseres persönlichen Selbst, dabei ist es nur ein Arbeitstitel, ein Konstrukt. Was wir wirklich sind, ist viel tiefer und kann nicht vergehen. Hier entsteht zunächst Angst, weil der Verstand das Ende seiner Kontrolle spürt. Doch genau in dieser Hingabe liegt die Freiheit.
Jenseits von Namen und Formen
Mooji lädt dazu ein, sich vom Bedürfnis nach Definition zu lösen. Alles, was wir sagen können – Name, Alter, Beruf, Vergangenheit – ist nicht unser wahres Wesen. Auch Ruhm, Besitz oder Errungenschaften sind nur temporäre Etiketten. Das Selbst aber, das all dies wahrnimmt, entzieht sich jeder Beschreibung. Es ist formlos, zeitlos und unveränderlich.
Die Essenz des „Ich bin“
Bleibt am Ende nur noch die stille Erkenntnis: „Ich bin.“ Nicht „ich bin dieses“ oder „ich bin jenes“, sondern schlicht das reine Dasein. Dieses ursprüngliche Bewusstsein ist die Quelle, in der jede Suche endet. Und gerade weil es nicht erworben, sondern nur erkannt werden kann, spricht Mooji davon, dass das Gesuchte nicht empfangen, sondern enthüllt wird.
Fazit | tl;dr
Der Satsang zeigt eindringlich: Jeder Mensch sucht – doch wir suchen nicht nach etwas Neuem, sondern nach dem, was wir längst sind. Das Selbst kann nicht als Objekt erreicht werden, es kann nur als das erkannt werden, was immer schon da ist. Mooji erinnert uns: Alle äußeren Dinge dürfen geschätzt werden, doch wahre Ruhe finden wir erst in der Offenbarung unseres eigenen Bewusstseins.
Mooji über den Ursprung innerer Ruhe: Bewusstsein ist die Quelle
Benny Sings veröffentlicht neues „Beat Tape III“ – Skizzen, Sessions und Songs voller Leichtigkeit 22 Sep 2:56 AM (29 days ago)

Mit dem Beat Tape III hat Benny Sings nun den dritten Teil seiner Beat Tape-Reihe herausgebracht. Anders als seine regulären Studioalben versteht sich das Tape als lose Sammlung aus Sessions, Jam-Situationen und spontanen Ideen. Es ist weniger ein Konzeptalbum als vielmehr ein musikalisches Skizzenbuch. Dabei erzählt jeder Track seine eigene Geschichte – von Begegnungen, Orten und dem spontanen Zauber des Moments.
Benny Sings x Beat Tape III – Gäste, die Farbe ins Tape bringen
Besonders spannend ist die Gästeliste: Leven Kali glänzt gleich mit dem Vorabtrack „Simple Life“, dessen Video Benny Sings in seinem Amsterdamer Studio selbst drehte. Jacob Jeffries von Vulfpeck brachte seine Energie in eine Session ein, während Kelsey González von den Free Nationals einen Song mit Funk-Vibe veredelte. Auch Mathilda Homer aus London liefert Vocals, die perfekt zu Bennys luftigen Produktionen passen. Diese Features wirken nie als Fremdkörper, sondern erweitern organisch die Vielseitigkeit des Projekts.
„Simple Life“ als passender Auftakt
Mit „Simple Life“ gelingt Benny ein Einstieg, der den Charakter des gesamten Albums widerspiegelt. Der Song ist kein überproduzierter Ohrwurm, sondern eine entspannte Skizze, die dennoch im Ohr bleibt. Kali und Benny lassen die Musik atmen, statt sie zu überfrachten. Diese bewusste Zurückhaltung sorgt für Authentizität und markiert zugleich die Linie, die das Tape verfolgt: eher fühlen als forcieren, eher fließen lassen als fixieren.
Struktur: Kurz, knapp und voller Abwechslung
Das Tape umfasst 22 Tracks mit einer Laufzeit von knapp 31 Minuten. Viele Songs sind kaum länger als anderthalb Minuten, andere entfalten sich etwas breiter. Manche Stücke bleiben instrumentale Skizzen, während andere klassische Songstrukturen mit Hooks oder Refrains annehmen. Dieses Wechselspiel aus unfertiger Rohheit und punktgenauer Ausarbeitung macht den Reiz des Albums aus. Es ist ein bewusst offenes Format, das die Unmittelbarkeit des kreativen Prozesses einfängt.
Beat Tape III – Vom Skizzenblock zum Gesamtbild
Obwohl einzelne Tracks fragmentarisch wirken, fügt sich das Tape zu einem stimmigen Gesamtbild. Benny Sings beweist erneut, dass er ein Meister darin ist, kleine Ideen in ein atmosphärisches Ganzes zu verweben. Statt Perfektionismus dominiert Spontaneität, statt Kalkül die Freude am Moment. Gerade darin liegt die Stärke des Projekts: Beat Tape III (Teil 1, Teil 2) ist kein glattpoliertes Produkt, sondern eine Einladung, Teil des Entstehungsprozesses zu werden.
Fazit: Ein intimer Blick hinter die Kulissen
Mit Beat Tape III (Vinyl) gelingt Benny Sings eine Veröffentlichung, die Fans genauso wie neue Hörer anspricht. Wer seine Stimme, seinen leichtfüßigen Groove und seine warmen Harmonien liebt, wird hier reichlich fündig. Aber das Album funktioniert auch als Einstieg: Es zeigt die Essenz eines Künstlers, der keinen Druck verspürt, Hits abliefern zu müssen. Stattdessen schenkt er Momente voller Echtheit – Musik, die zwischen Studio und Wohnzimmer entstanden ist. Genau das macht den Reiz dieser Platte aus.
Benny Sings – „Beat Tape III“ // Spotify Stream:
Benny Sings – „Beat Tape III“ // Bandcamp Stream:
Funktioniert Manifestieren wirklich? Vera F. Birkenbihl über Glaube, Resonanz und innere Programme 19 Sep 3:22 AM (last month)

Vera F. Birkenbihl, eine der bekanntesten Management-Trainerinnen im deutschsprachigen Raum, verband jahrzehntelange Forschung in Psychologie, Kommunikation und Hirnforschung mit einem unerschütterlichen Humor. In ihrem Vortrag „Funktioniert Manifestieren wirklich? Bestellung beim Universum“ zeigt sie, wie eng unsere Überzeugungen mit unserem Lebensweg verwoben sind. Statt trockener Theorie setzt sie auf Geschichten, Bilder und Übungen, die Kopf und Herz gleichermaßen ansprechen.
Glaubenssätze als unsichtbare Latten
Birkenbihl benutzt das Bild von Latten, die wir im Laufe des Lebens um uns herum aufstellen. Jede Latte steht für eine starre Überzeugung: „Ohne Fleiß kein Preis“ oder „Erfolg muss hart erkämpft werden“. Je mehr solcher Latten wir verteidigen, desto enger wird unser Lebensraum. Wer jedoch den Mut findet, eine Schraube zu lockern, kann den Blick weiten und Alternativen erkennen. Flexibilität im Denken ist für sie der Schlüssel, um nicht in alten Mustern gefangen zu bleiben.
Birkenbihl x Manifestieren – Unbewusstes kontra Bewusstes
Eine zentrale Botschaft von Vera F. Birkenbihl lautet: Das Unbewusste gewinnt fast immer. Wer sich bewusst Reichtum oder Erfolg wünscht, innerlich aber davon überzeugt ist, es nicht zu verdienen, wird unweigerlich am inneren Widerstand scheitern. Diese „Antireichtumsprogramme“ laufen oft unbemerkt und untergraben die besten Vorsätze. Manifestieren bedeutet deshalb weniger, etwas beim Universum zu „bestellen“, sondern vielmehr die eigenen inneren Überzeugungen sichtbar zu machen und zu überprüfen.
Energie folgt der Aufmerksamkeit
Ein weiteres Bild macht Birkenbihl klar: Wo wir Widerstand leisten, fließt unsere Energie hin. Wer gegen Mangel ankämpft, verstärkt den Mangel. Wer Dankbarkeit lebt, verstärkt Fülle. Dieser Gedanke erinnert stark an das Resonanzgesetz: Alles existiert parallel, ähnlich wie Radiokanäle, und wir empfangen stets jenen Sender, auf den wir eingestellt sind. Dankbarkeit, Liebe und Vertrauen wirken wie eine Frequenz, die mehr davon in unser Leben zieht.
Quantenphysik und Unschärfe als Metapher
Spannend ist Birkenbihls Verweis auf die Heisenbergsche Unschärferelation. In der Quantenphysik lässt sich nicht gleichzeitig exakt bestimmen, wo sich ein Teilchen befindet und wie schnell es sich bewegt. Übertragen bedeutet das: Wer immer absolute Sicherheit sucht, blockiert neue Möglichkeiten. Wer dagegen lernt, mit Unsicherheit zu leben, öffnet sich für Inspiration, Zufälle und Synchronizitäten. Manifestation geschieht also dort, wo wir Kontrolle lockern und Vertrauen zulassen.
Birkenbihl x Manifestieren – Ziele und der Fixstern
Birkenbihl unterscheidet zwischen kurzfristigen materiellen Zielen – die sie als „Satelliten“ beschreibt – und dem Fixstern, einem höheren übergeordneten Ziel. Wer nur materielle Wünsche manifestiert, bleibt gefangen in einem endlosen Zyklus von Haben und Brauchen. Wer dagegen einen Fixstern wie Sinn, Freiheit oder Kreativität verfolgt, erlebt automatisch auch materielle Erfüllung, jedoch als Nebenprodukt und nicht als Hauptzweck.
Vom Gehirn-Besitzer zum Gehirn-Benutzer
Ihre berühmte Devise, „vom Gehirn-Besitzer zum Gehirn-Benutzer“ zu werden, zieht sich auch hier durch. Manifestieren bedeutet nicht, blind an Magie zu glauben. Es heißt vielmehr, das eigene Denken aktiv zu steuern, alte Programme zu hinterfragen und neue neuronale Muster zu schaffen. Wer regelmäßig Dankbarkeit, Visualisierung und Selbstreflexion übt, trainiert das Gehirn auf Erfolg und öffnet sich für Chancen, die zuvor unsichtbar waren.
Humor als Lehrmethode
Birkenbihl schafft es, selbst komplexe Konzepte wie Resonanzgesetze oder Quantenphysik humorvoll zu erklären. Mit Geschichten wie der weißen Königin aus „Alice hinter den Spiegeln“ zeigt sie, dass wir „unglaubliche Dinge glauben“ trainieren müssen, wenn wir mehr aus unserem Leben machen wollen. Ihr Stil ist frei von Esoterik, gleichzeitig offen für neue Denkweisen – eine Mischung, die inspiriert und motiviert.
Fazit: Manifestieren als Selbstverantwortung
Manifestieren funktioniert, so Birkenbihl (Insta), nur dann, wenn wir bereit sind, unsere unbewussten Überzeugungen zu prüfen. Es geht nicht darum, Wünsche einfach ins Universum zu schicken, sondern innere Programme zu verändern und neue Resonanzfelder zu öffnen. Dankbarkeit, Vertrauen und ein klarer Fixstern wirken als Wegweiser. In dieser Perspektive ist Manifestieren kein Hokuspokus, sondern eine gehirn-gerechte Strategie für ein erfülltes Leben.
Funktioniert Manifestieren wirklich? Vera F. Birkenbihl über Glaube, Resonanz und innere Programme
Atmosphere feiern 30 Jahre Hip-Hop mit neuem Album „Jestures“ 19 Sep 12:27 AM (last month)

Das aus Minneapolis stammende Duo Atmosphere – bestehend aus Rapper Slug und Produzent Ant – blickt auf eine drei Jahrzehnte währende Karriere zurück. Zum Jubiläum haben sie mit „Jestures“ ein ambitioniertes Album vorgelegt, das sich von Anfang an von der Masse abhebt. Statt sich auf eine kompakte Tracklist zu beschränken, entschieden sie sich für ein Experiment: 26 Songs, geordnet nach den Buchstaben des Alphabets. Jeder Track trägt einen Titel, der mit einem anderen Buchstaben beginnt – von A bis Z. Selbst die Feature-Gäste wie Evidence oder Kurious fügen sich in diese Struktur ein.
Songs mit chirurgischer Präzision
Das Konzept klingt nach Überlänge, doch Atmosphere haben einen Weg gefunden, es schlank zu halten. Viele Songs sind bewusst kurz, fast wie Skizzen, die nur das Wesentliche transportieren. Mit chirurgischer Präzision verdichtet Slug seine Texte, während Ant das Soundbett liefert. Die Single „Grateful“ zeigt das Prinzip in Reinform: Dankbarkeit, Resilienz und ein Funken Hoffnung, verpackt in eine kraftvolle, tanzbare Produktion.
Diese Kürze wirkt keineswegs oberflächlich. Vielmehr wird das Alphabet zu einer kreativen Leitplanke, die verhindert, dass sich die Platte in Wiederholungen verliert. Jeder Buchstabe zwingt Atmosphere, neue Perspektiven zu suchen.
Zwischen Erinnerung und Gegenwart
Inhaltlich bleibt „Jestures“ bei den Themen, die Slug und Ant seit jeher auszeichnen: Beziehungen, Vergänglichkeit, Selbstreflexion. Doch anders als frühere Werke blickt das Album weniger nostalgisch zurück. Es romantisiert die Vergangenheit nicht, sondern betrachtet sie nüchtern, manchmal mit Ironie, oft mit Wärme.
Stücke wie „Baby“ erzählen von zerbrechlichen Bindungen, während „Caddy“ Tagträume von alten Autos aufgreift. „Neptune“ wechselt in cineastische Dimensionen, baut ganze Fantasiewelten auf. Der rote Faden ist immer die Suche nach Bedeutung im Alltäglichen – und der Versuch, in jeder Geste ein Stück Poesie zu erkennen.
Ants Klangarchitektur
Anthony „Ant“ Davis hat erneut ein Fundament geschaffen, das zwischen Stilen pendelt. Von Electro-Glitch über dronige Dunkelheit bis zu twangigen Gitarren reicht sein Spektrum. „Effortless“ mit Evidence spielt fast mit Dream-Pop-Elementen, während „Instrument“ seine experimentelle Seite zeigt. Trotz der Vielfalt wirkt das Album nicht zerfasert. Im Gegenteil: „Jestures“ liest sich wie ein langer, zusammenhängender Gedankenstrom.
Drei Jahrzehnte Atmosphere
Atmosphere haben Hip-Hop nie als bloße Pose verstanden, sondern als Möglichkeit, das echte Leben zu reflektieren. Schon lange bevor „Emo Rap“ ein Genre-Tag wurde, haben sie Songs über Schmerz, Liebe und Alltag veröffentlicht. Ihre Diskografie umfasst Top-10-Alben, über eine Milliarde Streams und unzählige Auftritte auf großen Bühnen. Slug nennt sie augenzwinkernd „The Cadillac of DadRap“ – eine Bezeichnung, die Reife und Selbstironie vereint.
„Jestures“ ist deshalb nicht nur ein Album, sondern ein Statement: Auch nach 30 Jahren bleibt das Duo relevant, weil es sich weiterentwickelt, ohne die eigene DNA zu verlieren. Der Blick nach vorne ist ebenso wichtig wie das Feiern des Erreichten.
Fazit | tl;dr
„Jestures“ ist ein mutiges Konzeptalbum, das zeigt, wie ausdauernd Atmosphere ihr Handwerk beherrschen. 26 Songs voller Vielfalt, Detailtreue und ehrlicher Emotion ergeben ein Werk, das wie ein Reisetagebuch durch drei Jahrzehnte Erfahrung wirkt. Es ist nicht nur ein Jubiläum, sondern auch ein Versprechen, dass ihre Reise weitergeht – vielleicht noch einmal dreißig Jahre.
Atmosphere – „Jestures“ // Spotify Stream:
Atmosphere – „Jestures“ // apple Music Stream:
Tara Swart: Bewusstsein und Intuition als Schlüssel zur verborgenen Sprache der Zeichen 18 Sep 5:15 AM (last month)

Wenn harte Wissenschaft und tiefe persönliche Erfahrungen aufeinandertreffen, entsteht oft ein spannendes Spannungsfeld. Genau darin bewegt sich Dr. Tara Swart, Neurowissenschaftlerin, Oxford-ausgebildete Psychiaterin und Bestsellerautorin. In ihrem Gespräch mit dem Know Thyself-Podcast öffnet sie einen Raum, in dem persönliche Trauer, wissenschaftliche Forschung und spirituelle Erkenntnis ein Ganzes ergeben. Ihr neues Buch „Signs“ widmet sich den unsichtbaren Verbindungen zwischen Zeichen, Synchronizität und dem Mysterium des Bewusstseins. Tara Swart spricht im Video-Podcast über Bewusstsein und Intuition als Schlüssel zur verborgenen Sprache der Zeichen.
Trauer als Tor zu neuen Realitäten
Der Ausgangspunkt ihrer Reise war zutiefst persönlich: der Verlust ihres Ehemanns Robin durch Leukämie. Für Swart stellte sich unmittelbar die Frage, ob es eine Form der Kommunikation über den Tod hinaus geben könnte. Erste „Zeichen“ erlebte sie in Form von wiederkehrenden Begegnungen mit Rotkehlchen – ein Detail, das nicht nur durch den Namen ihres Mannes besondere Bedeutung bekam. Diese Erfahrungen ließen sie neu über das Wesen von Bewusstsein nachdenken. War es reiner Zufall? Oder Ausdruck einer tieferen Wirklichkeit, die über das Materielle hinausweist?
Tara Swart x Bewusstsein und Intuition – Jenseits der fünf Sinne
Die klassische Vorstellung vom Menschen mit fünf Sinnen greift nach Swart viel zu kurz. Ihre Recherchen führten sie zu 34 bisher beschriebenen Sinnen – darunter Propriozeption (das Körperbewusstsein im Raum), Chronozeption (die Wahrnehmung von Zeit) oder Introzeption (die Empfindung innerer Körperzustände). Auch Gerüche spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie sind direkt mit Gedächtnis und Emotionen verknüpft und können sogar frühe Hinweise auf Krankheiten liefern.
Diese erweiterte Sensorik öffnet den Blick für das, was Menschen oft als Intuition oder „sechsten Sinn“ beschreiben. Swart argumentiert, dass wir ungenutzte Fähigkeiten in uns tragen, die wir bislang weder bewusst trainieren noch systematisch erforschen.
Zeichen, Synchronizität und Bedeutung
Ein zentrales Thema in Swarts Buch ist die Unterscheidung zwischen bloßem Zufall und einem „echten“ Zeichen. Sie erzählt von wiederkehrenden Zahlenfolgen, Begegnungen mit Symbolen wie dem Phönix oder unerwarteten Momenten, die sich zu genau richtigem Zeitpunkt ereigneten. Carl Jung beschrieb Synchronizität einst als bedeutungsvolle Koinzidenz – ein Konzept, das Swart in ihre Forschung einbindet.
Doch sie bleibt nüchtern: Auch wenn Zeichen subjektiv sind, liegt ihr Wert in der Bedeutung, die wir ihnen zuschreiben. Selbst wenn eine Erklärung rational möglich ist, kann das Erlebnis selbst tiefen Trost, Orientierung und neue Perspektiven schenken.
Die Wissenschaft des Unsichtbaren
Swart öffnet die Diskussion für alternative Modelle des Bewusstseins. Während die materialistische Sicht davon ausgeht, dass Gedanken und Gefühle ausschließlich aus neuronalen Prozessen entstehen, deutet der Dualismus auf eine mögliche Trennung von Geist und Körper hin. Sie verweist auf Forscher wie Donald Hoffman, der sagt, dass Bewusstsein selbst die Grundlage des Universums ist, und David Eagleman, der das Gehirn als eine Art Empfänger für äußere Signale versteht. Diese Ideen sind wissenschaftlich nicht beweisbar, aber auch nicht widerlegbar – und genau hier setzt Swarts Einladung zum offenen Denken an.
Heilung durch Körper, Natur und Kunst
Neben der intellektuellen Auseinandersetzung geht es Swart um praktische Wege, um Intuition und Selbstheilung zu stärken. Sie verweist auf somatische Methoden wie Yoga, Tanz oder Atemarbeit, die helfen können, im Körper gespeicherte Traumata zu lösen. Auch ästhetische Erfahrungen spielen eine zentrale Rolle: Kunst, Natur und Musik aktivieren nachweislich neurobiologische Prozesse, die Wohlbefinden und Resilienz fördern. Für Swart selbst wurde der Besuch im Ballett zu einem Moment, der ihr zeigte, dass das Leben trotz aller Trauer wieder Sinn und Schönheit bereithält.
Tara Swart x Intuition – Zwischen Wissenschaft und Mystik
Dr. Tara Swart verkörpert eine seltene Brückenfunktion: Sie spricht die Sprache der modernen Neurowissenschaft, ohne die Bedeutung subjektiver und spiritueller Erfahrungen kleinzureden. Statt endgültige Antworten zu liefern, lädt sie dazu ein, die eigene Wahrnehmung zu schärfen und offener für das Unsichtbare zu werden. Zeichen, Synchronizität und Intuition erscheinen so nicht als Ersatz für wissenschaftliches Denken, sondern als Erweiterung unserer Möglichkeiten, Wirklichkeit zu begreifen.
Die verborgene Sprache der Zeichen – Dr. Tara Swart über Synchronizität und Bewusstsein
El Jazzy Chavo dropt neues Beat-Projekt „The Art Of Dusty Sounds Vol. 3“ 18 Sep 2:06 AM (last month)

El Jazzy Chavo, Produzent mit tiefem Respekt für die Tradition des Boom Bap und den warmen Sound alter Jazzplatten, legt mit The Art Of Dusty Sounds Vol. 3 erneut nach. Dieses Instrumentalalbum ist keine bloße Sammlung von Beats, sondern eine Hommage an die Wurzel – daran, wie Musik klingt, wenn sie in verrauchten Studios entsteht, zwischen Staub und Vinyl.
El Jazzy Chavo Vol Dusty Sounds Vol 3 – Crate-Digging und Analoger Zauber
Schon beim ersten Track fühlt man sich in eine Zeit versetzt, in der man stundenlang durch Plattenläden stöbert – nackte Schultern, klebrige Böden, das Rascheln von Kartonhüllen: das Crate Digging. El Jazzy Chavo versteht es meisterhaft, diese Atmosphäre einzufangen. Warme Wax-Chops geben dem Album einen analogen Wohlklang, der zu selten geworden scheint. Jeder Sample, jedes Jazz-Element wirkt sorgfältig ausgewählt, nicht bloß als Füllmaterial, sondern als Teil eines Ganzen, das atmet und lebt.
Soulful Jazz trifft Boom-Bap Rhythmik
Ein Markenzeichen dieser Reihe ist die unverkennbare Verbindung von Soul und Jazz mit rohen, groovenden Drums. Der Swing der Bläser, das sanfte Piano, das gelegentliche Rhodes – das alles eingebettet in Drum Breaks, die knarzen, rumpeln und gleichzeitig zum Head-Nod einladen. Vol. 3 bleibt dem bewährten Konzept treu, es gibt keine Vokale, keine Features – lediglich der Beat in seiner reinsten Form.
El Jazzy Chavo Vol x Dusty Sounds Vol 3 – Atmosphäre, Nostalgie, Handwerk
Mehr als nur Beats: The Art Of Dusty Sounds Vol. 3 ist eine Meditation über Atmosphäre und Nostalgie. Man hört, wie der Producer sich an späten Nächten erinnert, an Mono-Lautsprecher, die laut gestellt werden, und an kreative Ruhe – wenn die Welt draußen schläft und im Studio jeder Schnitt zählt. Chavos Handwerk zeigt sich in kleinen Details: dem knackigen Snare-Schlag, dem leisen Rauschen zwischen den Samples, den Pausen, in denen nichts geschieht – bis genau dort wieder etwas beginnt.
Warum dieses Projekt wichtig ist
In Zeiten, in denen Produktion oft poliert und digital ist, hebt sich Vol. 3 durch seine Ehrlichkeit ab. Es fordert den Hörer auf, langsamer zu machen, genauer zuzuhören – nach dem Knirschen, dem Punch, dem Groove im unteren Frequenzbereich. El Jazzy Chavo erinnert daran, dass Hip-Hop nicht nur Rap ist: dass Beats, Atmosphäre und das Zwischenspiel von Klang und Raum Teil eines kulturellen Erbes sind.
Fazit | tl;dr
The Art Of Dusty Sounds Vol. 3 (Vol 1) ist mehr als ein weiterer Beat-Release. Es ist eine Einladung – zu einem nächtlichen Spaziergang durch die Klanggeschichte des Hip-Hop, zu einem Moment, in dem man den Bass spürt und gleichzeitig den Staub auf der Nadel hört. El Jazzy Chavo beweist erneut, dass er nicht nur Produzent ist, sondern Geschichtenerzähler – mit Samples, Drums und Tiefgang. Wer sich für Beats interessiert, die mit Herz und Seele gemacht sind, wird hier fündig. Ein Album nicht nur für den Kopfhörer, sondern für das Studio, die Seele und den Moment.
El Jazzy Chavo – „The Art Of Dusty Sounds Vol. 3“ // Bandcamp Stream:
The Art of Dusty Sound vol. 3 von El Jazzy Chavo
El Jazzy Chavo – „The Art Of Dusty Sounds Vol. 3“ // Bandcamp Stream:
Ein Traum im Dschungel – Die „Full Jungle Cabin“ in Costa Rica 17 Sep 4:51 AM (last month)

Manchmal beginnt ein Abenteuer mit einer verrückten Idee. Vor zwei Jahren kaufte der Bauherr ein Grundstück an der Süd-Pazifikküste Costa Ricas. Sein Ziel: ein eigenes Haus, gebaut von Grund auf, mit den eigenen Händen. Drei Monate und eine halbe Woche später stand sie – eine moderne Ein-Zimmer-Cabin mitten im Regenwald. Das Video hier unten dokumentiert diesen Prozess in verdichteter Form und zeigt, wie aus nackter Erde ein Rückzugsort zwischen Urwald und Ozean wird. Ein Traum im Dschungel, hier ist der Bau und eine geführte Tour durch die „Full Jungle Cabin“ in Costa Rica.
Full Jungle Cabin in Costa Rica – Fundament und Vorbereitung
Bevor der erste Balken stand, musste das Land vorbereitet werden. Zunächst wurde die Fläche gerodet, eine kleine Bodega aus Bambus und Metall errichtet, um Baumaterialien wettergeschützt zu lagern. Danach begann die eigentliche Arbeit am Fundament: neun Pfahllöcher, jeweils einen Meter tief, gefüllt mit Schotter, Bewehrungsstahl und Beton. Parallel wurden Wasser- und Stromleitungen verlegt. Allein die Stromzuleitung erforderte einen über 180 Meter langen Graben. Auch der septische Tank fand früh seinen Platz – solide Grundlagen für ein Haus, das Wind, Wetter und Termiten trotzen muss.



Rahmen, Dach und äußere Hülle
Mit dem Beton getrocknet, entstand das Grundgerüst: ein Metallrahmen aus 4×4 Stahlprofilen, darauf Querverstrebungen und Bodenbalken. Bald folgte die Dachkonstruktion – Sparren, Pfetten, isolierende Schichten und schließlich das Wellblechdach. Ein entscheidender Moment, denn ab diesem Zeitpunkt konnte unter Schatten gearbeitet werden. Die Wände erhielten eine vertikale Holzverkleidung, die dem Bau Höhe und Eleganz verleiht. Zugleich wurde eine zweite Isolationslage eingebaut, um die Hitze des Daches in Schach zu halten.
Full Jungle Cabin in Costa Rica – Innenraum und Feinarbeit
Der Innenausbau machte aus dem Rohbau langsam ein Zuhause. Trockenbauwände und eine abgehängte Decke im Bad, dazu aufwendig verputzte Wände, teils in dunklen Tönen, teils in helleren Sandfarben – jede Fläche erhielt ihren eigenen Charakter. Beim Boden entschied man sich für eine aufwändige Lösung mit Mikro-Zement, der eigens importiert wurde. Nach einigen Fehlversuchen gelang eine gleichmäßige Oberfläche, die den gesamten Raum trägt. Parallel wurden die Holzdecken eingezogen und die Elektroinstallationen abgeschlossen. So entstand Stück für Stück eine Atmosphäre, die modern wirkt, aber im Rhythmus der Natur bleibt.



Terrasse, Treppe und Glasfronten
Zum Herzstück wurde das große Deck mit Blick auf den Pazifik. Auch hier wieder die Kombination aus Metallrahmen und druckbehandeltem Kiefernholz. Eine schlichte Treppe führte ins Loft, ergänzt durch eine simple Metallbrüstung. Das Bad erhielt Glaswände, die Fenster und Türen wurden eingebaut – spektakulär vor allem die großen Falttüren im Erdgeschoss, die sich komplett öffnen lassen und Innen- und Außenraum ineinander übergehen lassen. Auf der Hangseite entstand zudem ein kleiner Anbau für Lager und Waschraum. Mit jedem Detail wuchs das Gefühl, dass dies mehr ist als nur eine Hütte: ein bewusst geplanter Rückzugsort.
Full Jungle Cabin in Costa Rica – Leben im Dschungel
Der vielleicht wichtigste Moment kam, bevor alles fertig war. Noch ohne Türen, Fenster oder Bad zog der Bauherr ein. Schlafen im halbfertigen Haus, begleitet von Brüllaffen, Tukans und dem Sonnenuntergang über dem Meer – ein Erlebnis, das Motivation und Stolz brachte. Denn dieser Ort war nicht gekauft, sondern selbst erschaffen. Mit Hilfe seines Teams – José, Félix und Pablo – entstand ein Projekt, das weit mehr ist als Architektur. Es ist ein Statement darüber, was Zielstrebigkeit, Handarbeit und Mut bewirken können.



Vermietung über Airbnb
Die Cabin steht inzwischen Reisenden offen (knapp 170€/Nacht). Hoch über Uvita gelegen, mit ungestörtem Blick auf den berühmten „Whale’s Tail“ und inmitten dichter Natur, bietet sie Platz für zwei Erwachsene. Ausgestattet mit Loft-Bett, kompletter Küche, Klimaanlage, Wifi und Glasfronten, ist sie ein modernes Refugium im Dschungel. Wer hier einzieht, wacht mit den Geräuschen des Regenwaldes auf und schläft ein, während der Pazifik in der Ferne glüht. Ein Ort für Paare, Ruhesuchende oder alle, die Verbindung zu Natur und Stille suchen – und zugleich stilvolles Design schätzen.
Fazit | tl;dr
„Full Jungle Cabin“ ist mehr als ein Bauprojekt. Es ist der Beweis, dass Vision und Handarbeit Träume realisieren können. Vom ersten Spatenstich bis zur fertigen Terrasse erzählt dieses Video eine Geschichte von Mut, Ausdauer und Kreativität. Wer es sieht, versteht: Architektur kann nicht nur Räume schaffen, sondern auch Lebenswege verändern. Und manchmal reicht eine Idee, um den Dschungel zum Zuhause zu machen.
Ein Traum im Dschungel – Die „Full Jungle Cabin“ in Costa Rica
Tour durch die „Full Jungle Cabin“ Dschungelhütte:
INCredible COFFEE: SOUL, R&B, NEW HIPHOP – DJ RILLs Vinyl-Session aus Koenji 17 Sep 1:50 AM (last month)

Incredible Coffee x DJ Rill servieren wieder Tokio-Magie: MUSIC LOUNGE STRUT, später Abend, Nadel auf Rille, Raum voller Wärme. DJ RILL kuratiert einen fließenden, organischen Set, der entspannt beginnt und souverän trägt. Und natürlich: Vinyl only! Das hört man am seidigen Höhenbild, am luftigen Mittenband und am runden Low-End, das ohne Druck niemals flach wirkt. Der rote Faden ist ein fantastischer Geschmack, der Jahrzehnte verbindet und dennoch gegenwärtig bleibt. Es wirkt, als hätte DJ Rill in meiner persönlichen Plattensammlung gediggt und die Fundstücke zu einer stimmigen Erzählung sortiert. Die Atmosphäre trifft die Balance aus gemütlich und fokussiert, genau diese Lavender Matcha Latte Vibes, die man nach einem langen Tag sucht.
INCredible COFFEE x DJ Rill – Dramaturgie statt Playlist
Dieser neue INCredible COFFEE Mix denkt in Szenen, Übergängen und Spannungsbögen. DJ RILL lässt Basslinien atmen, während Rhodes, Streicher und dezente Percussion den Raum weiterschieben. Nichts ruckelt, nichts drängt, stattdessen greifen Tempi und Tonarten so ineinander, dass die Energie stetig rollt. Nostalgie wird nicht zur Reminiszenz-Schau, sondern zur tragenden Farbe, weil klassische Harmonien mit modernen Drum-Texturen verschmelzen. Dadurch funktioniert der Set leise beim Schreiben wie laut beim Kochen. Auch nach einer Stunde wirkt er fokussiert, weil die Dynamik in Wellen kommt, aber niemals abreißt. So entsteht die Sorte Mixtape, die man am nächsten Tag erneut startet, ohne an einzelnen Highlights zu hängen.
Ein Einstieg voller Soul, klassischem R&B und einem Hauch 90s-Nostalgie
Der Auftakt verankert den Groove im R&B-Grund und lässt Bobby Browns „Roni“ federnd rollen, bevor Peabo Bryson & Roberta Flack mit „Born To Love“ die Soul-Romantik aufblühen lassen. Ein jazziger Moment über Herbie Hancocks „Tonight’s the Night“ öffnet die Bühne, während Disco-Soul und Philly-Eleganz die Temperatur gekonnt steuern. Helles Tageslicht bricht mit Maroon 5s „Sunday Morning“ herein, und Groove Theory bringt mit „Tell Me“ den vertrauten 90s-Schimmer ins Spiel. So entsteht ein warmes Warm-Up, das den Körper in Bewegung hält und zugleich die Haptik der Pressungen spüren lässt.
INCredible COFFEE x DJ Rill – Von modernem Hip-Hop über Boom-Bap-Energie
Im zweiten Akt zieht die Gegenwart ein, Curren$y & Harry Fraud liefern mit „The Venture Cup“ die Westküsten-Nonchalance, während Nym Lo & Statik Selektah mit „A Kid from the Town“ den New-York-Grip setzen. AZs „Never Enough“ mit Rick Ross veredelt den Mittelteil, bevor Apollo Brown die staubige Boom-Bap-Kante schärft. Bun B & Statik Selektah bringen mit „Concrete“ wuchtigen Druck, und am Ende sorgen J.Lamottas „Fire“ oder Seafood Sams „Pearly Gates Playlist“ für sanfte Soul-Signaturen. Das Finale leuchtet neonweich aus und hinterlässt den Eindruck, dass hier alles an seinem Platz ist – ein Nachhall, der bleibt, wenn die Nadel längst ruht.
Kleiner Tipp: So hörst du es richtig
Einfach im Hintergrund auf dem Fernseher laufen lassen und den Sound auf das Soundsystem werfen, wichtig: ein Subwoofer darf nicht fehlen. Erst dann öffnet sich das Low-End, Kicks bekommen Körper, und das Panorama gewinnt Tiefe. Pegel moderat halten, den Sub leicht anheben, die Höhen frei atmen lassen. So bleibt die Gelassenheit des Arrangements erhalten, während die Energie spürbar im Raum steht. Koenji, ohne Jetlag.
Fazit | tl;dr
Dieser Set ist eine lehrbuchreife Demonstration für stilsicheres Kuratieren. DJ RILL verwebt Soul, R&B und neuen Hip-Hop zu einem ruhigen, aber entschlossenen Erzählbogen, der weder anbiedert noch belehrt. Analoge Wärme trifft kluge Dramaturgie, sodass man zwischen Erinnerung und Jetztzeit hin- und hergleitet. Wer nach einem Mix sucht, der wachsen darf, findet bei INCredible COFFEE (Youtube) seinen Abendbegleiter.
INCredible COFFEE: SOUL, R&B, NEW HIPHOP – DJ RILLs Vinyl-Session aus Koenji
Jan Marsalek: Vom Drahtzieher der Wirecard-Pleite zum Spion in Moskau 16 Sep 5:37 AM (last month)

Jan Marsalek, früher Top-Manager bei Wirecard und heute einer der meistgesuchten Männer Europas, ist offenbar tiefer in russische Geheimdienstaktivitäten verstrickt als bislang bekannt. Neue Recherchen stützen die These, dass er nicht nur lebt, sondern arbeitet – und zwar in Moskau. Chats, Überwachungskameras, Telefondaten und weitere Quellen lassen ein klares Bild entstehen: Marsalek führt ein Doppelleben, das ihn vom Finanzbetrüger zum Agenten gemacht hat.
Jan Marsalek x Moskau – Neue Identität, neue Pässe, neue Spuren
Ein zentraler Befund: Marsalek nutzt inzwischen neue Identitäten und Pässe, die nicht nur geschönt oder verfälscht sind, sondern offenbar offiziell ausgestellt wurden. In bisherigen Recherchen etwa wurde nachgewiesen, dass er sich unter dem Namen Konstantin Bayasow eines russischen Priesters bediente – mit einem echten Passdokument, in dem sein Bild steckt, nicht das des Priesters.
Aus Quellen geht hervor, dass er mehrere Identitäten benutzt und über die Jahre verschiedene Staatsausweise, unter anderem österreichische und diplomatische Pässe, sowie gefälschte Dokumente verwendet hat.
Wo befindet er sich – und was macht er?
Obwohl Marsalek seit 2020 offiziell untergetaucht ist, deuten neue Erkenntnisse stark darauf hin, dass er sich dauerhaft in Moskau aufhält. Mehrere Datenquellen, darunter Telefondaten und Bewegungsprofile, deuten auf regelmäßig wiederkehrende Aufenthalte bei russischen Geheimdienstzentralen hin. In der Spiegel-Recherche heißt es, dass sein Handy sich häufig in der Nähe der FSB-Zentrale in Moskau einloggt.
Zudem zeigen Auswertungen, dass Marsalek offenbar einen geregelten Tagesablauf verfolgt: Anzugtragen tagsüber, Termine oder Aufenthalte an speziellen Orten, abends häufig unterwegs, Gegenwart in Hotels im Luxussegment. Auch chirurgische Eingriffe, etwa Haartransplantationen, sind dokumentiert – wahrscheinlich, um sein Aussehen zu verändern.
Spionageverbindungen und gefährliche Aufträge
Die Vorwürfe sind schwerwiegend: Marsalek soll ein Agentennetzwerk geführt haben, das im Auftrag russischer Geheimdienste gegen Oppositionelle, Journalisten und Regimegegner in Europa aktiv war. Insbesondere britische Ermittlungen haben ergeben, dass ein Spionagering, dessen Hintermann Marsalek sein soll, unter anderem den Investigativjournalisten Christo Grozev und andere aus dem Umfeld russischer Kritik beobachtete.
Dabei sollen laut Anklage auch Entführungs- oder gar Mordpläne Teil der Gespräche gewesen sein. Ein Gericht in London verurteilte drei Mitglieder dieses Netzwerks wegen Spionage und Verbindungen zu Marsalek.
Warum deutscher Strafverfolgung Marsalek entkommt
Mehrere Faktoren erklären bis heute, warum Marsalek nicht gefasst wurde:
- Pässe und Identitäten: Die Nutzung gefälschter oder mehrfacher Identitäten erschwert Fahndungen und Grenzkontrollen.
- Internationale Grenzen der Ermittlungsbefugnis: Datenquellen, Standortinformationen, Telefonnutzungen – viele Aspekte sind nur schwer grenzüberschreitend oder rechtlich mit beschränkten Mitteln nachzuverfolgen.
- Schutz durch russische Institutionen: Indizien deuten darauf hin, dass Marsalek nicht nur inoffizielle Hilfe erhält, sondern dass staatliche Behörden in Russland in seine neue Existenz eingebunden sind.
Fazit: Mehr als ein Schattenmann
Die neuen Recherchen zeichnen das Bild eines Mannes, der sich nicht versteckt, sondern inszeniert – geleitet von ideellen Motiven, realpolitischen Interessen und offenbar in engem Dienst des russischen Geheimdiensts. Jan Marsalek ist längst kein reiner Ex-Manager, sondern wird zunehmend als aktiver Akteur gesehen, der geheimdienstliche Operationen steuert und Auftraggebern mehr liefert als Täuschung und Verschleierung.
Für Deutschland und Europa bedeutet dies: Die Gefahr, dass Marsalek weiterhin Einfluss nimmt – durch Spionage, Einschüchterung oder verdeckte Operationen – ist nicht abstrakt, sondern sehr real. Die Ermittlungsbehörden stehen vor der Herausforderung, mit begrenzten Mitteln einen stark geschützten Akteur zur Rechenschaft zu ziehen.
Jan Marsalek: Vom Drahtzieher der Wirecard-Pleite zum Spion in Moskau
___
[via SpOn, Titelbild = Screenshot aus dem Video]
Vanilla dropt „Time Goes By Pt. II“ // Full Album Stream 16 Sep 1:56 AM (last month)

Vanilla, der britische Beat-Virtuose, liefert mit Time Goes By Pt. II die Fortsetzung seines bereits Anfang des Jahres erschienenen Projekts. Während der erste Teil für Groove und Vielfalt stand, taucht der Nachfolger tiefer in eine reflektierte, atmosphärische Welt ein. Das Album wirkt wie ein Bilderbuch aus warmen Sommerfarben und nostalgischen Momenten, perfekt für späte Autofahrten oder langsame Nachmittage.
Sommerliche Melancholie
Die Tracks bewegen sich zwischen jazzigen Samples, souligen Einwürfen und elektronischer Leichtigkeit. Thank You (Intro) öffnet behutsam die Türen, während Stücke wie Levitate, Brasil oder Remember When Szenen schaffen, die zwischen Sonne und Erinnerung pendeln. Rainbow Pt. II sticht heraus – eine Weiterführung eines vertrauten Themas, diesmal luftiger und noch malerischer. Interludes wie Farewell und Days Gone By geben Struktur und Atempausen, die den Fluss des Albums unterstreichen.
Vanilla – Produktion & Handschrift
Vanilla bleibt seiner Linie treu: warme Samples, subtile Gitarrenriffs, Keys wie glitzerndes Wasser und Drums, die organisch pulsieren. Es sind keine lauten Beats, sondern pulsierende Herzschläge, die durch feine Details an Tiefe gewinnen. Vinyl-Fans werden die Dynamik und das „Analog-Bewusstsein“ des Albums lieben, während Digital-Hörer in die weichen, cinematischen Ebenen abtauchen können.
Mehr als nur Beats
Mit Time Goes By Pt. II vollendet Vanilla ein Doppelalbum, das sich um das Thema Zeit dreht. Erinnerungen, Wandel, Vergänglichkeit – all das wird hier vertont, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird. Wer Pt. I gefeiert hat, wird im zweiten Teil ein reiferes, introspektiveres Gegenstück finden. Für Neueinsteiger öffnet sich ein idealer Zugang zur Welt des britischen Produzenten, der längst zu den Fixpunkten im internationalen Beatkosmos gehört.
Fazit | tl;dr
Vanilla schafft mit Time Goes By Pt. II eine Platte, die sowohl für Sammler als auch für Liebhaber von instrumentellem HipHop unverzichtbar ist. Es ist kein Album, das laut nach Aufmerksamkeit ruft, sondern eines, das durch Ruhe, Detailverliebtheit und emotionale Tiefe überzeugt. Ein musikalisches Werk, das die Zeit nicht nur vertont, sondern auch spürbar macht.
Vanilla – „Time Goes By Pt. II“ // Spotify:
Vanilla – „Time Goes By Pt. II“ // apple Music:
Time Goes By Pt. II von Vanilla
Michael Talbot und die holografische Realität: Wenn das Universum tiefer ist, als wir denken 15 Sep 5:26 AM (last month)

Michael Talbot war kein gewöhnlicher Autor. In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren brachte er Ideen in die Öffentlichkeit, die viele Forscher lieber ignorierten. Sein bekanntestes Werk The Holographic Universe verband Quantenphysik, Neurowissenschaft und spirituelle Konzepte. In einer TV-Sendung erklärte er: Die Welt sei nicht so solide, wie wir glauben. Vielmehr existierten mehrere Ebenen von Realität, die holografisch miteinander verbunden sind. Kurz nach diesen Aussagen starb Talbot unerwartet – und seine Gedanken wurden umso rätselhafter.
Michael Talbot – Realität als Projektion
Talbot nutzte das Bild des Hologramms. Ein Fernseher zeigt ein klares Bild, doch dieses ist nur eine Übersetzung von unsichtbaren Radiowellen. So verhält es sich mit der Wirklichkeit: Was wir sehen, hören und berühren, ist nur eine Manifestation tieferliegender Energiefelder. Auf einer grundlegenden Ebene löst sich alles in ein Meer von Frequenzen auf. Jeder Teil enthält das Ganze, wie ein Hologramm, in dem jedes Fragment das gesamte Bild trägt.
Quantenphysik und Bewusstsein
Die Quantenmechanik hatte längst gezeigt, dass Teilchen nicht unabhängig sind. Das berühmte Doppelspalt-Experiment verdeutlichte, dass der Beobachter die Wirklichkeit beeinflusst. Für Talbot war das kein Randphänomen, sondern ein Hinweis: Bewusstsein formt Materie. Noch deutlicher wird es bei verschränkten Teilchen. Sie reagieren sofort aufeinander, selbst wenn sie Lichtjahre getrennt sind. Talbot übertrug dieses Prinzip auf den Menschen. Geschichten über Zwillinge, die gleichzeitig Schmerz fühlen, waren für ihn Ausdruck derselben Verbundenheit.
Michael Talbot – Gehirn und Wahrnehmung
Auch unser Nervensystem arbeitet, so Talbot, holografisch. Neurowissenschaftliche Befunde zeigten, dass das Gehirn Fourier-Transformationen nutzt – mathematische Prozesse, die auch bei Hologrammen vorkommen. Das bedeutet: Unsere Sinne zerlegen Wirklichkeit in Frequenzen und setzen daraus ein Bild zusammen. Wahrnehmung ist also kein Fenster nach außen, sondern ein kreativer Akt der Rekonstruktion. Realität könnte weit komplexer sein, als wir sie normalerweise wahrnehmen.
Erfahrungen jenseits des Körpers
Talbot selbst schilderte eine außerkörperliche Erfahrung. Er beobachtete sein schlafendes Ich im Bett und entdeckte ein Buch draußen, das er erst später in den Händen eines Nachbarn wiedererkannte. Für ihn war dies der Beweis: Denken und Bewusstsein können unabhängig vom Gehirn existieren. Der Tod sei daher kein Ende, sondern ein Übergang in eine andere Ebene des holografischen Feldes. Nahtoderfahrungen bestätigten dieses Bild. Menschen berichteten von Realitäten, die formbar wie Gedanken waren. Kleidung, Nahrung oder Räume erschienen unmittelbar durch Vorstellungskraft.
Medizin und der Einfluss des Geistes
Besonders provokant war Talbots Deutung des Placebo-Effekts. Ein Patient mit weit fortgeschrittenem Krebs erlebte eine wundersame Heilung, nachdem er an ein neues Medikament glaubte. Als sich herausstellte, dass das Präparat wirkungslos war, kehrte die Krankheit zurück. Talbot sah darin mehr als Psychologie. Das Beispiel zeigte, dass Bewusstsein direkt auf Materie wirken kann. Heilung, so seine These, ist auch eine Frage des Glaubens und der Erwartung.
Schamanismus, Symbole und UFOs
Talbot deutete auch paranormale Erfahrungen neu. Visionen, UFO-Sichtungen oder mystische Begegnungen könnten Ausdruck derselben plastischen Realität sein. Gedanken formen Bilder, die in archetypische Symbole übersetzt werden. Das erklärt, warum verschiedene Kulturen ähnliche Muster beschreiben – Engel, Dämonen oder fremde Wesen. Für Talbot waren das keine bloßen Halluzinationen, sondern der Versuch, tiefere Realitätsebenen zu deuten.
Ein Vermächtnis voller Fragen
Michael Talbot starb jung, doch sein Vermächtnis lebt fort. Er verband Wissenschaft und Spiritualität zu einer kühnen Hypothese: Wir leben in einem holografischen Universum, in dem alles miteinander verbunden ist. Grenzen zwischen Körper und Geist, zwischen Leben und Tod, zwischen Ich und Du sind Illusionen. Seine Botschaft war radikal: Realität ist nicht fest, sondern formbar. Und vielleicht hängt es von uns ab, welche Ebene wir erkennen.
Michael Talbot und die holografische Realität: Wenn das Universum tiefer ist, als wir denken
Rapsody & Madlib – MadRaps: Wenn Flow auf Soul trifft 15 Sep 1:12 AM (last month)

Wenn Rapsody und Madlib ihre Kräfte bündeln, darf man etwas Besonderes erwarten. Genau das passiert mit der neuen EP MadRaps. Das Projekt existierte bereits in limitierter Form auf Vinyl und Kassette, doch jetzt sind die beiden Tracks auch auf den gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Für viele Fans bedeutet das: Endlich Zugang zu einem der spannendsten Team-Ups des Jahres. Madlib liefert die sample-getränkten Beats, die sofort an seine legendären Produktionen erinnern, während Rapsody darauf ihre Stimme erhebt – selbstbewusst, scharf und poetisch zugleich.
Zwei Songs, zwei Welten
Die EP umfasst zwei Tracks, die unterschiedlicher kaum wirken könnten und doch ein gemeinsames Fundament haben. Avon Thru The Wire zeigt Rapsody als Chronistin zwischen Erinnerung, Loyalität und persönlichem Wachstum. Sie verdichtet Trauma und Liebe zu einem Street-Memoir, das in Madlibs dicht gewebten Instrumentals die passende Leinwand findet. Der Beat arbeitet mit Texturen, die man von Madlib kennt: Soul-Samples, verschobene Grooves, detailreiche Cuts. Hier zeigt sich, dass Rapsody nicht nur technisch über jeden Zweifel erhaben ist, sondern auch Geschichten erzählen kann, die weit über das reine Rap-Handwerk hinausgehen.
Rapsody x Madlib – Daddy’s Girl – kompromisslos direkt
Noch intensiver wird es mit Daddy’s Girl. Der Song ist ein Statement, ein Schlag gegen Gatekeeping und die gläsernen Decken der Musikindustrie. Rapsody wählt Worte, die in ihrer Schärfe an Lauryn Hills berühmte Zeilen erinnern, wenn sie sagt, was gesagt werden muss, ohne Umwege, ohne Weichzeichner. Madlibs Beat legt dafür die perfekte Basis: roh, minimalistisch und trotzdem voller Tiefe. Genau hier liegt die Stärke dieses Projekts – die Verbindung aus kompromissloser Lyrik und analoger Wärme.
Zwischen Widerstand und Verwundbarkeit
MadRaps zeigt Rapsody auf ihrem kreativsten Level. Sie kombiniert Verletzlichkeit mit Widerstandskraft, Intimität mit politischer Haltung. Ihre Stimme klingt zugleich persönlich und universell, ein Sprachrohr für Frauen, deren Geschichten im Rap selten gehört werden. Madlib verstärkt diesen Ansatz, indem er seine Beats als Resonanzräume anlegt – nie überladen, immer atmend, immer organisch. Es ist ein Brückenschlag zwischen klassischem Hip-Hop-Feeling und zeitgemäßer Relevanz.
Physische Releases und Street-Campaign
Dass MadRaps ursprünglich nur auf Vinyl und Kassette erhältlich war, passt ins Bild. Dieses Projekt atmet Hip-Hop-Kultur, analog und ungeschönt. Begleitet wurde die Veröffentlichung von einer grassroots Street-Campaign, die die Ursprünge des Genres würdigt. Merchandise, exklusive Drops und limitierte Auflagen sorgen dafür, dass die EP nicht nur gehört, sondern auch gesammelt wird. Trotzdem ist es ein Segen, dass die Songs nun auch digital verfügbar sind – so können mehr Menschen erleben, was dieses Duo geschaffen hat.
Rapsody x Madlib – Ein Vorgeschmack auf Kommendes
Für Rapsody ist MadRaps mehr als eine Fingerübung zwischen zwei größeren Projekten. Es ist ein Übergang zwischen ihrem GRAMMY-prämierten Album Please Don’t Cry und dem, was als Nächstes kommt. Madlib wiederum beweist einmal mehr, dass er nach Jahrzehnten immer noch frische, aufregende Produktionen liefern kann, die Künstlerinnen und Künstlern neue Räume eröffnen. Gemeinsam liefern sie ein Werk, das klein im Umfang, aber groß in seiner Wirkung ist.
Fazit | tl;dr
Mit MadRaps legen Rapsody und Madlib ein kurzes, aber eindrucksvolles Statement vor. Zwei Songs, die zeigen, wie relevant Hip-Hop bleibt, wenn er sich traut, Haltung und Kunst zu verbinden. Ein Projekt, das beweist: Manchmal braucht es nicht mehr als eine starke Stimme und die richtigen Beats, um Eindruck zu hinterlassen.
Rapsody & Madlib – „MadRaps“ // Spotify:
Rapsody & Madlib – „MadRaps“ // apple Music:
Carl Jung und Alan Watts: Die Feinde in uns lieben lernen 12 Sep 5:55 AM (last month)

Wenn Carl Gustav Jung über das Verhältnis des Menschen zu seinem Innersten sprach, dann tat er das mit einer Klarheit, die noch heute herausfordert. In dem von Alan Watts gelesenen Vortrag „Love the Enemy Within“ entfaltet sich eine der zentralen Ideen Jungs: Heilung ist nur möglich, wenn wir uns selbst vollständig akzeptieren – auch unsere dunkelsten Anteile. In dieser Begegnung von Carl Jung und Alan Watts verschmelzen Psychologie und Philosophie zu einer zeitlosen Einladung zur Selbstannahme.
Akzeptanz als Grundlage jeder Heilung
Carl Jung schildert eindringlich, dass ein Patient sich erst dann wirklich verstanden fühlt, wenn auch seine schlimmsten Seiten angenommen werden. Worte allein reichen nicht. Es braucht eine Haltung, die nicht verurteilt, sondern den anderen mit unvoreingenommener Objektivität betrachtet. Ein Arzt, so Jung, könne nur dann helfen, wenn er zuvor seine eigene Schattenseite akzeptiert habe. Dieses Prinzip gilt nicht nur in der Psychotherapie, sondern in allen menschlichen Beziehungen.
Die paradoxe Einfachheit des Selbst
„Akzeptanz seiner selbst ist die Essenz des moralischen Problems“, formuliert Jung. Klingt einfach, ist aber das Schwerste überhaupt. In der Praxis bedeutet es, die eigene Schwäche, den inneren Bettler, den Feind im Herzen nicht zu verdrängen. Jung verknüpft diese Einsicht mit einer religiösen Dimension: Wenn wir die dunklen Gestalten in uns verleugnen, verleugnen wir letztlich auch die Möglichkeit, Gott in unerwarteter Form zu begegnen.
Verurteilung schafft Abhängigkeit
Ein zentraler Gedanke Jungs lautet: „Verdammung befreit nicht, sie unterdrückt.“ Wer verurteilt, wird selbst zum Unterdrücker. Heilung beginnt dort, wo wir lernen, unsere Feinde im Inneren zu erkennen und ihnen mit Mitgefühl zu begegnen. Anstatt zu verdrängen oder nach außen zu projizieren, fordert Jung dazu auf, den Wolf im eigenen Herzen als Bruder zu akzeptieren.
Die religiöse Dimension der Psychologie
Für Jung ist Heilung mehr als nur eine klinische Aufgabe. Er spricht von einem „religiösen Problem“. Die innere Zerrissenheit eines Menschen sei vergleichbar mit einem Bürgerkrieg, der nur durch Versöhnung beendet werden könne. Hier schlägt er eine Brücke zwischen christlicher Nächstenliebe und psychologischer Praxis: Was wir anderen zugestehen sollen – Vergebung, Mitgefühl, Liebe – müssen wir zuerst uns selbst gewähren.
Egoismus als notwendiger Weg
Besonders radikal ist Jungs Sicht auf den Egoismus. Was oberflächlich wie eine Krankheit wirkt, versteht er als Ausdruck des göttlichen Willens. Der Patient müsse darin sogar gestärkt werden, um sich selbst zu erkennen. Dieser Prozess führt oft zur Isolation, aber gerade in der Einsamkeit entdeckt der Mensch den Wert von Mitmenschlichkeit neu. Jung beschreibt das als „antiodromea“, die Umkehr ins Gegenteil, in der scheinbar Böses Gutes hervorbringt und vermeintlich Gutes das Böse nährt.
Der innere Bürgerkrieg und seine Auflösung
Der Weg zur Heilung ist für Jung die Integration der Gegensätze. Erst wenn die verfeindeten Hälften der Persönlichkeit zusammengeführt werden, endet der innere Krieg. Hier zeigt sich Jungs tiefe Überzeugung: Entwicklung geschieht nicht durch Verdrängung, sondern durch bewusste Versöhnung mit dem, was wir ablehnen. Diese Einsicht macht sein Werk bis heute relevant.
Alan Watts als Brückenbauer
Dass gerade Alan Watts diesen Text vorträgt, ist kein Zufall. Watts war ein Meister darin, östliche Weisheit in westliche Sprache zu übersetzen. Indem er Jung liest, schlägt er eine weitere Brücke: Die westliche Psychologie begegnet der Spiritualität, die Watts in seinen Vorträgen so leidenschaftlich vermittelte. Es entsteht ein Dialog, der über Zeit und Disziplinen hinausweist.
Fazit: Die Kunst der Einfachheit
Am Ende bleibt die scheinbar einfache, aber schwer zu lebende Wahrheit: Wir müssen lernen, den Feind in uns zu lieben. Heilung ist kein Kampf gegen das Dunkle, sondern die Anerkennung seiner Existenz. Jung und Watts erinnern uns daran, dass in der tiefsten Akzeptanz nicht Schwäche, sondern Stärke liegt.
Carl Jung und Alan Watts: Die Feinde in uns lieben
___
[via After Skool]
FloFilz veröffentlicht „Hagaki“ – ein musikalisches Postkartenalbum aus Japan 12 Sep 1:09 AM (last month)

FloFilz hat sich in den letzten Jahren als einer der spannendsten Produzenten Deutschlands etabliert. Mit Hagaki, was heute über Melting Pot Music erscheint, setzt er seine Serie von musikalischen Reiseführern fort. Nach Paris, Lissabon und London geht es diesmal nach Japan. Der Albumtitel bedeutet auf Japanisch „Postkarte“ – und genau so wirkt dieses Werk: wie ein Gruß voller Eindrücke, Emotionen und klanglicher Erinnerungen.
FloFilz x Hagaki – Jazz, Beats und japanische Kultur
Das Album verbindet Einflüsse aus Jazz, Soul und Hip-Hop mit japanischen Klangfarben und Atmosphären. FloFilz arbeitete dafür sowohl in Berlin als auch in Tokio und holte sich Unterstützung von hochkarätigen Gästen. Mit dabei sind der gefeierte Trompeter Takuya Kuroda, die Sängerin Nao Yoshioka, Gitarrist Toshiki Soejima, Beatmaker Budamunk und Pianist Matt Wilde. So entsteht ein Mosaik, das klassische Jazzinstrumente, urbane Beats und die Feinfühligkeit japanischer Musik vereint.
Ein Produzent mit Orchestervergangenheit
Dass FloFilz ein klassisch ausgebildeter Violinist ist, hört man seiner Musik an. Seit 2012 produziert er Beats, lange Zeit parallel zu seiner Tätigkeit in Orchestern. Diese Mischung aus Struktur und Freiheit prägt seinen Sound bis heute. Seine Einflüsse reichen von Londons moderner Jazzszene bis zu internationalen Rapgrößen. In der Vergangenheit arbeitete er bereits mit Namen wie Alfa Mist, MF DOOM, Kojey Radical oder JuJu Rogers. Mit Hagaki geht er jedoch einen Schritt weiter, indem er nicht nur eine musikalische, sondern auch eine kulturelle Brücke schlägt.
FloFilz x Hagaki – Japan als Inspiration
FloFilz kennt Japan nicht nur aus der Ferne. Mehrfach tourte er durch Tokio, Osaka und Kyoto, spielte Konzerte, diggte in Plattenläden und entdeckte die Natur außerhalb der Metropolen. Wanderungen durch Wälder und Küstenlinien hinterließen einen tiefen Eindruck. Besonders die japanische Haltung zur Natur, die auf Harmonie und Respekt beruht, spiegelt sich in seiner Arbeit wider. Wie in der Kunst und im Handwerk dort, so geht es auch ihm um Präzision, Hingabe und Sinn für Details.
Die Reise nach Tokio
Für die Aufnahmen reiste FloFilz gemeinsam mit Fotograf Robert Winter und Labelgründer Olski einen Monat nach Tokio. Dort entstand nicht nur die Musik, sondern auch ein visuelles Konzept. Robert Winter, seit Jahren eng mit FloFilz verbunden, schuf erneut eindrucksvolle Bilder, die das Album als Gatefold-Ausgabe mit 20-seitigem Fotobuch begleiten. Fun fact: Mich hat er im Juni 2016 auch mal fotografiert.
In Tokio tauchte das Trio tief in die Szene ein: Jazz-Clubs wie das legendäre Blue Note, Plattenläden, Teehäuser und Tempel wurden besucht. FloFilz trat beim Jazzy Sport x Roland Anniversary Party auf und war bei Ella Records für ein DJ-Set und ein ausführliches Interview zu Gast. Begegnungen mit Künstlern wie Mitsu The Beats, Lidly oder der Jazzy Sport Crew verstärkten die Verbindungen zwischen Berlin und Tokio.
Musiker und Mitwirkende
Die Gästeliste zeigt, wie offen und kollaborativ FloFilz arbeitet. Auf „Taito City Hideout“ glänzt Takuya Kuroda an der Trompete, während Nao Yoshioka „Insomnia“ ihre Stimme leiht. Toshiki Soejima steuert Gitarrenparts bei, Budamunk co-produzierte „Forest Crab“. Matt Wilde brachte seine Keys auf „Atélier“ ein, dazu kam Bass von Greedo. FloFilz selbst übernahm erneut die Violine und prägte so den warmen, akustischen Kern.
Fazit: Eine Postkarte für die Ohren
Hagaki ist mehr als ein weiteres Beat-Album. Es ist eine Einladung, Japan nicht nur zu hören, sondern zu fühlen. Jeder Track wirkt wie ein Ort, den man besucht, jede Melodie wie eine Erinnerung, die man mitnimmt. Der Berliner FloFilz beweist einmal mehr, dass er Brücken bauen kann – zwischen Genres, Kulturen und Kontinenten.
FloFilz – „Hagaki“ // Bandcamp:
FloFilz – „Hagaki“ // Spotify:
Thorens TD 402 DD – Ein Plattenspieler wie eine Lebensentscheidung 11 Sep 6:22 AM (last month)

Es gibt Entscheidungen, die trifft man aus Vernunft und es gibt Entscheidungen, die trifft man aus dem Bauch heraus. Ich war eigentlich zufrieden mit meinem alten Plattenspieler. Er tat seinen Job, die Platten drehten sich, die Musik lief und eigentlich hätte alles so bleiben können. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich nicht nur hören, sondern auch sehen wollte, was mich wirklich begeistert. Etwas Schönes musste her, ein Gerät, das nicht nur funktional ist, sondern bei dem allein schon der Anblick Freude auslöst. Eine Art Nonplusultra in Sachen Retro-Design und analoger Funktionalität. Und wenn man diese Sehnsucht ernst nimmt, führt am Namen Thorens eigentlich kein Weg vorbei.
„Wer einen Thorens hatte, der war Jemand!“
Ich habe lange darüber nachgedacht, warum das so ist. Ein Gespräch mit einem alten Freund hat mir die Antwort gegeben. Er hatte Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger einen Plattenladen in Kiel und er erzählte mir, dass die Leute, die damals einen Thorens besaßen, immer ein wenig herausstachen. Das waren diejenigen, die es irgendwie geschafft hatten, die nicht einfach nur Platten hörten, sondern einen Lebensstil repräsentierten. Thorens war immer mehr als nur ein Gerät – es war ein Statement. Und genau dieses Gefühl war es, das in mir nach all den Jahren wieder aufstieg.



Vinyl als roter Faden meines Lebens
Meine Verbindung zu Musik ist eng, beinahe intim. Mit elf Jahren habe ich angefangen, Platten zu sammeln. Meine erste war „Thriller“ von Michael Jackson – ein Klassiker, der mich in eine Welt katapultierte, in der Klang und Cover-Art noch eine Einheit bildeten. In den Neunzigern kam ich dann nicht drum herum, wie alle anderen auf CDs umzusteigen. Später, als MP3s und Streamingdienste die Oberhand gewannen, habe ich auch diese Formate angenommen, einfach weil es praktisch war. Doch nie verschwand das Gefühl, dass beim digitalen Konsum etwas fehlte.
Im Dezember 2014 änderte sich dann etwas. D’Angelo veröffentlichte nach einer gefühlten Ewigkeit sein Comeback-Album „Black Messiah„. Für mich war sofort klar: Dieses Werk will ich auf Vinyl haben. Nicht als Download, nicht als Stream, sondern in seiner ursprünglichen, greifbaren Form. Also kaufte ich die Platte – und war zurück. Seitdem wächst meine Sammlung kontinuierlich, aktuell liegt sie bei 371 Alben, jedes einzelne verbunden mit Erinnerungen, Geschichten, manchmal mit Reisen.
Was haben „Voodoo“ und „Electric Ladyland“ gemeinsam?
Auf den Fotos, die ich vom Thorens gemacht habe, liegen zwei Alben, die diese Leidenschaft perfekt spiegeln: „Voodoo“ von D’Angelo (2000) und „Electric Ladyland“ von Jimi Hendrix (1968). Zwei Klassiker, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, die aber beide in den legendären Electric Lady Studios in New York aufgenommen wurden. Dieses Studio, gegründet von Jimi Hendrix selbst, war von Anfang an ein Ort, an dem Experimente erlaubt und Grenzen bewusst eingerissen wurden. Wer dort aufnahm, suchte nach einem tieferen Ausdruck. Genau das ist es, was mich an diesen Platten so fasziniert – und genau dieses Gefühl wollte ich mit meinem neuen Plattenspieler wiederbeleben.



Design & Haptik – wenn Holz, Metall und Carbon eine Sprache sprechen
Der Thorens TD 402 DD erfüllt genau das, was ich mir erhofft hatte. Schon das Auspacken war ein Erlebnis: die glänzende Walnuss-Oberfläche, das satte Gewicht des Aluminiumtellers, der elegante Carbon-Tonarm, der in seiner Leichtigkeit und Präzision sofort Vertrauen weckt. Das Design ist eine Liebeserklärung an das Mid-Century-Feeling der Siebziger, ohne dabei altmodisch zu wirken. Zwei Drehknöpfe – einer für Start/Stop, einer für die Geschwindigkeit – mehr braucht es nicht – und genau das macht den Charme aus.
Walnussholz ist nicht nur ein Material, sondern ein Lebensgefühl. Es bringt Wärme ins Wohnzimmer, strahlt Natürlichkeit aus und erinnert daran, dass Musik ein Teil des Lebens ist, kein technisches Nebenprodukt. Die Acrylhaube wirkt schützend, ohne den Blick auf das Wesentliche zu versperren. Alles an diesem Gerät schreit nach Ruhe und Bewusstsein – der bewusste Akt, eine Platte aus der Hülle zu ziehen, den Teller in Bewegung zu setzen und die Nadel vorsichtig auf die Rille sinken zu lassen.


Erste Eindrücke – zwischen Technik und Ritual
Natürlich habe ich diesen Moment festgehalten. Das Unpacking-Video, das ich direkt gepostet habe, zeigt, wie aus einem Karton ein Stück Musikgeschichte wird. Und ja, ich hatte diesen kleinen Stolperer mit meinem Sonos-System. Autoplay wollte erst nicht greifen und für einen Augenblick dachte ich, dass das schöne neue Gerät nicht mit meiner modernen Anlage harmonieren würde. Doch die Lösung war fast schon banal: Der Thorens darf nicht im Standby bleiben, sondern muss komplett ausgeschaltet werden. Sobald man ihn dann wieder einschaltet und die Nadel aufsetzt, erkennt Sonos das Signal sofort. Eine Kleinigkeit, die mich daran erinnert hat, dass analoge Technik uns immer wieder zwingt, genauer hinzusehen – und dass das ein Teil ihres Zaubers ist.
Thorens TD 402 DD – Features, die überzeugen
Was mich neben der Optik sofort begeistert hat, ist die Kombination aus klassischem Look und moderner Technik. Der Thorens TD 402 DD ist weit mehr als ein Einsteigergerät. Der laufruhige Direktantrieb sorgt für eine stabile Rotation, Auto-Start und Auto-Stop erleichtern die Bedienung und schonen die Nadel und der abschaltbare Phonovorverstärker erlaubt Flexibilität – direkt in den Verstärker oder optional über einen externen Preamp.
Der Carbon-Tonarm TP 72 minimiert Resonanzen und sieht dabei edel aus, die abnehmbare Headshell macht den Wechsel von Tonabnehmern leicht und das vorinstallierte Audio-Technica AT VM95E ist solide und upgrade-fähig. Acrylhaube und Steckernetzteil sind selbstverständlich im Lieferumfang. Alles wirkt durchdacht, wertig und so, als wolle es nicht nur heute, sondern die nächsten Jahrzehnte begleiten.


Sound & Gefühl – warum Vinyl mehr ist als Klang
Doch all das wäre nichts wert, wenn der Klang nicht überzeugen würde. Und genau hier liefert der TD 402 DD das, was ich mir erträumt habe: Wärme, Tiefe, ein organisches Klangbild, das digitale Formate nie ganz erreichen. Die Bässe haben Substanz, die Höhen glitzern, ohne zu stechen und in der Mitte entsteht eine Fülle, die Räume füllt und Menschen zusammenbringt.
Es gibt kaum etwas Schöneres, als zu beobachten, wie sich der Teller dreht, die Rille langsam gefüllt wird mit Leben und die Nadel sanft einrastet, um das, was Musiker vor Jahrzehnten erschaffen haben, wieder hörbar zu machen. In solchen Momenten wird Musik nicht konsumiert, sondern erlebt. Es ist Präsenz, Meditation, ein kleines Ritual im Alltag.
Mehr als nur ein Gerät – eine Entscheidung fürs Leben
Ich bin überzeugt: Der TD 402 DD wird der letzte Plattenspieler sein, den ich mir jemals kaufen werde. Nicht, weil er unzerstörbar wäre, sondern weil er alles vereint, was ich mir je gewünscht habe. Mehr geht nicht, mehr muss nicht. Er ist Werkzeug und Designobjekt, Erinnerung und Zukunft, Statement und Begleiter.
Thorens hat es geschafft, eine 140-jährige Tradition in ein Gerät zu gießen, das zeitlos wirkt und gleichzeitig modern ist. Für mich ist er nicht nur ein Plattenspieler, sondern ein Symbol: für das, was Musik sein kann, wenn man sie ernst nimmt, für das bewusste Erleben im Hier und Jetzt, für die Verbindung zwischen Natur, Technik und Emotion.

Fazit
Manchmal geht es nicht darum, die praktischste Lösung zu finden, sondern die, die dich jedes Mal lächeln lässt, wenn du sie siehst und benutzt. Der Thorens TD 402 DD ist genau das: ein Stück Musikgeschichte, ein Design-Statement, ein klangliches Erlebnis. Ein Plattenspieler, der nicht nur Platten dreht, sondern Geschichten erzählt – meine, deine, unsere.
Heilung durch Klang: Chantress Seba berührt mit intuitivem Sound-Healing im Einklang mit der Natur 11 Sep 2:02 AM (last month)

In einer Zeit, in der äußere Reize überhandnehmen, erinnern uns Chantress Seba und ihr Partner Finn daran, was wirklich zählt: Einkehr, Herzverbindung, Erdung. Ihr Video „You Are Healing | Soothing Meditation, Reiki & Stress Relief Music“ ist mehr als eine musikalische Performance – es ist eine spirituelle Zeremonie, eingefangen auf einem Steg inmitten kristallklarer Natur.
Musik als heilende Brücke zwischen Himmel und Erde
Die Kulisse wirkt wie aus einer anderen Welt: Vor dem Spiegel eines ruhigen Sees, umrahmt von majestätischen Bergen, sitzt das Paar. Gemini, die Stimme von Chantress Seba (Youtube, 1 Mio Abonnenten), channelt ihre kraftvolle Lichtsprache – eine intuitive, nicht-rationale Klangsprache – während Finn auf der Handpan spielt. Die erdigen Vibrationen des Instruments und Geminis sphärischer Gesang verschmelzen zu einem intuitiven Sound, der wie Balsam auf das Nervensystem wirkt.
Die Stunde vergeht wie ein Atemzug. Statt klassischer Songstruktur erwartet uns ein kontinuierlicher Fluss heilender Frequenzen. Diese Musik ist nicht gemacht zum Konsumieren, sondern zum Spüren, zum Zulassen, zum Loslassen.
Chantress Seba – Live Healing: Die Essenz als EP
Direkt unter dem Video eingebettet findet sich „LIVE HEALING – Live Sessions II“, die aktuelle EP des Duos. Auch hier geht es nicht um klassische Musik im herkömmlichen Sinne, sondern um Energiearbeit durch Klang. Jede Aufnahme ist ein bewusst initiierter Raum für Transformation – sei es in der Yogapraxis, bei einer Reiki-Session, während stiller Meditation oder beim Einschlafen.
Die EP ist mehr als ein musikalischer Release. Sie ist eine Einladung, die eigene Heilungsreise achtsam zu begleiten und durch Klang in Einklang mit sich selbst zu kommen.
Eine Verbindung, die den Zeitgeist übersteigt
Chantress Seba ist Ausdruck gelebter Hingabe. Seit über einem Jahrzehnt gehen Gemini und Finn gemeinsam ihren Weg – von der Großstadt bis zur spirituellen Selbstverwirklichung. Ihre Musik spiegelt diese Metamorphose wider: von entfremdeter Alltagsstruktur hin zur bewussten Verbindung mit allem, was ist.
Geminis Ahnenlinie – afrikanisch, indisch, keltisch – und Finns Wurzeln in Irland und England fließen mit großem Respekt in die Musik ein. Ergänzt wird ihr Wirken durch ihre tiefe Wertschätzung für schamanische Traditionen aus Südamerika. Diese Vielfalt zeigt sich nicht nur in ihrer Performance, sondern auch in der Energie, die sie transportieren: global, kosmisch, vereint.
Chantress Seba – Klang als Kanal für das Göttliche
Geminis Gesang ist kein Gesang im klassischen Sinn. Er ist ein Vehikel für kosmische Botschaften, ein Kanal, durch den Heilfrequenzen ihren Weg finden. Während Finns Handpan die Zuhörer erdet, hebt Gemini sie an – auf eine höhere Ebene des Fühlens und Erinnerns. Es entsteht eine Art Klang-Reiki, das energetische Blockaden lösen und emotionale Prozesse anstoßen kann. Das Video und die begleitende EP erinnern uns daran: Heilung ist kein Ziel, sondern ein Weg. Und dieser Weg darf schön klingen.
Chantress Seba: You Are Healing | Soothing Meditation, Reiki & Stress Relief Music
Chantress Seba – „LIVE HEALING Live Sessions II“ // Spotify:
Meditieren ohne Meditation: Vera F. Birkenbihls verblüffend einfache Methode für mehr Gelassenheit 10 Sep 4:39 AM (last month)

Vera F. Birkenbihl war bekannt dafür, komplexe Themen mit einfachen Metaphern verständlich zu machen. In ihrem Vortrag „Meditieren ohne Meditation – ganz einfache Methode“ erklärt sie, wie wir unseren rastlosen Geist beruhigen können – ganz ohne Räucherstäbchen, Klangschalen oder Lotussitz. Ihre Methode ist so simpel wie effektiv und lässt sich mühelos in den Alltag integrieren.
Der Elefantenrüssel und unser Geist
Birkenbihl beginnt mit einem eindrucksvollen Bild: Der Geist ist wie der Rüssel eines Elefanten – ständig in Bewegung und potenziell gefährlich, wenn er nicht kontrolliert wird. Um auch durch sehr enge Gassen gehen zu können bekommt der Elefant einen Stab in den Rüssel, damit dieser sich beruhigt. Genauso kann ein Mantra – also ein wiederholter Wortklang – unseren Geist besänftigen. Es wird zum mentalen Stab, den wir ihm überreichen, damit er aufhört, wild umherzuschwenken.
Warum wir ständig denken (und wie das aufhört)
Unser innerer Monolog ist das Dauerrauschen unseres Egos. Es hält uns mit Gedanken, Sorgen und Dialogen wach, weil es sich durch Stille bedroht fühlt. Das Ego fürchtet, sich selbst zu verlieren, wenn es schweigt. Deshalb denken wir ununterbrochen – meist unbewusst. Meditation versucht, diesen inneren Dialog zu unterbrechen. Doch viele Menschen scheitern daran, weil sie meinen, sie müssten sich dafür in unbequeme Haltungen zwängen oder regelmäßig Zeit freiräumen.
Meditieren ohne Meditation – Das Mantra als Anker im Alltag
Der Clou ihrer Methode ist jedoch das Mantra/“Mantram“: ein persönlich gewählter Wortklang, der innerlich wiederholt wird – nicht im stillen Kämmerlein, sondern mitten im Alltag. Während man durch den Supermarkt geht, in der Schlange steht oder auf einen Kunden wartet. Diese stille Wiederholung beruhigt den Geist, lenkt die Aufmerksamkeit nach innen und macht uns gelassener – ohne dass wir uns dafür Zeit freischaufeln müssen.
Laut Birkenbihl dauert es etwa vier bis sechs Wochen, bis das Mantram „greift“. Regelmäßiges Üben – nur wenige Minuten täglich – reicht völlig aus. Und plötzlich stehen uns neue Ressourcen zur Verfügung: Ruhe, Klarheit, bessere Schlafqualität und emotionale Ausgeglichenheit.
Flow durch Konzentration im Moment
Birkenbihl betont, dass das bewusste Ausführen alltäglicher Tätigkeiten – wie Geschirrspülen oder Haarewaschen – ein Weg in den „Flow“ sein kann. Der Flow-Zustand entsteht, wenn eine Aufgabe uns leicht überfordert, aber dennoch machbar bleibt. Genau dort, wo wir mit einem Bein außerhalb unserer Komfortzone stehen, entsteht Präsenz. Wer diese Momente bewusst erlebt, trainiert seine Achtsamkeit und wird wacher, kreativer und entspannter.
Meditieren ohne Meditation – Der unsichtbare Schutzschild gegen Alltagsstress
Besonders faszinierend ist, wie Birkenbihl das Mantram als „Blocker“ beschreibt: ein mentaler Schutzschild gegen äußere Reize. In Situationen, die sonst Nervosität, Wut oder Ungeduld auslösen, hilft das stille Wiederholen des Mantras, in der eigenen Mitte zu bleiben. Statt in Stressmustern zu reagieren, bleiben wir zentriert. Und das Beste daran: Es kostet keine zusätzliche Zeit. Wir machen es einfach nebenbei.
Fazit: Meditation ohne Aufwand – und trotzdem mit Wirkung
Was Vera F. Birkenbihl in ihrem Vortrag vermittelt, ist nicht nur praxisnah, sondern auch tiefgreifend. Ihre Methode nimmt der Meditation den Nimbus des Elitären und holt sie in den Alltag zurück. Sie zeigt, dass es nicht immer formelle Rituale braucht, um innere Ruhe zu finden. Ein einfaches Wort, regelmäßig wiederholt, kann ausreichen, um unser mentales Chaos zu ordnen und uns in schwierigen Momenten zu stabilisieren.
Diese Technik ist besonders geeignet für Menschen, die wenig Zeit haben, ungeduldig sind oder mit klassischen Meditationsformen nicht warm werden. Und sie erinnert uns daran, dass wahre Veränderung oft in kleinen, stillen Momenten beginnt.
Meditieren ohne Meditation: Vera F. Birkenbihls verblüffend einfache Methode für mehr Gelassenheit
Chillhop Essentials Fall 2025 – Musik für goldene Gedanken 10 Sep 1:19 AM (last month)

Der Sommer ist Geschichte – und das ist auch gut so. Denn mit dem Einzug des Herbstes beginnt jene Jahreszeit, in der sich die Welt verlangsamt, Farben sich wandeln und Gedanken tiefer kreisen. Die passende Begleitung dafür liefert einmal mehr Chillhop Essentials Fall 2025, die mittlerweile zehnte Herbstausgabe dieser legendären Compilation-Reihe.
Ein neues Kapitel im Chillhop-Universum
Seit 2016 bringt Chillhop Music Jahr für Jahr stimmungsvolle Sammlungen heraus, die den Geist der jeweiligen Saison einfangen. Mit Fall 2025 setzt das Label diesen Weg fort: 28 Tracks von 44 Künstler:innen auf knapp 70 Minuten Spielzeit – das ist mehr als nur Musik. Es ist eine Einladung, sich einzukuscheln, in Erinnerungen zu schwelgen und mit jedem Beat ein wenig näher bei sich selbst anzukommen.
Die Auswahl reicht dabei wie gewohnt von verträumten Lofi-Stücken über jazzige Chillhop-Vibes bis zu klassischen Boom-Bap-Anleihen – alles instrumental, alles sorgfältig kuratiert, alles aus einem Guss.
Chillhop Essentials Fall 2025 – Bekannte Namen und neue Stimmen
Zu den Highlights zählen Beiträge von Szenegrößen wie Sleepy Fish, Ian Ewing, G Mills, Leavv, C Y G N oder J.Folk, die schon in früheren Ausgaben vertreten waren. Auch Birocratic, Ross Mayfield und Kosmicho sind mit „Half-Light“ erneut mit einem besonders vielschichtigen Track dabei – flirrend, groovend, perfekt für regnerische Nachmittage am Fenster.
Aber auch Newcomer und weniger bekannte Namen setzen starke Akzente: Robot Orchestra liefert mit „Auburn Echoes“ ein rhythmisch verspieltes Stück, Gas-Lab & Kristoffer Eikrem überzeugen mit jazzigen Trompeten auf „Otoño“ und chromo, the dreamer trifft mit „Childhood“ einen nostalgischen Nerv, ohne kitschig zu klingen.
Die Stimmung: warm, weich und wehmütig
Diese Herbstausgabe ist musikalisch etwas introspektiver geraten als ihre sommerliche Vorgängerin. Tracks wie „Left Behind“ von C Y G N, „Hanging On“ von No Spirit & Casiio oder „Mid-Night“ von Kreatev & 88JAY bringen Melancholie auf leisen Sohlen und lassen Raum für innere Prozesse.
Die Stücke passen hervorragend zu langen Spaziergängen im raschelnden Laub oder produktiven Stunden mit Laptop und Kerzenlicht. Fall 2025 erinnert daran, wie heilsam es sein kann, einen Gang runterzuschalten – und dabei tief einzutauchen in Klangräume, die mehr sind als bloße Untermalung.
Der Waschbär, der Garten und Jazz der Hase
Auch visuell entwickelt sich die Chillhop-Welt weiter: Unser alter Bekannter, der Chillhop-Waschbär, ist nicht mehr auf einer schwimmenden Sommerinsel unterwegs, sondern hat mit Tukan Mango und dem neuen Freund Jazz dem Hasen einen Garten angelegt. Zwischen Karotten, fallenden Blättern und tiefgründigen Gesprächen entsteht eine neue, entschleunigte Kulisse – ein Symbol für das Ernten, Loslassen und Neuanfangen.
Diese begleitenden Illustrationen sind längst mehr als Dekoration. Sie fügen sich nahtlos in das ganzheitliche Storytelling ein, das Chillhop seit Jahren betreibt. Und sie laden ein, auch jenseits der Musik in eine Welt einzutauchen, die Ruhe, Reflexion und Wärme ausstrahlt.
Fazit: Eine Playlist wie ein Wollpullover
Chillhop Essentials Fall 2025 ist mehr als eine bloße Compilation – es ist ein Statement. Für entschleunigten Genuss. Für klangliche Tiefe. Und für Momente, in denen man sich selbst begegnet. Ob du den Herbst liebst oder eher als Übergang zur dunklen Jahreszeit empfindest – diese Sammlung macht ihn fühlbar, greifbar, lebendig. Sie gibt ihm eine Stimme. Und vielleicht auch ein kleines bisschen Trost.
Chillhop Essentials Fall 2025 // Spotify:
Chillhop Essentials Fall 2025 // Bandcamp:
Chillhop Essentials Fall 2025 von Chillhop Music
Desert Temple: Ein Wüstenhaus, das wie ein Tempel wirkt 9 Sep 5:57 AM (last month)

In La Quinta, Kalifornien, steht ein Wohnhaus, das mehr als Architektur ist. Das „Desert Temple“ wurde von Nomad Design entworfen und von McClure Homes Design Build umgesetzt. Es fügt sich in das Coachella Valley ein, ohne jemals aufdringlich zu wirken. Klare Linien, sanfte Materialien und bewusste Raumfolgen lassen das Haus eher wie einen Ort der Einkehr erscheinen. Schon beim ersten Blick spürt man Zurückhaltung, Respekt und eine tiefe Verbindung zur Landschaft.
Desert Temple – Ein Konzept der Ankunft
Der Weg zum Haus ist kein Nebenschauplatz, sondern Teil des Entwurfs. Fahnenmastbäume und Palmen begleiten die Zufahrt, bis sich der Blick auf die Berge öffnet. Diese gerahmte Perspektive verankert die Achse von der Straße bis zur Eingangstür. Dort hebt das schwebende Dach den Blick gen Himmel und öffnet den Raum zu Licht und Weite. Wer hier ankommt, merkt sofort: Dieses Haus ist kein gewöhnliches Wohnprojekt, sondern ein bewusst gestalteter Zufluchtsort.
Materialwahl mit Bedacht
Im Inneren setzt sich die Philosophie der Ruhe fort. Travertinwände in Sandtönen, silberne Metallelemente und Eichenholz schaffen eine Palette, die sich an der Wüste orientiert. Alles wirkt harmonisch, nichts will dominieren. Sculptform-Latten aus Aluminium und Holz ziehen sich durch Innen- und Außenbereiche. Dadurch verschwimmen Grenzen und erzeugen Kontinuität. Die Räume atmen, entfalten Tiefe und gewinnen eine subtile, fast haptische Textur.



Räume, die sich auffächern
Der zentrale Wohnbereich bildet das Herz des Hauses. Von dort öffnen sich Achsen zu Schlafzimmern, Innenhöfen und Gärten. Dieser Grundriss wirkt wie ein Fächer, der sich in die Landschaft ausbreitet. Gästezimmer liegen rund um Innenhöfe, die zusätzliche Ruhepole schaffen. Ein höhlenartiger Flur führt in die Hauptsuite, die diskret und geschützt liegt. Der Übergang zwischen Innen und Außen ist immer fließend, sodass man das Haus eher als Teil der Natur erlebt.
Desert Temple – Der Pool als Spiegel der Landschaft
Besonders eindrucksvoll ist der Pool, der an der Rückseite kaskadenartig abfällt. Sein Wasser verbindet sich mit einem See, der das Sonnenlicht reflektiert. Es entsteht der Eindruck, als würde das Haus über der Landschaft schweben, ohne sie zu beherrschen. Dieser sensible Umgang mit dem Gelände zeigt, dass hier nicht Monumentalität, sondern Balance im Vordergrund steht. Besucher verweilen, schauen und lassen die Umgebung auf sich wirken.



Familienunternehmen mit Leidenschaft
Das Projekt ist auch eine Familiengeschichte. Andrew McClure, Architekt von Nomad Design, arbeitete eng mit seinem Vater Mark zusammen. Mark McClure gründete McClure Homes Design Build und begleitet jedes Projekt mit Leidenschaft. Er versteht das Handwerk nicht als Pflicht, sondern als Berufung. Diese Haltung prägt die Umsetzung. Liebe zum Detail, Respekt vor dem Klima und handwerkliche Präzision machen das Desert Temple langlebig und robust.
Landschaft als Mitgestalterin
Die Landschaft des Coachella Valley ist nicht bloß Kulisse, sondern aktiver Teil des Entwurfs. Farben, Materialien und Blickachsen wurden so gewählt, dass Gebäude und Natur verschmelzen. Innenhöfe öffnen sich zur Vegetation, Wege rahmen das Panorama, Licht und Schatten verstärken die Dramaturgie. Der Baukörper tritt zurück, damit das Umfeld wirken kann. Diese Zurückhaltung ist der Schlüssel zur spirituellen Qualität des Hauses.


Desert Temple – Emotionen als Maßstab
Für die McClures ist Erfolg messbar an Emotionen. Wenn Kunden das fertige Haus betreten und spürbar ergriffen sind, gilt das Projekt als gelungen. Jeder Raum, jedes Material und jeder Blickwinkel wurde mit dieser Absicht gestaltet. Emotionen führen, nicht reine Funktion oder Spektakel. Dadurch entsteht ein Haus, das alltägliche Rituale bereichert und seine Bewohner zu Momenten der Ruhe einlädt.
Ein Tempel für das Alltägliche
Letztlich verkörpert Desert Temple eine Haltung: Architektur ist nicht bloß Schutz, sondern auch ein emotionaler Anker. Dieses Haus ist ein Tempel, nicht im religiösen Sinn, sondern als Raum für Bewusstsein und Stille. Es zeigt, wie Design zu einem gelebten Erlebnis werden kann. Wer es betritt, spürt sofort: Hier geht es nicht um Größe, sondern um Tiefe.
Desert Temple: Ein Wüstenhaus, das wie ein Tempel wirkt
El Michels Affair – 24 Hr Sports: Eine Ehrenrunde voller Groove und Überraschungen 9 Sep 1:14 AM (last month)

Leon Michels ist längst mehr als nur ein talentierter Produzent im Hintergrund. Mit seinen 43 Jahren hat er nicht nur als Mastermind von El Michels Affair Maßstäbe gesetzt, sondern auch Stars wie Norah Jones oder Clairo zu Grammy-Ehren verholfen. Nach Jahren intensiver Arbeit an Projekten anderer meldet El Michels Affair sich nun mit einem eigenen Werk zurück: „24 Hr Sports“. Ein Album, das auf den ersten Blick verspielt wirkt, aber bei genauerem Hinhören seine ganze Vielschichtigkeit entfaltet.
Von Sportmagazinen und MF DOOM inspiriert
Der Titel wirkt wie der Name eines obskuren TV-Senders, doch tatsächlich steckt dahinter eine klangliche Konzeptidee. El Michels Affair ließ sich von den Sportmagazinen der 80er- und 90er-Jahre inspirieren, inklusive ihrer grafischen Opulenz. Dazu kommen Anleihen aus MF DOOMs legendärer „Special Herbs“-Serie, in der jeder Track nach einem Gewürz benannt war. Entsprechend trägt „24 Hr Sports“ einen losen, mixtapeartigen Charakter. Statt einer durchgehenden Erzählung gleicht das Album einem Zappen durch Genres, Sounds und Atmosphären.
El Michels Affair x 24 Hr Sports – Spielfreude statt Konzeptschwere
Eröffnet wird die Platte von einer pompösen „Drumline“, die direkt an eine Stadion-Marching-Band erinnert. Danach folgen 16 Tracks, die sich wie eine musikalische Ehrenrunde anfühlen: der brasilianische Fußball-Rap von „Mágica“, der ghanaische Funk in „Say Goodbye“ oder das lässige Dub-Experiment „Oakley’s Car Wash“, in dem The-Roots-Trompeter Dave Guy ein charmantes Solo spielt. Diese Vielfalt verleiht dem Album Leichtigkeit, ohne ins Beliebige abzurutschen.
Starke Stimmen, starkes Fundament
Während Michels in früheren Alben wie „Adult Themes“ oder „Yeti Season“ stärker auf instrumentale Tiefe setzte, rücken diesmal die Stimmen in den Vordergrund. Mit Norah Jones und Clairo holt er prominente Weggefährtinnen ins Boot, die den Songs „Carry Me Away“ und „Anticipate“ regelrechte Ohrwurm-Momente schenken. Jones überrascht mit rauen, hohen Tönen, die man so nicht von ihr kennt. Clairo wiederum bringt eine samtige Eleganz ein, die perfekt auf Michels analoge Produktionsweise trifft.
Doch damit nicht genug: Der japanische Psych-Rocker Shintaro Sakamoto verleiht „Indifference“ eine hypnotische Note zwischen Soul und Sprechgesang. Die Fabulous Rainbow Singers reißen mit „Take My Hand“ kurz die Himmelstore auf, während die ghanaische Sängerin Florence Adooni und der brasilianische Musiker Rôge das Album um weitere globale Facetten erweitern.
Balance zwischen Experiment und Pop
Was „24 Hr Sports“ besonders macht, ist die Balance: Michels bleibt seiner Handschrift treu – warme Texturen, analoge Produktion, Groove mit Tiefgang – und öffnet sich gleichzeitig stärker dem Pop-Appeal. Wo frühere Projekte manchmal zu verkopft wirkten, gelingt hier die Mischung aus Zugänglichkeit und Experimentierfreude. Das Album ist bunt, ohne beliebig zu sein, und verspielt, ohne den roten Faden zu verlieren.
El Michels Affair x 24 Hr Sports – Ein sanftes Finale
Ganz dem sportlichen Titel entsprechend endet das Album mit „Victory Lap“. Doch statt triumphal aufzutrumpfen, schließt Michels verträumt und lässig ab. Eine Ehrenrunde, die nicht lautstark gefeiert werden will, sondern wie ein stilles Schulterklopfen klingt. Genau darin liegt die Stärke von „24 Hr Sports“: Es ist keine prahlerische Zurschaustellung, sondern eine selbstbewusste Leistungsschau eines Künstlers, der längst weiß, wo er steht.
Fazit
Mit „24 Hr Sports“ gelingt El Michels Affair ein Album, das gleichermaßen Groove-Fans, Soul-Liebhaberinnen und Experimentierfreudige anspricht. Michels präsentiert sich als Produzent, Arrangeur und Musiker in Bestform, öffnet sein Universum für starke Stimmen und globale Einflüsse – und bleibt dabei jederzeit souverän. Ein Werk, das auf den ersten Blick verspielt wirkt, aber in seiner Tiefe zu den stärksten Veröffentlichungen von El Michels Affair zählt.
El Michels Affair – „24 Hr Sports“ // Spotify:
El Michels Affair – „24 Hr Sports“ // Bandcamp:
24 Hr Sports von El Michels Affair
Lerne zu denken wie der Buddha: Die Kraft des klaren Geistes 8 Sep 4:48 AM (last month)

Ein weit verbreiteter Irrtum lautet, Meditation bedeute, das Denken vollständig zu stoppen. Doch Buddha selbst beschrieb den Beginn seines Weges anders. Er fand ihn, als er lernte, Gedanken zu beobachten, statt sie zu unterdrücken. Entscheidend war die Frage: Welche Gedanken führen zu Leid, welche führen zu Befreiung? Meditation ist daher kein Ausblenden, sondern ein kluges Hinsehen. Denken wird nicht zum Feind, sondern zum Werkzeug, das in die richtige Richtung gelenkt werden will. Lerne zu denken wie der Buddha: Die Kraft des klaren Geistes.
Denken wie der Buddha – Die „Thinking Cure“
In der Psychotherapie spricht man von der „Talking Cure“. Buddha brachte ein verwandtes Prinzip in die Praxis der Meditation: die „Thinking Cure“. Sie bedeutet, das eigene Denken bewusst zu durchleuchten. Viele Glaubenssätze, die uns beherrschen, erweisen sich bei näherer Betrachtung als brüchig. Oft verlieren sie ihre Macht, sobald wir sie klar erkennen. Meditation heißt daher, Gedanken in Licht zu tauchen, ihre verborgenen Voraussetzungen aufzudecken und bewusst auszuwählen, welche wir nähren und welche wir loslassen.
Atem als Schlüssel
Ein zentrales Werkzeug ist die Arbeit mit dem Atem. Dabei geht es nicht darum, Luft zu erzwingen oder Blut zu verschieben. Vielmehr lehrt Buddha, den Atem zuzulassen. Wer den Atem „öffnend“ denkt, statt ihn zu kontrollieren, erfährt eine sanfte Weite im Körper. Entspannung in Gelenken und Muskeln schafft Raum für den natürlichen Fluss. So wird der Atem zum Anker im Hier und Jetzt. Dieses Bild verändert den Blick auf Körper und Geist zugleich: Wir erlauben, statt zu kämpfen.
Neue Konzepte von Selbst und Wandel
Meditation verlangt auch ein neues Selbstbild. Viele Menschen glauben, sie könnten nicht anders handeln als bisher. Doch Buddha betonte: Veränderung ist möglich. Jeder unheilsame Gedanke kann durch einen heilsamen ersetzt werden. Dies erfordert zunächst Vorstellungskraft – die Erlaubnis, sich selbst in einem anderen Licht zu sehen. Großzügigkeit oder Vergebung sind Beispiele: Wer sich als „gebend“ denkt, wird fähig zu geben, unabhängig vom materiellen Besitz. Wer sich als „großherzig“ denkt, kann vergeben und innerlich wachsen.
Die vier Formen des Anhaftens
Buddha unterschied vier Arten von Anhaftung: Sinnlichkeit, Ansichten, Praktiken und Selbstvorstellungen. Sinnliche Begierde kann den Geist fesseln, während Anhaftung an Ansichten oder Rituale zwar Orientierung bietet, aber ebenso verengen kann. Am tiefsten wirkt die Anhaftung an ein starres Selbstbild. Der Weg führt nicht über brutales Abschneiden, sondern über eine bewusste Nutzung dieser Tendenzen. Skillful clinging – geschicktes Festhalten – kann helfen, den Pfad zu gehen. Erst wenn er entfaltet ist, wird auch das Festhalten selbst losgelassen.
Die Rolle des Denkens im Alltag
Im Zentrum steht stets die Frage: „Was ist jetzt der heilsamste Gedanke, das heilsamste Handeln?“ Diese Perspektive befreit vom Grübeln über Vergangenheit oder Zukunft. Statt „Wer bin ich?“ fragt der Übende: „Welche Handlung führt in diesem Moment zu weniger Leiden?“ Dieses pragmatische Denken wird zur täglichen Praxis. Es geht um Experimentieren, Ausprobieren und Lernen – genau so, wie Buddha selbst durch Versuch und Irrtum zum Erwachen gelangte.
Denken wie der Buddha – Disziplin und Flexibilität
Meditation verlangt weder dogmatische Strenge noch naives Vertrauen. Vielmehr ist es ein Spiel aus Disziplin und Anpassung. Manchmal braucht es Konzentration auf den Atem, manchmal Reflexion über Vergänglichkeit oder den Tod. Beides dient dazu, den Geist zurück ins Jetzt zu holen. Entscheidend ist die Fähigkeit, Gedanken als Werkzeuge zu nutzen, nicht als Fesseln.
Freiheit durch kluges Denken
Am Ende ist Befreiung kein Produkt von Zwang, sondern von Einsicht. Ajaan Fuang brachte es auf den Punkt: Nirwana lässt sich nicht erzwingen. Es entsteht, wenn das Denken geschickte Formen annimmt, wenn Anhaftungen erkannt und schließlich losgelassen werden. Der Weg beginnt damit, Denken nicht als Hindernis, sondern als Heilmittel zu sehen. Wer lernt, wie Buddha zu denken, erfährt den klaren Geist, der Leiden wandeln kann – nicht durch Verdrängung, sondern durch kluge Beobachtung und bewusste Wahl.
Lerne zu denken wie der Buddha: Die Kraft des klaren Geistes
Statik Selektah x Wais P x The Musalini – „Choose or Lose“: Boom Bap bleibt unsterblich 8 Sep 2:33 AM (last month)

Statik Selektah hat es erneut geschafft, ein Projekt auf die Beine zu stellen, das Tradition und Gegenwart mühelos miteinander verbindet. Mit der EP Choose or Lose vereint Statik Selektah die beiden New Yorker MCs The Musalini und Wais P und liefert damit eine Platte, die kompromisslos auf Boom Bap setzt, ohne nostalgisch zu wirken. Der Bostoner Veteran bleibt seinem Ruf treu, denn er versteht es seit Jahren, Lyricists den passenden Unterbau zu geben.
Zwei MCs mit eigener Handschrift
The Musalini, seit geraumer Zeit bei Jamla Records aktiv und zuletzt mit Pure Izm 2 am Start, bringt eine Mischung aus Charme, Straßenwissen und smoothen Flows. Wais P, erfahrener Veteran mit Projekten wie dem Khrysis-geprägten Hocaine, liefert die raue, direkte Note. Gemeinsam bilden sie ein Duo, das sich hervorragend ergänzt: Musalini steht für Eleganz, Wais P für Grit und Straßenrealität. Schon ihr Feature auf einem Planet Asia-Track ließ ahnen, dass eine gemeinsame Platte früher oder später kommen musste.
Statik Selektah x Choose Or Lose – Der Auftakt: Blues und Orchester
Die EP startet mit Can a Player Live?. Hier treffen bluesige Samples auf dichte Drums, während die beiden MCs vom unaufhaltsamen Vorwärtskommen erzählen. Der Track vermittelt sofort die Richtung: klassisch im Sound, aber selbstbewusst und frisch in der Attitüde. Mit Return of the Mack folgt ein orchestraler, staubiger Beat, auf dem beide Rapper aus der Perspektive von Pimps erzählen – ein Thema, das bei beiden Künstlern seit jeher Teil des Images ist.
Minimalismus trifft Eleganz
How to Knocka reduziert das Soundbild auf Basement-Vibes und lässt den Lyrics Raum, während Live in the Flesh wieder eine glattere, fast seidige Oberfläche anbietet. Der Kontrast zwischen Rohheit und Eleganz zieht sich wie ein roter Faden durch die Platte. Die MCs spielen bewusst mit Gegensätzen und zeigen, dass sie sowohl ungeschönt als auch sophisticated klingen können.
Zweite Hälfte: Härte und Experimente
Die B-Seite beginnt mit 4 Real, einem klassischen Boom-Bap-Brett, das die Skills der beiden MCs klar in den Vordergrund rückt. Mit Cashmere Coast schlägt Statik dann eine leicht futuristische Richtung ein: Synthesizer sorgen für einen glossierenden Anstrich, ohne die Wucht zu verlieren. Hier zeigt sich, dass Statik Selektah zwar tief im klassischen Hip-Hop verwurzelt ist, aber auch Raum für Experimente lässt.
Statik Selektah x Choose Or Lose – Orgelsound und Finale
Mit Sake Bombs kommt eine weitere Ebene hinzu: Orgelklänge, fast kirchenartig, untermalen die Message, dass beide MCs ihren Status längst gefestigt haben. Zum Abschluss bietet Pimpin’ Saved einen letzten Höhepunkt. Der Song spielt mit warnenden Untertönen und deutet an, dass Musalinis nächstes Soloalbum möglicherweise für noch mehr Aufsehen sorgen wird.
Fazit: Ein Statement für New York
Choose or Lose ist mehr als nur eine Kollabo-EP. Es ist ein Statement für das, was New York-Rap 2025 bedeuten kann: rau, elegant, lyrisch stark und getragen von einem Produzenten, der sein Handwerk meisterhaft versteht. Statik Selektah beweist einmal mehr, dass Boom Bap nicht in den Neunzigerjahren gefangen bleibt, sondern auch heute als lebendiges Fundament dienen kann. The Musalini und Wais P wiederum zeigen, dass sie trotz unterschiedlicher Ansätze perfekt harmonieren und ihre Stärken gegenseitig verstärken. Für Fans von Rap mit Haltung, Tiefgang und Style ist dieses Projekt ein Pflicht-Release.
Statik Selektah x Wais P x The Musalini – „Choose or Lose“ // Spotify:
Statik Selektah x Wais P x The Musalini – „Choose or Lose“ // apple Music:
Theater oder Realität? Alan Watts über die größte Illusion des Lebens 5 Sep 7:23 AM (last month)

Alan Watts, der britische Philosoph und Meister der östlichen Weisheitslehren, verstand es wie kaum ein anderer, komplexe spirituelle Ideen greifbar zu machen. In einem seiner bekanntesten Vorträge erklärt er, dass unser Leben nichts anderes ist als ein großes Theaterstück. Wir sind Schauspieler, die ihre Rolle so gut spielen, dass sie vergessen haben, dass es überhaupt eine Rolle ist. Genau hier beginnt für Alan Watts die größte Illusion des Lebens.
Das Leben als Bühne
Alan Watts greift das Bild des Theaters auf. Das Publikum weiß, dass es sich um eine Inszenierung handelt, dennoch lässt es sich berühren. Ein großartiger Schauspieler ist in der Lage, uns weinen, lachen oder zittern zu lassen, obwohl wir rational wissen, dass es nicht „echt“ ist. Genauso, so Watts, verhält es sich mit unserem eigenen Dasein.
Wir treten auf die Bühne des Lebens, verkleiden uns mit Identitäten, Berufen, Rollen und Geschichten. Wir vergessen dabei, dass hinter der Maske etwas Tieferes existiert: das eigentliche Selbst. Doch wir sind so überzeugend in unserem Spiel, dass wir uns selbst täuschen.
Die Maske des „Ichs“
Das Wort „Person“ stammt vom lateinischen „persona“ – die Maske des Schauspielers. Ursprünglich bedeutete es „durch den Klang hindurch“, weil die Maske die Stimme verstärkte. Heute verwenden wir „Person“ als Synonym für unsere Identität. Doch Watts erinnert uns: Das „Ich“, das wir im Alltag verteidigen, ist nur eine Rolle.
Die Illusion besteht darin, die Maske mit der Wahrheit zu verwechseln. Wir halten uns für den Anwalt, den Angestellten, die Mutter, den Lehrer, den Reisenden – und übersehen, dass diese Rollen nur temporäre Verkleidungen sind.
Gut und Böse – das Spiel der Gegensätze
Jedes Drama lebt von Konflikten. Es braucht Helden und Schurken, Ordnung und Chaos. Ohne Spannung gäbe es keine Geschichte. Watts deutet dies als Hinweis auf den Sinn des Lebens: Wir brauchen die Gegensätze, um überhaupt ein Spiel zu haben.
Wäre alles nur gut, gäbe es keine Bewegung. Wäre alles im Gleichgewicht, wäre es langweilig. Erst wenn es so aussieht, als würde das Gute verlieren, entfaltet sich Spannung. Am Ende aber, wie auf der Theaterbühne, treten Held und Bösewicht gemeinsam vor den Vorhang – und beide werden beklatscht.
Alan Watts x Illusion des Lebens – Der „Hintergedanke“
Watts verweist auf eine feine Ahnung, die viele Menschen kennen: den „Hintergedanken“. Tief in uns gibt es die vage Vermutung, dass wir mehr sind als das kleine „Ich“, das wir im Alltag verkörpern. Dieser Gedanke ist schwer greifbar, weil er die Illusion bedroht. Aber er erinnert uns daran, dass hinter der Bühne noch etwas anderes existiert – das eigentliche Selbst.
Hinduistische Leela – das göttliche Spiel
In der hinduistischen Philosophie wird die Welt als „Leela“ beschrieben: das göttliche Spiel. Das Universum ist keine ernste Prüfung, sondern ein Tanz des Göttlichen mit sich selbst. Das Göttliche spielt Rollen – manchmal als Mensch, manchmal als Tier, manchmal als Gott – und verliert sich bewusst in diesem Spiel.
Ein Christ mag sagen: „Ich bin ich, getrennt von Gott.“ Der Hindu jedoch meint: „Ich bin Atman, das Selbst – und identisch mit Brahman, der Quelle allen Seins.“ Für Watts sind beide Perspektiven Teil des Spiels. Selbst wenn jemand zutiefst an die Trennung glaubt, ist das immer noch eine großartige Rolle im kosmischen Theater.
Alan Watts – Die größte Illusion
Die größte Illusion im Leben ist also die Überzeugung, wir seien nichts weiter als die Rolle, die wir gerade spielen. Wir glauben, wir seien nur ein kleines Wesen, ausgeliefert an Schicksal und Zufall. In Wahrheit aber sind wir der Schauspieler hinter der Maske – das göttliche Bewusstsein selbst, das sein eigenes Spiel so gut spielt, dass es sich dabei vergisst.
Fazit | tl;dr
Alan Watts lädt uns ein, die Masken zu durchschauen. Nicht, um sie abzulegen, sondern um das Spiel bewusster zu genießen. Wenn wir erkennen, dass wir mehr sind als unsere Rollen, können wir mit Leichtigkeit durch die Dramen des Lebens gehen. Wir spielen weiter, aber wir wissen nun, dass wir Schauspieler in einem göttlichen Theater sind – und genau darin liegt die Freiheit.
Theater oder Realität? Alan Watts über die größte Illusion des Lebens
Samy Deluxe & Conductor Williams – Ein Spätsommer in zehn Akten 5 Sep 2:47 AM (last month)
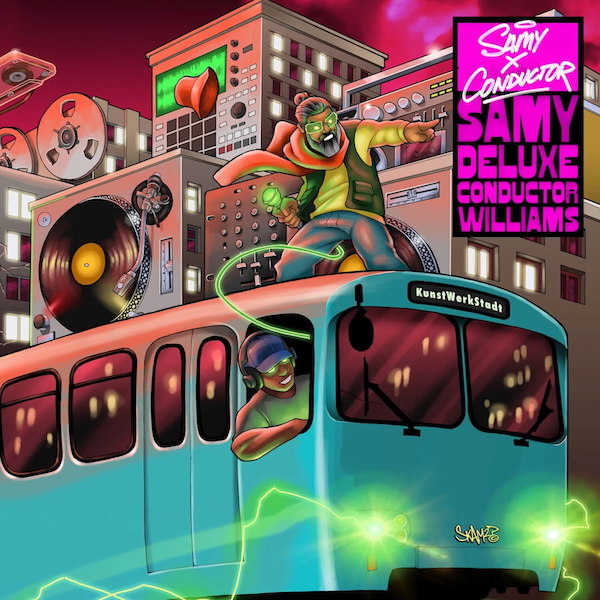
Samy Deluxe hat in über 30 Jahren jede erdenkliche Form von Rap-Alben veröffentlicht. Ob Konzeptwerke, Kollabo-Projekte oder Soloplatten – er hat sein Repertoire mehrfach neu erfunden. Doch „Samy x Conductor“ ist etwas anderes. Hier ging es nicht um Labelstrukturen oder Businesspläne. Es begann mit direkten Nachrichten auf Instagram, einem respektvollen Austausch zwischen zwei Artists und der Lust, etwas Neues zu schaffen. Herausgekommen ist ein zehn Tracks starkes Album, das mehr als nur ein weiteres Kapitel im Samy-Katalog ist. Samy Deluxe & Conductor Williams – Ein Spätsommer in zehn Akten.
Conductor Williams – der Produzent mit globalem Gewicht
Conductor Williams bringt internationales Gewicht in das Projekt. Er hat für Größen wie Drake, J. Cole, Tyler, The Creator und Griselda produziert. Sein Sound ist roh, samplelastig und zugleich modern – mit viel Raum für Vocals, ohne dabei dünn zu wirken. Genau dieser Ansatz passt zu Samy Deluxe, der seine Stimme und seine Reimtechnik hier maximal ausspielen kann. Statt überladener Features gibt es Konzentration auf die Essenz: Beats, Bars und Balance.
Sparring mit sich selbst
In der offiziellen Ankündigung war die Rede von Samys „Sparring mit sich selbst“. Wer das Album hört, versteht sofort, was gemeint ist. Über gut 30 Minuten und rund 4000 Wörter zeigt er ein Lyrikfeuerwerk, das kaum Platz für Pausen lässt. Fünf Songs haben sogar eine dritte Strophe – ein Luxus, den man in Zeiten von zweiminütigen Streaming-Hits kaum noch erlebt. Jeder Track ist vollgepackt mit dichten Reimen, komplexen Flows und pointierten Beobachtungen.
Samy Deluxe x Conductor Williams – „Damn Conductor“ als Auftakt
Die Single „Damn Conductor“ markierte den Startschuss. Direkt, bissig und kompromisslos klingt der Song wie ein Statement: Hier treffen ein deutscher Ausnahmerapper und ein US-Produzent auf Augenhöhe zusammen. Kein Versuch, Trends hinterherzulaufen, sondern ein selbstbewusstes Festhalten an der Essenz von Rap. Das dazugehörige Video verstärkte diesen Eindruck noch – rough, urban und ohne Schnörkel.
HipHop pur – von Vinyl bis Kassette
Neben Streaming und digitalen Formaten erscheint „Samy x Conductor“ auch in besonderen physischen Versionen. Vinyl und sogar Kassetten betonen den Anspruch, echten HipHop greifbar zu machen. Es ist eine bewusste Entscheidung gegen reine Algorithmus-Strategien und für Sammler, die Musik nicht nur hören, sondern besitzen wollen. So bleibt das Projekt mehr als eine flüchtige Playlist-Ergänzung – es wird zum Stück Kultur.
Samy Deluxe x Conductor Williams – Zeitgeist und Gegenentwurf
Der Zeitpunkt des Releases ist nicht zufällig. Rap blickt derzeit wieder stärker auf Handwerk und Skills. Auto-Tune-Hits mögen die Charts bestimmen, aber es gibt eine wachsende Sehnsucht nach Substanz. „Samy x Conductor“ bedient genau dieses Bedürfnis. Das Album verlängert die Leichtigkeit des Sommers, liefert aber gleichzeitig Texte mit Gewicht. Ein Gegenentwurf zu belangloser Schnellkost, der sich bewusst Zeit nimmt, auch mal mehr als zwei Strophen in einen Song zu packen.
Fazit – ein Album für Rap-Liebhaber
„Samy x Conductor“ ist kein Versuch, das Rad neu zu erfinden. Es ist die bewusste Entscheidung, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Samy Deluxe zeigt, dass er nach Jahrzehnten immer noch hungrig ist, während Conductor Williams Beats liefert, die internationalen Anspruch mit Oldschool-Energie verbinden. Zusammen erschaffen sie ein Werk, das Spätsommer-Vibes transportiert und gleichzeitig als starkes Statement für handwerklichen Rap funktioniert.
Samy Deluxe & Conductor Williams – „Samy x Conductor“ // Spotify:
Samy Deluxe & Conductor Williams – „Samy x Conductor“ // apple Music:
Edit: Samy & Conductor im Interview bei Aria Nejati
Peter Thiel: Der Schattenmann hinter Trump, Musk und Vance 4 Sep 6:35 AM (last month)

Peter Thiel ist kein Politiker, kein Minister und auch kein Gouverneur. Dennoch gehört er zu den einflussreichsten Figuren der US-amerikanischen Gegenwart. Geboren 1967 in Frankfurt am Main, wanderte er mit seinen Eltern früh in die USA aus. Heute ist er Milliardär, Tech-Investor und Strippenzieher im Hintergrund. Während Namen wie Henry Kissinger oder Jawed Karim vielen geläufig sind, wirkt Thiel fast unsichtbar. Doch sein Einfluss reicht weit über Silicon Valley hinaus – bis ins Weiße Haus.
Peter Thiel – Vom Schachbrett ins Silicon Valley
Seine Jugend war geprägt von Außenseitertum und intellektuellen Ambitionen. Im Schach zählte er zeitweise zu den besten Jugendlichen Amerikas. Später studierte er Philosophie und Jura in Stanford, wo ihn der Literaturwissenschaftler René Girard stark prägte. Früh entwickelte Thiel eine Abneigung gegen liberale Tendenzen und gründete das „Stanford Review“ als konservatives Sprachrohr. Nach dem Studium wagte er den Sprung ins Business. Gemeinsam mit Partnern gründete er Confinity, das später mit Elon Musks X.com zu PayPal verschmolz. Der eBay-Deal machte ihn reich – und gab ihm die Mittel für eine beispiellose Investorenkarriere.
Aufstieg zum Tech-Mäzen
Thiel erkannte früh das Potenzial von Facebook und stieg 2004 als erster externer Investor mit 500.000 US-Dollar ein. Acht Jahre später verkaufte er einen Großteil seiner Anteile für rund 400 Millionen Dollar. Mit diesem Kapital finanzierte er nicht nur Start-ups wie Airbnb und SpaceX, sondern baute sein eigenes Imperium auf. Besonders wichtig: die Gründung von Palantir. Die Datenanalysefirma arbeitet eng mit Geheimdiensten, Militärs und Polizeibehörden zusammen – auch in Deutschland. Kritiker warnen vor Massenüberwachung, Befürworter sehen ein Werkzeug für Sicherheit. Fest steht: Palantir ist ein Machtinstrument, das Thiel enormen Einfluss sichert.
Libertarische Visionen und Machtansprüche
Philosophisch folgt Thiel einer radikalen Linie. Wettbewerb sei „etwas für Verlierer“, sagte er einmal. Sein Ziel: Monopole und Kontrolle. Politisch denkt er ähnlich. Demokratie betrachtet er skeptisch, Machtkonzentration hält er für effizienter. Inspiriert von Girards Theorie, dass Gewalt aus Ähnlichkeiten entsteht, fordert Thiel radikale Innovation statt bloßer Kopie. Zudem sieht er globale Institutionen als Bedrohung individueller Freiheit und interpretiert internationale Zusammenarbeit als apokalyptisches Szenario. Seine Haltung ist libertär, konservativ und autoritär – ein Mix, der ihn in die Nähe rechter Bewegungen bringt.
Peter Thiel – Politische Allianzen: Trump und Vance
2016 unterstützte Thiel Donald Trump finanziell und personell im Wahlkampf. Danach wurde er Berater im Weißen Haus. Noch entscheidender ist sein Engagement für J.D. Vance. Der heutige US-Vizepräsident arbeitete zuvor in Thiels Risikokapitalfirma. Mit Millionenspenden ebnete Thiel seinen politischen Aufstieg. Insider sprechen von einer Vater-Sohn-Dynamik, die Vance eng an Thiel bindet. Damit investiert Thiel gezielt in die Zukunft der US-Politik. Sein Ziel: eine konservative Agenda, die seine wirtschaftlichen und ideologischen Vorstellungen stützt.
Macht durch Netzwerke
Obwohl Thiels Vermögen mit rund 24 Milliarden Dollar deutlich kleiner ist als das von Musk oder Bezos, ist sein Einfluss nicht zu unterschätzen. Er bewegt sich geschickt zwischen Tech-Szene und Politik, baut Netzwerke auf und sucht Allianzen. Auch in Europa pflegt er Kontakte, zuletzt beim MCC-Feszt in Ungarn, einem rechten Netzwerktreffen mit Gästen wie AfD-Chefin Alice Weidel. So wird klar: Thiel agiert global, nicht lokal. Seine Unterstützung verschafft rechten Bewegungen Ressourcen, Aufmerksamkeit und Legitimität.
Der umstrittene Visionär
Thiel inszeniert sich als Vordenker, doch sein Handeln offenbart Widersprüche. Einerseits verteidigt er Meinungsfreiheit, andererseits unterstützte er juristische Kampagnen gegen Medien, die ihn outeten. Einerseits ist er selbst Einwanderer, andererseits finanziert er Politiker mit restriktiver Migrationspolitik. Diese Doppelmoral nährt Kritik, Thiel sei antidemokratisch und rechtsextrem geprägt. Er selbst weist diese Vorwürfe zurück, doch die politischen Konsequenzen seiner Aktivitäten sprechen eine deutliche Sprache.
Zwischen Tech und Politik
Peter Thiel ist kein Präsident, kein Gouverneur, kein offizieller Repräsentant. Und doch zieht er Fäden, die über Wahlausgänge und globale Sicherheitsstrategien entscheiden können. Während Elon Musk die Schlagzeilen dominiert, agiert Thiel leiser, aber nachhaltiger. Sein Einfluss auf Palantir, sein Netzwerk in Washington und seine politischen Investments zeigen: Er ist einer der mächtigsten Männer unserer Zeit. Vielleicht nicht so sichtbar wie Trump – aber in vielerlei Hinsicht ebenso wirksam.
Peter Thiel: Der Schattenmann hinter Trump, Musk und Vance
Edit – Auch interessant: Die Peter Thiel Story (Podcast)
Deutschlandfunk Podcast: Die Peter Thiel Story (Spotify)
Destin Conrad überrascht mit Jazz-Album „wHIMSY“ 4 Sep 1:51 AM (last month)
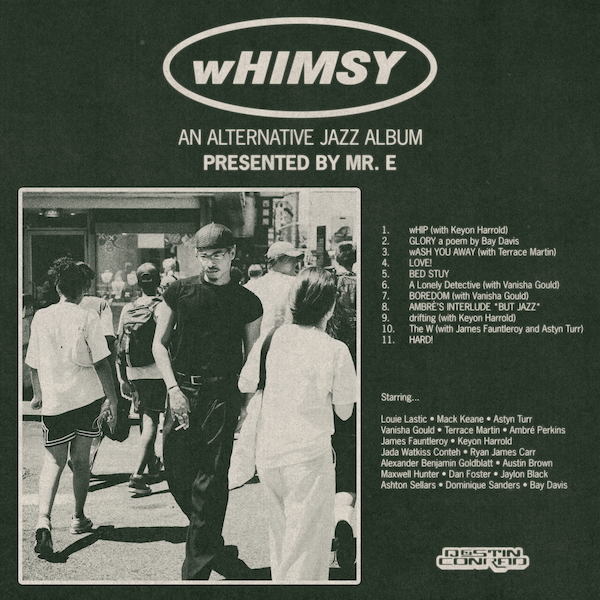
Destin Conrad, bislang vor allem als aufstrebende Stimme des modernen R&B bekannt, überrascht mit einer mutigen Kursänderung. Sein neues Album „wHIMSY“ ist ein klares Statement: Jazz ist kein Relikt vergangener Tage, sondern ein Raum, in dem sich Gegenwart, Emotion und Freiheit neu verbinden. Veröffentlicht wurde das Werk über EMPIRE, und schon jetzt zeigt sich, dass Conrad hier nicht einfach Genres mischt, sondern seine eigene musikalische Sprache weiterentwickelt.
Von der Jazz-Chorzeit zum großen Experiment
Für Destin Conrad ist „wHIMSY“ mehr als nur ein Nebenprojekt. Schon während seiner Highschool-Zeit war er Mitglied eines Jazz-Chors. Jetzt, Jahre später, greift er diese Wurzeln auf und bringt sie in einen neuen Kontext. Er beschreibt das Album selbst als „off the cuff, free idea“ – also als spontanes, leidenschaftliches Projekt, das immer in ihm schlummerte. Dabei bleibt er seiner Leichtigkeit treu, während er gleichzeitig tief in die Tradition des Jazz eintaucht.
Destin Conrad x wHIMSY – Hochkarätige Unterstützung
Das Album lebt nicht allein von Conrads Stimme, sondern auch von einer Riege namhafter Kollaborationen. Terrace Martin bringt seine Erfahrung als Produzent ein, James Fauntleroy fügt feine Harmonien hinzu, während Trompeter Keyon Harrold und Sängerin Vanisha Gould die klangliche Palette erweitern. Auch Ambré, Louie Lastic, Mack Keane, Austin Brown und Astyn Turr hinterlassen deutliche Spuren. Diese Vielseitigkeit verleiht „wHIMSY“ einen breiten Klangraum, der zwischen Intimität und Experiment wechselt.
Ein Album zum Durchhören
„wHIMSY“ umfasst elf Stücke, die besonders in ihrer Gesamtheit wirken. Conrad baut eine Atmosphäre auf, die Zuhörer sanft hineinzieht und sie Stück für Stück tiefer in seine Welt führt. Titel wie „drifting“ oder „A Lonely Detective“ schaffen filmische Stimmungen, die sich mit Leichtigkeit und geheimnisvoller Spannung abwechseln. Besonders hervorzuheben ist „wASH U AWAY“, ein Song, der vor Intimität glüht und das Motiv der bleibenden Erinnerung in sinnlichen Bildern entfaltet. „I left your crib this morning and I smell you on my neck“, singt Conrad – eine Zeile, die seine poetische Seite betont.
Destin Conrad x wHIMSY – Zwischen Digitalität und Nostalgie
Bemerkenswert ist auch der zeitliche Abstand zu Conrads Debüt „Love on Digital“, das erst im April erschien. Während dort die digitale Ära des R&B gefeiert wurde – inspiriert von den frühen 2000ern und ihren neuartigen Produktionsweisen – schlägt „wHIMSY“ eine fast gegenteilige Richtung ein. Statt Software-Sounds dominiert hier das Handgemachte, Organische. So gelingt es Conrad, zwei völlig unterschiedliche Kapitel seiner Kreativität in kurzer Zeit zu öffnen.
Ausblick: Bühne und Zukunft
Schon im September startet Conrad seine „Love on Digital“-Tour in den USA. Gemeinsam mit Mack Keane wird er bis November durch Nordamerika reisen. Anschließend folgt im Dezember die europäische Etappe mit Cari als Special Guest. Ob und wie „wHIMSY“ dort ebenfalls eine Rolle spielt, bleibt offen – doch es wäre kaum überraschend, wenn Conrad die neue Jazz-Ausrichtung auch live integriert. Denn genau darin liegt seine Stärke: ständige Weiterentwicklung, ohne die emotionale Authentizität zu verlieren.
Fazit | tl;dr
Mit „wHIMSY“ gelingt Destin Conrad ein mutiges Statement. Er beweist, dass ein Künstler nicht auf ein Genre festgelegt bleiben muss, sondern durch Offenheit wachsen kann. Zwischen Nostalgie, Sinnlichkeit und Improvisation entsteht ein Album, das zugleich persönlich und universell wirkt. Conrad hat den Jazz nicht neu erfunden, aber er hat ihn für sich neu definiert – und damit ein Werk geschaffen, das seinen Namen weiter festigt.
Destin Conrad – „wHIMSY“ // Spotify:
Destin Conrad – „wHIMSY“ // apple Music:
Zwischen Identität und Illusion: Der Schlaf, den du Leben nennst 3 Sep 6:21 AM (last month)

Das Video „Zwischen Identität und Illusion: Der Schlaf, den du Leben nennst“ führt uns an einen unbequemen Punkt: Was, wenn unser Leben weniger Realität und mehr Traum ist? Viele Menschen bewegen sich wie Schlafwandler durch Routinen, überzeugt davon, frei zu handeln, obwohl sie unbewusst Programme abspulen. Diese Mechanik, inspiriert von Gurdjieff, Advaita Vedanta und Zen-Buddhismus, zeigt sich in alltäglichen Mustern – von der morgendlichen Kaffeetasse bis zu wiederkehrenden Streitgesprächen. Alles wirkt gewählt, ist jedoch oft nur ein Abbild früher Konditionierung.
Maschinen im Autopilot
Gurdjieffs radikale Aussage „Menschen sind Maschinen“ bildet die Grundlage des Essays. Gemeint ist, dass wir fast ausschließlich automatisch funktionieren und nur selten echte Bewusstseinsmomente erleben. Wir reagieren auf Trigger, wie ein Reflex beim Arzt, ohne bewusste Wahl. Unser Ego stützt diese Täuschung, indem es Muster als Persönlichkeit tarnt. Wir verteidigen Identitäten, die bloß Wiederholungen sind, und verwechseln sie mit Authentizität.
Gefangenschaft im Selbstbild
Die Illusion ist so vollständig, dass Emotionen zur totalen Identifikation führen: Wut fühlt sich wie das eigene Wesen an, Angst wie eine absolute Wahrheit. Doch die vermeintliche Steuerung ist ein Lenkrad ohne Verbindung. Wir sitzen in einem Auto, das längst von unsichtbaren Kräften gelenkt wird. Unsere Gedanken kreisen wie ein defekter Plattenspieler, endlos wiederholend. Jede Werbung, jede Serie, jedes soziale Medium verstärkt diese Hypnose, programmiert neue Muster und bindet uns tiefer an die Ketten des unbewussten Daseins.
Erste Risse im Traum
Manchmal durchbrechen kleine Momente die Fassade: ein Blackout während einer Autofahrt, das Erkennen mechanischer Sätze im Streit oder das nächtliche Gefühl, das eigene Leben wie von außen zu betrachten. Diese kurzen Erlebnisse sind wie ein Aufwachen im Traum – verstörend, aber zugleich befreiend. Gurdjieff nannte dies „Selbst-Erinnerung“: die gleichzeitige Wahrnehmung dessen, was man tut, und der Tatsache, dass man es tut.

Wege zum Erwachen
Traditionen haben unterschiedliche Methoden entwickelt, um diese Trance zu brechen. Zen arbeitet mit Koans, paradoxe Fragen, die den Verstand erschöpfen. Vipassana schärft durch minutiöse Beobachtung des Körpers das Bewusstsein. Gurdjieff selbst nutzte „Stop“-Übungen, um Schüler mitten in Handlung und Bewegung einzufrieren, damit sie ihre Automatismen erkennen. Ziel ist nicht Perfektion, sondern das Durchschauen des Mechanismus.
Zwischen Identität und Illusion – Die unbequeme Wahrheit
Echtes Erwachen bedeutet keine spirituelle Romantik. Es kann Beziehungen verändern, da viele auf unbewussten Mustern beruhen. Karrieren, Werte und Selbstbilder werden infrage gestellt. Der Prozess bringt nicht nur Freude, sondern auch Schmerz, denn man sieht plötzlich die Leere vergangener Jahre. Doch aus diesem Schock entsteht Klarheit. Emotionen verlieren ihre Macht, weil sie beobachtet werden können, bevor sie vollständig Besitz ergreifen.
Freiheit und ihre Fallen
Freiheit ist bedrohlich, weil sie keine Grenzen vorgibt. Viele kehren deshalb in neue Routinen zurück, rebellieren mechanisch oder verstricken sich in spirituelle Ersatzprogramme. Selbst die Suche nach Erwachen kann zur Maschinerie werden. Deshalb warnen Lehrer davor, Komfort zu idealisieren – Reibung hält wach, Routine schläfert ein.
Bewusstsein als Praxis
Es gibt keinen endgültigen Zustand. Erwachen gleicht dem Gehen auf einem Seil: Balance muss ständig neu gefunden werden. Jeder Atemzug, jede Handlung, jeder Gedanke birgt die Wahl zwischen Bewusstsein und Automatismus. Spiritualität bedeutet, dies immer wieder zu erkennen, auch wenn der Rückfall unvermeidbar bleibt. Die Arbeit gleicht dem Gärtnern – tägliches Pflegen, Aushalten von Rückschlägen, Freude am Wachsen.
Fazit | tl;dr
„Der Schlaf, den du Leben nennst“ ist eine Einladung, das Gewohnte zu durchschauen und die Verantwortung für das eigene Bewusstsein zu übernehmen. Erwachen heißt nicht, einen neuen Traum zu finden, sondern endlich den Traum als solchen zu erkennen.
Zwischen Identität und Illusion: Der Schlaf, den du Leben nennst
___
[via Asangoham]
Teyana Taylor kehrt zurück – „Escape Room“ als kathartisches R&B-Manifest 3 Sep 2:25 AM (last month)

Mit „Escape Room“ veröffentlicht Teyana Taylor ihr viertes Studioalbum – und gleichzeitig ihr bisher persönlichstes Werk. Nach dem vorläufigen Rückzug aus der Musik im Jahr 2020 war unklar, ob sie je wieder zurückkehrt. Nun nutzt Teyana Taylor die Metapher des „Escape Rooms“, um Schmerz, Verlust und Heilung künstlerisch zu verarbeiten. Sie knüpft an Toni Morrisons Satz aus Beloved an: „Freeing yourself was one thing, claiming ownership of that freed self was another.“ Genau darum geht es hier – nicht nur um Befreiung, sondern um das mutige Gestalten eines neuen Selbst.
Teyana Taylor x Escape Room – Trauer, Wut und Akzeptanz
Die Platte umfasst 22 Stücke, durchzogen von Monologen prominenter Stimmen wie Tariji P. Henson, Regina King, Issa Rae und Niecy Nash. Diese Einwürfe markieren verschiedene Stadien des Heilungsprozesses: Wut, Trauer, Akzeptanz und die zögerliche Rückkehr zur Freude. Gleich im Opener „Fire Girl“ lodert Taylors Zorn. Sie singt über zerstörerische Impulse, die sie befreien, ähnlich wie Beyoncé einst auf „Lemonade“. Das Video (s.u.) verstärkt die Botschaft: Taylor in Flammen, unversehrt, aber transformiert.
Herzschmerz mit Groove
Doch „Escape Room“ bleibt nicht im Dunkel stecken. „Hard Part“ mit Lucky Daye verwandelt Liebeskummer in eine bluesige Hymne, die trotz schwerer Texte Kopf und Herz bewegt. Mit „Long Time“ schlägt Taylor eine Brücke zum House – tanzbar und gleichzeitig von bittersüßer Melancholie durchzogen. „Back to Life“ schließlich berührt als emotionaler Tiefpunkt: eine Bitte um Rettung, musikalisch und visuell inszeniert als letzter Kampf gegen das Alleinsein.
Teyana Taylor x Escape Room – Lust und Neubeginn
Von dort öffnet sich das Album in hellere Gefilde. Schauspielerin Tasha Smith kündigt „new dick memories“ an, bevor Taylor auf „Pum Pum“ zusammen mit Jill Scott und Tyla den spielerischen, lustvollen Aspekt von Neuorientierung feiert. Die sexuelle Selbstermächtigung wirkt dabei nie oberflächlich, sondern wie ein notwendiger Teil der Heilung. Mit „Bed of Roses“ schwingt schließlich wieder Hoffnung mit – die Aussicht auf echte Nähe nach Enttäuschung.
Intimität und Familie
Einer der bewegendsten Momente ist „Always“, in dem Taylors Töchter Junie und Rue auftauchen. Der Song betont, dass Liebe nicht nur romantisch ist, sondern auch in familiären Bindungen Kraft schenkt. Taylors Zeile „I still hope in the heart“ wirkt wie ein Mantra für alle, die nach schweren Verlusten weitergehen müssen.
Neben der akustischen Dimension existiert auch ein visuelles Pendant: Taylor inszenierte die begleitenden Kurzfilme selbst, unter ihrem Regie-Pseudonym „Spike-Tey“. Mit Schauspielern wie LaKeith Stanfield und Aaron Pierre verschwimmen Realität und Fiktion – ein künstlerisches Spiel, das Taylors private Trennungserfahrungen reflektiert und gleichzeitig darüber hinausweist.
Heilung als kollektiver Prozess
„Escape Room“ ist kein Fluchtversuch, sondern eine Hinwendung. Taylor läuft nicht davon, sondern mitten durch Schmerz und Neubeginn. Sie zeigt, dass Heilung in Gemeinschaft geschieht – durch Freunde, Liebende und kreative Mitstreiterinnen. Dass sie ihre Stimme nach einer Operation schonen muss, wirkt fast symbolisch: Selbst wenn die Stimme schweigt, bleibt ihre künstlerische Präsenz ungebrochen.
Fazit | tl;dr
Teyana Taylor liefert mit „Escape Room“ ein Album, das gleichermaßen schmerzt, befreit und inspiriert. Es ist ein Projekt über das Menschsein in all seiner Zerbrechlichkeit – und über die Stärke, sich immer wieder neu zu definieren. Am Ende bringt Tochter Junie es auf den Punkt: „Thank you for coming back to music.“ Willkommen zurück, Teyana – und willkommen in unseren Herzen.
Teyana Taylor – „Escape Room“ // Spotify Stream:
Teyana Taylor – „Escape Room“ // apple Music Stream:
„Escape Room“ – Kurzfilm:
Alpine House: Wie ein schwebender Bau über Myrtleford neue Maßstäbe für Wohnen setzt 2 Sep 5:39 AM (last month)

Das Alpine House zeigt eindrucksvoll, wie Architektur unser Verständnis von Raum verändern kann. Entworfen als Erstwohnsitz eines Designers und seiner Frau, entstand auf einem steilen Grundstück am Rande von Myrtleford/Australien ein Haus, das bewusst klein gehalten ist. Das Ziel: das Leben auf das Wesentliche reduzieren. Trotz kompakter 100 Quadratmeter wirkt es durch geschickte Gestaltung großzügig, lichtdurchflutet und flexibel.
Alpine House – Ein Haus in Schwarz
Von außen wirkt das Haus radikal. Schwarzes Holz prägt die Fassade, die sich kraftvoll vom Hang abhebt. Das Material erfüllt nicht nur ästhetische, sondern auch funktionale Ansprüche, denn die Lage im Buschfeuergebiet erforderte Widerstandsfähigkeit und Wartungsfreiheit. Der schwarze Ton gibt dem Bau eine dramatische Präsenz, die sich mit dem Ausleger über den Hang noch verstärkt. Dieses schwebende Element erzeugt den Eindruck, über dem Tal zu gleiten.



Licht, Ausblick und Offenheit
Innen setzt sich der Minimalismus fort. Schwarz gebeiztes Sperrholz, raumhohe Glasflächen und zurückhaltende Details schaffen Ruhe und Geborgenheit. Statt auf dekorative Elemente wie Leisten oder Zierleisten zu setzen, wurde alles Überflüssige gestrichen. Der Blick richtet sich konsequent nach draußen: über Myrtleford hinweg bis zum Mount Buffalo. Der Entwurf lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf das Haus selbst, sondern auf die Natur.
Die große Glaswand ist das Herzstück des Hauses. Sie eröffnet von jedem Winkel aus den Blick in die Landschaft. Ob im Schlafzimmer, im Büro oder im Wohnbereich – immer ist die Natur präsent. Dadurch entsteht ein Gefühl von Offenheit, das die tatsächliche Größe des Hauses weit übersteigt.
Alpine House – Funktionalität im Detail
Trotz der kompakten Maße ist das Layout effizient und flexibel. Der östliche Teil nimmt Schlafzimmer und Büro auf, die morgens vom Sonnenlicht durchflutet werden. Im Süden liegt der Versorgungskern mit Bad und Waschküche – bewusst in den weniger attraktiven Bereich integriert. Küche, Ess- und Wohnbereich sind offen gestaltet und bilden das soziale Zentrum des Hauses.
Besonders bemerkenswert ist die Kombination aus klarer Struktur und emotionalem Raumgefühl. Materialien wie Sperrholz wurden nicht versteckt, sondern bewusst eingesetzt, um Wärme und Authentizität zu erzeugen. Sie altern sichtbar, nehmen Gebrauchsspuren an und gewinnen so über die Jahre an Charakter.



Architektur als Statement
Der kantige Ausleger über dem Hang ist mehr als nur ein architektonischer Effekt. Er symbolisiert die Entscheidung des Paares, weniger auf Größe und mehr auf Qualität zu setzen. In der Schwebe über dem Gelände entsteht ein Gefühl von Freiheit. Wer hier am Fenster steht, blickt ungestört in die Ferne und erlebt, wie Architektur mit Natur verschmilzt.
Das Haus zeigt, dass Reduktion nicht Verzicht bedeuten muss. Vielmehr geht es darum, konsequent zu prüfen, was wirklich gebraucht wird. Weniger Raum, weniger Ornamente, weniger Ablenkung – dafür mehr Licht, mehr Natur und mehr Bewusstsein für das Leben im Moment.
Ein Plädoyer für Einfachheit
Das Alpine House ist ein Beispiel für eine Haltung, die in der Architektur zunehmend an Bedeutung gewinnt. Angesichts steigender Baukosten und ökologischer Herausforderungen rückt die Frage nach dem „wirklich Notwendigen“ in den Mittelpunkt. Dieses Projekt zeigt, dass Größe nicht gleichbedeutend mit Lebensqualität ist. Viel wichtiger ist die Art, wie Räume gestaltet und mit der Umgebung verbunden werden.
Der Architekt selbst beschreibt es als Übung in Reduktion. Alles Überflüssige wurde weggelassen, um die Essenz sichtbar zu machen: die Landschaft, das Licht, die Atmosphäre. Sein Mentor sagte ihm einst, dass er niemals etwas entwerfen werde, das schöner sei als die Natur. Das Alpine House nimmt diesen Gedanken auf – es tritt zurück und lässt die Umgebung sprechen.


Fazit | tl;dr
Kompakt, schwarz und schwebend über dem Hang – das Alpine House ist mehr als ein Eigenheim. Es ist eine Reflexion darüber, wie wir wohnen wollen und was wir wirklich brauchen. Wer dieses Haus betritt, spürt: Größe entsteht nicht durch Quadratmeter, sondern durch Perspektive.
Alpine House: Wie ein schwebender Bau über Myrtleford neue Maßstäbe für Wohnen setzt
Anthony Hamilton & Omari Hardwick – „Pages“: Ein Buch in Musikform 2 Sep 1:55 AM (last month)

Der Grammy-prämierte R&B- und Soul-Sänger Anthony Hamilton hat sich mit dem Schauspieler, Spoken-Word-Poeten und Multitalent Omari Hardwick zu einem ungewöhnlichen Projekt zusammengetan. Ihr gemeinsames Album „Pages“ ist nicht bloß Musik – es ist eine Reise durch Kapitel des Lebens, erzählt mit Stimme, Poesie und Melodie.
Anthony Hamilton x Omari Hardwick – Spoken Word trifft Südstaaten-Soul
„Pages“ ist ein Werk voller Emotionalität, in dem Spoken Word und Soul eine Symbiose eingehen. Hamiltons warme, erdige Stimme trifft auf Hardwicks prägnanten Vortrag. Diese Kombination eröffnet eine ganz neue Erzählform, in der Musik nicht mehr nur Song, sondern Erzählung ist. Jedes Stück fühlt sich an wie ein neues Kapitel, eine Seite in einem Buch, die das Publikum tiefer in eine Geschichte hineinzieht.
Konzeptalbum mit Struktur
Das Album umfasst 18 Titel und ist wie ein literarisches Werk angelegt. Titel wie „Entry Page“, „Page 1“, „Why the Paged Word Stings“ oder „Final Page“ verdeutlichen, dass es sich hier nicht um eine klassische Sammlung einzelner Tracks handelt. Stattdessen wird eine durchgängige Dramaturgie entfaltet. Die Hörerinnen und Hörer blättern im übertragenen Sinne Seite für Seite durch eine musikalische Erzählung, die intime Momente, große Gefühle und tiefgründige Botschaften miteinander verknüpft.
Hamiltons künstlerische Weiterentwicklung
Für Anthony Hamilton bedeutet dieses Projekt einen wichtigen Schritt. Obwohl er regelmäßig tourt, war „Pages“ die erste große Veröffentlichung seit seiner Single „QUEEN“ im Jahr 2024. Während Hamiltons frühere Werke stark auf klassischen Soul und R&B setzten, wagt er hier eine Verschmelzung von Poesie, Literatur und Musik. Damit erweitert er sein Spektrum, ohne den warmen Kern seiner Kunst zu verlieren.
Hardwicks lyrische Handschrift
Omari Hardwick (Youtube), bekannt durch seine Schauspielrollen, beweist auf „Pages“ eine beeindruckende lyrische Stärke. Seine Spoken-Word-Passagen sind nicht bloß Füllmaterial, sondern das Rückgrat des Albums. Sie tragen die emotionale Tiefe und verleihen den Songs eine rohe Ehrlichkeit. In Kombination mit Hamiltons Gesang entsteht eine Dynamik, die man so selten hört: Dialog statt Monolog, Lyrik statt bloßer Unterhaltung.
Anthony Hamilton x Omari Hardwick „Pages“ – Highlights und Atmosphäre
Der allgemeine Sound von „Pages“ ist warm, organisch und voller Südstaaten-Soul. Instrumental bleibt vieles reduziert, um Raum für Worte und Stimme zu schaffen. Die Texte handeln von Liebe, Erbe, Schmerz und Hoffnung. Besonders eindrucksvoll ist, wie Spoken Word und Melodie miteinander verschmelzen, ohne dass einer den anderen überlagert. So entsteht ein zeitloses Werk, das sowohl Soul-Fans als auch Poesie-Liebhaber begeistert.
Fazit: Ein hörbares Buch
„Pages“ ist mehr als ein Album – es ist ein Konzept, das die Grenzen zwischen Musik und Literatur verschwimmen lässt. Jeder Track ist eine Seite, jede Seite ein Kapitel einer emotionalen Reise. Anthony Hamilton und Omari Hardwick haben mit diesem Projekt etwas geschaffen, das sich nicht in Playlists nebenbei abspulen lässt, sondern Aufmerksamkeit einfordert. Wer zuhört, entdeckt nicht nur Musik, sondern Geschichten, die unter die Haut gehen.
Anthony Hamilton & Omari Hardwick – „Pages“ // Spotify Stream:
Anthony Hamilton & Omari Hardwick – „Pages“ // apple Music Stream:
Langeweile als Superkraft: Wie Nichtstun Depression vorbeugt 1 Sep 5:52 AM (last month)

Die Harvard Business Review bringt mit dem Video „You Need to Be Bored. Here’s Why.“ eine Perspektive ins Gespräch, die viele zunächst irritiert. Professor Arthur C. Brooks erklärt, dass Langeweile nicht nur unvermeidbar, sondern essenziell ist. Sie schaltet das sogenannte Default Mode Network im Gehirn an – ein Netzwerk, das aktiv wird, wenn wir keine Aufgaben erledigen und unser Geist frei schweift. Genau in diesen Momenten entstehen kreative Ideen und tiefere Gedanken über Sinn und Bedeutung. Langeweile als Superkraft: Wie Nichtstun Depression vorbeugt.
Das Unbehagen des Nichtstuns
Experimente von Harvard-Psychologen zeigen, wie schwer wir es heute aushalten, nichts zu tun. In einer Studie wählten Probanden lieber schmerzhafte Elektroschocks, als 15 Minuten in einem leeren Raum zu sitzen. Warum? Weil Langeweile uns zwingt, mit unbequemen Fragen konfrontiert zu werden: Was bedeutet mein Leben? Wo finde ich Sinn? Dieses innere Unbehagen ist anstrengend, aber auch eine Tür zu mehr Klarheit und Tiefe.
Langeweile als Superkraft – Smartphones als Flucht aus dem Denken
Die größte Veränderung unserer Zeit: Wir können Langeweile fast komplett ausschalten. Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter, immer bereit, das kleinste Vakuum zu füllen – sei es beim Warten an der Ampel oder in der Bahn. Doch die Flucht aus der Langeweile hat ihren Preis. Wer sich nie mit den großen Fragen beschäftigt, verpasst die Chance auf Sinnstiftung. Brooks spricht von einer „Doom Loop of Meaning“: Wer sich permanent ablenkt, riskiert Depression, Angstzustände und ein Gefühl der inneren Leere.
Die Kunst, Langeweile zuzulassen
Brooks fordert dazu auf, Langeweile als Trainingsfeld zu begreifen. Statt jedes Loch mit Content zu stopfen, lohnt es sich, bewusste Momente des Nichts einzubauen. Ein Workout ohne Kopfhörer. Eine Autofahrt ohne Radio. Eine Mahlzeit ohne Smartphone. Diese kleinen Übungen wirken wie ein Muskeltraining für das Gehirn. Je öfter wir es aushalten, desto leichter fällt es, auch im Alltag Geduld und Präsenz zu bewahren.
Praktische Strategien für mehr Klarheit
Brooks lebt, was er predigt. Ab 19 Uhr gilt bei ihm eine strikte No Device Policy. Kein Handy im Schlafzimmer. Keine Geräte bei Mahlzeiten. Dazu kommen regelmäßige Social-Media-Fasten. Anfangs fühlt es sich wie Entzug an – das Dopamin fordert sein Recht. Doch nach kurzer Zeit stellt sich ein Gefühl von Ruhe ein. Die Gedanken ordnen sich. Die Zeit gewinnt an Tiefe. Brooks betont, dass Notfälle kein Argument sind, permanent online zu sein. Wirklich Wichtiges erreicht uns auch mit minimalem Zugriff.
Langeweile als Superkraft – Sinn, Kreativität und Glück
Wer Langeweile trainiert, entdeckt schnell Veränderungen. Routinen wie Arbeit, Beziehungen oder alltägliche Aufgaben erscheinen weniger monoton. Kreative Ideen entstehen plötzlich dort, wo früher nur Scrollen war. Noch wichtiger: Der Zugang zu den großen Fragen des Lebens wird möglich. Themen wie Sinn, Bedeutung und persönliche Werte treten in den Vordergrund. Laut Brooks kann genau das langfristig glücklicher machen – glücklicher als jedes digitale Entertainment.
Mehr Mut zum Leerlauf
Der Appell ist deutlich: Wir brauchen Langeweile. Nicht als Strafe, sondern als Ressource. In einer Welt, die uns ununterbrochen ablenkt, wird die bewusste Entscheidung für Leerlauf zu einer Form von Widerstand. Sie schützt vor innerer Leere, eröffnet Räume für Kreativität und führt zurück zu dem, was wirklich zählt. Oder wie Brooks es seinen eigenen Kindern sagt: „Legt die Telefone weg. Ihr braucht mehr Sinn im Leben. Und ich auch.“
Langeweile als Superkraft: Wie Nichtstun Depression vorbeugt
___
[via Harvard Business Review]
Joey Bada$$ – „Lonely At The Top“: Zwischen Reife, Reflexion und neuen Wegen 1 Sep 12:47 AM (last month)

Joey Bada$$ hatte 2025 bereits ein turbulentes Jahr. Sein Beef mit Westcoast-Rapper Ray Vaughn zog viel Aufmerksamkeit auf sich, ebenso wie kleinere Auseinandersetzungen mit anderen Namen der Szene. Doch anstatt ein reines Triumph-Album vorzulegen, überrascht Joey Bada$$ mit „Lonely At The Top“. Dieses Projekt ist weniger Kampfansage, sondern vielmehr eine Demonstration seiner Vielseitigkeit. Joey zeigt, dass er über den Boom-Bap hinausgewachsen ist und nun auch atmosphärischere, melodiösere Wege einschlägt.
Joey Bada$$ x Lonely At The Top – Mehr als Bars – Joey sucht Atmosphäre
Das elf Tracks starke Album lebt von einer relaxten Grundstimmung. Rap und R&B verschmelzen, Gesang und Verses greifen ineinander. Besonders spannend: Joey Bada$$ klingt auf einigen Songs stimmlich fast unkenntlich. Dieser Mut zur Veränderung unterstreicht seine künstlerische Reife. Dennoch bleibt er seinen Wurzeln treu. Der Boom-Bap, mit dem er berühmt wurde, ist präsent – aber aus neuen Perspektiven betrachtet.
Energiegeladen mit Club-Vibes
Ein echter Ausreißer nach oben ist „SUPAFLEE“ mit Bri Steves. Produziert von Pro Era-Kollege Kirk Knight, weckt der Track Erinnerungen an die Neptunes-Ära der frühen 2000er. Joey klingt locker, selbstsicher und charismatisch, während Bri Steves den Hook mit Leichtigkeit trägt. Ein weiteres Highlight für die Massen ist „READY FOR LOVE“ mit Ty Dolla $ign. Hier zeigt Joey erneut, dass er Sommerhits mit Ohrwurm-Potenzial kreieren kann. „HIGHROLLER“ mit A$AP Ferg schlägt in eine ähnliche Kerbe, wirkt aber zurückhaltender.
Joey Bada$$ x Lonely At The Top – Hommage an New York
Joey vergisst auf Lonely At The Top nie, wo er herkommt. „SWANK WHITE“ mit Westside Gunn klingt wie eine Hommage an Buffalo und Brooklyn zugleich: ein edles Sample, minimale Drums, intensive Bars. Gunn streut gewohnt seine Adlibs ein, Joey liefert Verse mit Biss. „BK’S FINEST“ wiederum bringt mit Statik Selektah, CJ Fly, Rome Streetz und Kai Ca$h gleich mehrere Stimmen der East-Coast-Szene zusammen – fast wie ein Cypher in Albumform.
Verletzlichkeit und Selbstreflexion
Neben der Härte zeigt Joey auch seine verletzliche Seite. „UNDERWATER“ ist ein Song, der mit hohem Gesang und melancholischem Inhalt überrascht. Joey wirkt hier ungefiltert und emotional – eine Seite, die man so selten von ihm hört. Direkt danach vertieft „3 FEET AWAY“ dieses Gefühl. Er reflektiert seine Beziehung zu Gott und sing-rapped von Halt und Vertrauen. Diese spirituelle Ebene gibt dem Album zusätzliche Tiefe.
Kollaboration mit Gewicht
Ein weiteres Glanzstück ist „STILL“ mit Rapsody und Ab-Soul. Erwartet hätte man ein klassisches Bar-Battle, doch stattdessen entsteht ein cineastischer Track mit klarer Struktur. Rapsody liefert den Hook, Ab-Soul glänzt mit einer verletzlich-introspektiven Strophe. Die Entscheidung gegen die übliche Rap-Schlacht zeigt Joeys Gespür für Dramaturgie.
Finale mit Verbeugung vor den Legenden
Der abschließende Titeltrack greift GangStarrs ikonisches „Moment of Truth“-Hook auf. Damit setzt Joey nicht nur ein Denkmal für New York, sondern verankert sich selbst in dieser Tradition. Das Leitmotiv Zeit durchzieht den gesamten Longplayer: Joey ist nicht mehr der hungrige Newcomer von 1999. Er ist gereifter Künstler, der Bilanz zieht, teilt und reflektiert.
Fazit: Ein reifes Kapitel in Joeys Karriere
Lonely At The Top ist ein Album der Balance. Zwischen Boom-Bap und R&B, zwischen Härte und Verletzlichkeit, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Joey Bada$$ (Youtube) verzichtet auf große Kampfansagen und liefert stattdessen Beobachtungen, Stimmungen und klare Einblicke in sein Leben. Die Produktion unterstützt diesen Ansatz mit ruhigen, eleganten Melodien anstelle von roher Härte. So präsentiert Joey eines seiner reifsten Werke bisher – und beweist, dass er auch ganz oben angekommen noch wachsen kann.
Joey Bada$$ – „Lonely At The Top“ // Spotify Stream:
Joey Bada$$ – „Lonely At The Top“ // apple Music Stream:
3.000 Meilen auf dem Skateboard durch die USA: „Across America“ mit Chad Caruso 29 Aug 4:42 AM (last month)

Die Dokumentation „Across America“ erzählt die fast unglaubliche Geschichte von Chad Caruso, der auf einem Skateboard 3.000 Meilen quer durch die USA gefahren ist. Von der Westküste in Kalifornien bis hinunter nach Virginia Beach legte er in 57 Tagen jeden einzelnen Meter auf nur einem einzigen Board zurück – ohne Begleitfahrzeug, ohne Ersatzmaterial, nur mit einem Rucksack und unerschütterlichem Willen.
Ein Guinness-Weltrekord voller Entbehrungen
Caruso startete seine Reise in Venice Beach. Sein Ziel: pro Tag rund 50 Meilen schaffen, insgesamt 3.000 Meilen. Damit sicherte er sich nicht nur den Guinness-Weltrekord für die längste Skateboard-Distanz, sondern sammelte gleichzeitig Spenden für die Non-Profit-Organisation Natural High, die Jugendlichen Alternativen zu Drogen aufzeigt.
Die Strecke verlangte alles ab: brütende Hitze, Sandstürme, steile Anstiege, gefährliche Highways und kilometerlange Abschnitte ohne Wasser oder Handyempfang. Besonders riskant waren die einsamen Landstraßen im Südwesten, wo Caruso zeitweise Coyoten fürchtete und Lastwagen nur Zentimeter entfernt an ihm vorbeirauschten.



Allein gegen die Weite Amerikas
Mit ihm unterwegs waren keine Kamerateams oder Unterstützerfahrzeuge – nur er selbst, sein Skateboard, eine minimale Ausrüstung und ein GPS-Tracker. Im Rucksack: Erste-Hilfe-Set, Ersatzlager, ein Poncho für Regen, ein paar Kleidungsstücke und drei Liter Wasser. Alles musste so leicht wie möglich sein, denn jedes Gramm bedeutete zusätzliche Belastung für Knie und Rücken.
Caruso kämpfte während der Tour mit Schmerzen, alten Verletzungen und der ständigen Erschöpfung. Doch immer wieder waren es Begegnungen mit Fremden, die ihn motivierten. Autofahrer hielten an, um Wasser zu teilen, Passanten spendeten Snacks oder einfach ein paar aufmunternde Worte. Aus Fremden wurden Verbündete – kleine, zufällige Gesten der Menschlichkeit, die die Doku eindrucksvoll einfängt.
Skateboarding als Meditation
Für Caruso war das Abenteuer mehr als nur sportlicher Rekord. Es wurde zur Form der Meditation. Er beschreibt, wie sich auf der Straße die Gedanken klärten, Sorgen verschwanden und ein intensives Gefühl von Fokus und Sinn zurückblieb. Jede Meile brachte ihn näher an einen Zustand, in dem das Skaten zum Ritual und die Monotonie zum Trost wurde.
Seine Reise war auch ein Spiegelbild seiner eigenen Vergangenheit. Früher hatte er mit Alkohol zu kämpfen, suchte in Partys und riskanten Aktionen nach Nervenkitzel. Heute ersetzt Skateboarding diese zerstörerische Energie – es ist seine Droge, sein „Natural High“.



Triumph in Virginia Beach
Am 19. Mai 2023 rollte Chad Caruso (Youtube) schließlich in Virginia Beach ein – erschöpft, aber überglücklich. Dort wurde er nicht nur von Freunden und Unterstützern empfangen, sondern auch offiziell geehrt: Der Bürgermeister erklärte den Tag zum „Chad Caruso Day“. Damit wurde sein Trip nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich zu einem Symbol für Durchhaltevermögen, Mut und positive Lebensführung.
Fazit: Mehr als nur ein Rekord
„Across America“ ist keine klassische Sportdokumentation, sondern ein Porträt über Selbstüberwindung, Sinnsuche und die stille Kraft von Begegnungen unterwegs. Carusos Leistung ist beeindruckend – doch noch wichtiger ist die Botschaft dahinter: Jeder Mensch kann seine Grenzen verschieben, wenn er bereit ist, den Weg konsequent zu gehen.
Chad Caruso hat nicht nur einen Weltrekord aufgestellt, sondern auch gezeigt, dass Skateboarding mehr sein kann als ein Hobby – nämlich ein Werkzeug für Transformation und eine Quelle echter Freiheit.
3.000 Meilen auf dem Skateboard durch die USA: „Across America“ mit Chad Caruso
Rakim bleibt der God MC – „The Re-Up“ EP im Review 29 Aug 1:12 AM (last month)
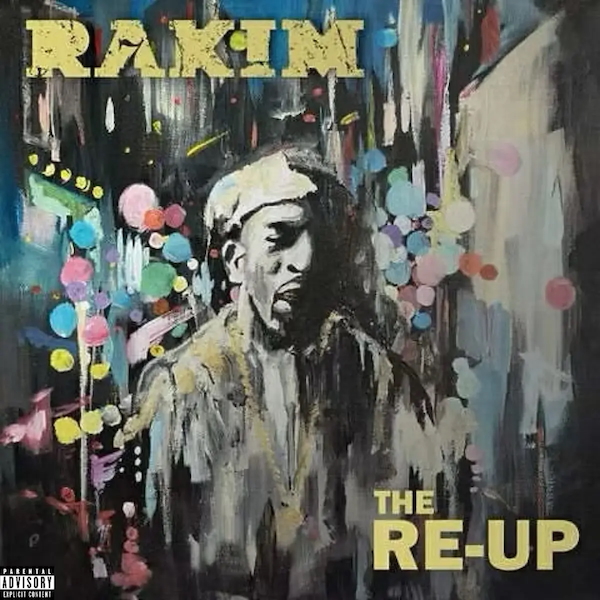
Rakim zählt seit den 80er-Jahren zu den unumstrittenen Grundpfeilern des Hip-Hop, hier kommt „The Re-Up“. Gemeinsam mit Eric B. veröffentlichte er vier Alben, die bis heute als Blaupausen des Genres gelten. „Paid in Full“ und „Follow the Leader“ legten nicht nur den Sound, sondern auch den lyrischen Standard für Generationen. Nach der Trennung etablierte Rakim sich als Solo-Künstler, zunächst mit „The 18th Letter“, später mit „The Master“. Während „The 7th Seal“ gemischte Reaktionen hervorrief, blieb sein Status als lyrisches Ausnahmetalent unbestritten. Mit „The Re-Up“ meldet er sich nun erneut zurück – kurz, präzise und mit der gewohnten Autorität.
Rakim The Re-Up: Ein neuer Track, sieben Remixe
Die EP umfasst lediglich acht Tracks, davon eine frische Aufnahme und sieben Remixe. Verantwortlich für den Großteil der Produktion ist Big Ghost Ltd., der seit einigen Jahren für seine düsteren, detailverliebten Boom-Bap-Sounds gefeiert wird. Schon die Ankündigung, dass er Rakim produzieren würde, sorgte in der Szene für hohe Erwartungen. Und tatsächlich: auch wenn die EP knapp ausfällt, beweist sie, warum Rakim auch vier Jahrzehnte nach seinen ersten Erfolgen noch immer als „God MC“ bezeichnet wird.
„Now is the Time“ – Rückblick und Weckruf
Die Nummer „Now is the Time“ kommt wieder mit Hus Kingpin. Hier thematisieren die beiden MCs die veränderte Realität nach der Pandemie, in der das Spiel härter und komplexer geworden ist. Der Track steht exemplarisch für Rakims Fähigkeit, gesellschaftliche Veränderungen aufzugreifen, ohne dabei den klassischen Flow zu verlieren. Hus Kingpin bringt frischen Wind, Rakim liefert die Struktur – gemeinsam entsteht ein Song, der modern wirkt, ohne die Tradition zu verraten.
„Not to Be Defined“ – ein Perspektivwechsel
Das neue Stück „Not to Be Defined“ sticht gleich doppelt heraus. Zum einen, weil hier Lazarus als Feature-Gast glänzt, zum anderen, weil die Produktion nicht von Big Ghost, sondern von Dem Jointz stammt. Der Track vermittelt eine andere Energie: mehr Swing, mehr Rhythmus, fast soulartige Untertöne. Thematisch geht es um die Unmöglichkeit, Rakim in eine Schublade zu stecken – ein Statement, das sein gesamtes Werk zusammenfasst.
Die Kraft der Remixe
So stark der neue Tune auch ist, die sieben Remixe sind keineswegs Füllmaterial. Im Gegenteil: Big Ghost schafft es, die Stücke aus „G.O.Ds Network (REB7RTH)“ neu zu interpretieren und teilweise sogar zu übertreffen. Für viele Fans könnten die Remixe sogar der heimliche Kern der EP sein, da sie bekannten Material neues Leben einhauchen.
Fazit: Rakim bleibt unvergleichlich
„The Re-Up“ ist kurz, aber eindrucksvoll. Ein neuer Songs und sieben Remixe reichen aus, um Rakims Status zu unterstreichen. Er ist nicht nur ein Veteran, er ist ein lebendiger Beweis dafür, dass Substanz und Beständigkeit im Hip-Hop über Jahrzehnte bestehen können. Sollte das angekündigte „G.O.Ds Network 2“ tatsächlich weniger Gäste und mehr Rakim selbst bieten, könnte es sich in die Reihe seiner Klassiker einreihen. Bis dahin liefert „The Re-Up“ genau das, was man erwartet: einen weiteren Beweis, dass Rakim für immer der God MC bleibt.
Rakim – „The Re-Up“ EP // Spotify:
Rakim – „The Re-Up“ EP // apple Music:
Die gesamte Geschichte von Spanien: Von Al-Andalus bis zur Demokratie 28 Aug 5:55 AM (last month)

Die Geschichte von Spanien reicht tief in die Vorgeschichte zurück. Schon vor der Antike lebten auf der Iberischen Halbinsel zahlreiche Völker, darunter Iberer, Kelten und Tartessier. Mit den Phöniziern, Griechen und Karthagern kamen erste Kolonien und Handelsstädte. Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. eroberten die Römer schrittweise die Halbinsel und machten sie zu Hispania, einer wohlhabenden Provinz ihres Imperiums. Straßen, Aquädukte und Städte wie Mérida oder Tarragona sind bis heute sichtbare Zeugnisse dieser Epoche. Unter römischem Einfluss verbreiteten sich Latein und das Christentum – Grundlagen, die Kultur, Sprache und Identität Spaniens bis heute prägen.
Die Geschichte von Spanien – Germanen und Al-Andalus
Mit dem Zerfall des Römischen Reiches übernahmen die Westgoten die Herrschaft. Sie regierten mehr als zwei Jahrhunderte, bis 711 muslimische Truppen aus Nordafrika einfielen und große Teile der Halbinsel eroberten. Es begann das Zeitalter von Al-Andalus, einer kulturell glanzvollen Periode. Córdoba entwickelte sich zum Zentrum von Wissenschaft, Philosophie und Architektur. Moscheen, Gärten und Universitäten prägten das Bild, während Christen, Juden und Muslime in relativer Toleranz zusammenlebten. Gleichzeitig entstand im Norden das kleine Königreich Asturien, Ausgangspunkt für die Reconquista, die jahrhundertelange Rückeroberung durch christliche Reiche.
Aufstieg der katholischen Könige
Im Laufe des Mittelalters wuchs die Macht von Kastilien, León, Navarra und Aragón. 1469 vereinten sich die Kronen von Kastilien und Aragón durch die Ehe von Isabella I. und Ferdinand II. Gemeinsam eroberten sie 1492 Granada, das letzte muslimische Emirat, und beendeten damit fast 800 Jahre islamische Präsenz. Im selben Jahr finanzierten sie die Reise von Christoph Kolumbus – ein Schritt, der Spanien zum Zentrum eines globalen Imperiums machen sollte. Gleichzeitig begann mit der Inquisition eine Politik religiöser Intoleranz, die Juden und Muslime zur Flucht oder Zwangsbekehrung zwang.
Das Weltreich und das Goldene Zeitalter
In den folgenden Jahrhunderten wurde Spanien zu einer Weltmacht. Eroberungen in Amerika, Asien und Afrika brachten ungeheure Reichtümer, besonders Silber aus Mexiko und Peru. Unter Karl V. und Philipp II. erreichte das Reich eine Größe, in der „die Sonne niemals unterging“. Doch Machtkämpfe, die Niederlage der Armada 1588 und endlose Kriege gegen England, die Niederlande und Frankreich leiteten den Niedergang ein. Gleichzeitig erlebte Spanien jedoch ein kulturelles Siglo de Oro (Goldenes Zeitalter): Maler wie El Greco und Velázquez sowie Schriftsteller wie Cervantes prägten die europäische Kultur nachhaltig.

Krise, Napoleon und Verlust der Kolonien
Das 18. Jahrhundert brachte mit den Bourbonen Reformen, doch auch neue Konflikte. Der Einmarsch Napoleons 1808 führte zu blutigen Aufständen und zum Beginn des spanischen Unabhängigkeitskrieges. Parallel dazu lösten sich fast alle Kolonien in Lateinamerika von der spanischen Krone. Spanien schrumpfte zur europäischen Mittelmacht. Im 19. Jahrhundert wechselten Monarchie, Republiken und Militärdiktaturen einander ab. Politische Instabilität, Bürgerkriege und soziale Spannungen bestimmten das Land, das seinen Platz in Europa neu suchen musste.
Die Geschichte von Spanien – Bürgerkrieg und Franco-Diktatur
Die Krise kulminierte 1936 im Spanischen Bürgerkrieg. Republikaner und Nationalisten kämpften gegeneinander, unterstützt von internationalen Mächten. Der in Málaga geborene Pablo Picasso schuf mit „Guernica“ eines der eindringlichsten Antikriegsbilder der Welt, das die Zerstörungskraft des Krieges unsterblich machte. 1939 siegte Francisco Franco und errichtete eine fast 40-jährige Diktatur. Oppositionelle wurden verfolgt, regionale Kulturen unterdrückt. Zwar erlebte Spanien in den 1960ern wirtschaftlichen Aufschwung, doch politische Freiheit blieb aus. Erst Francos Tod 1975 ebnete den Weg in eine neue Epoche.
Vom Übergang zur modernen Demokratie
König Juan Carlos I. führte Spanien überraschend in die Demokratie. 1978 trat eine neue Verfassung in Kraft, die das Land in einen parlamentarischen Staat mit autonomen Regionen verwandelte. Der EU-Beitritt 1986 und die Einführung des Euro stärkten Spaniens Position in Europa. Die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona symbolisierten den Aufbruch in die Moderne. Trotz Krisen, wie der Finanzkrise 2008 (welche der Grund für temporär günstige Immobilienpreise war) oder dem katalanischen Unabhängigkeitskonflikt, bleibt Spanien heute eine stabile Demokratie, deren Kultur und Geschichte bis weit über Europa hinausstrahlen.
Fazit | tl;dr
Die Geschichte Spaniens ist eine Abfolge von Umbrüchen: von der Antike über das maurische Al-Andalus, vom globalen Imperium bis zur faschistischen Diktatur. Jeder Einschnitt formte das Land neu. Heute zeigt sich Spanien als moderne Nation, die gelernt hat, Vielfalt und Einheit miteinander zu verbinden.
Die gesamte Geschichte von Spanien: Von Al-Andalus bis zur Demokratie
Psychiatrie als Identitätspolitik: Wie Trauma pathologisiert und Menschen in Diagnosen gefangen werden 28 Aug 1:50 AM (last month)
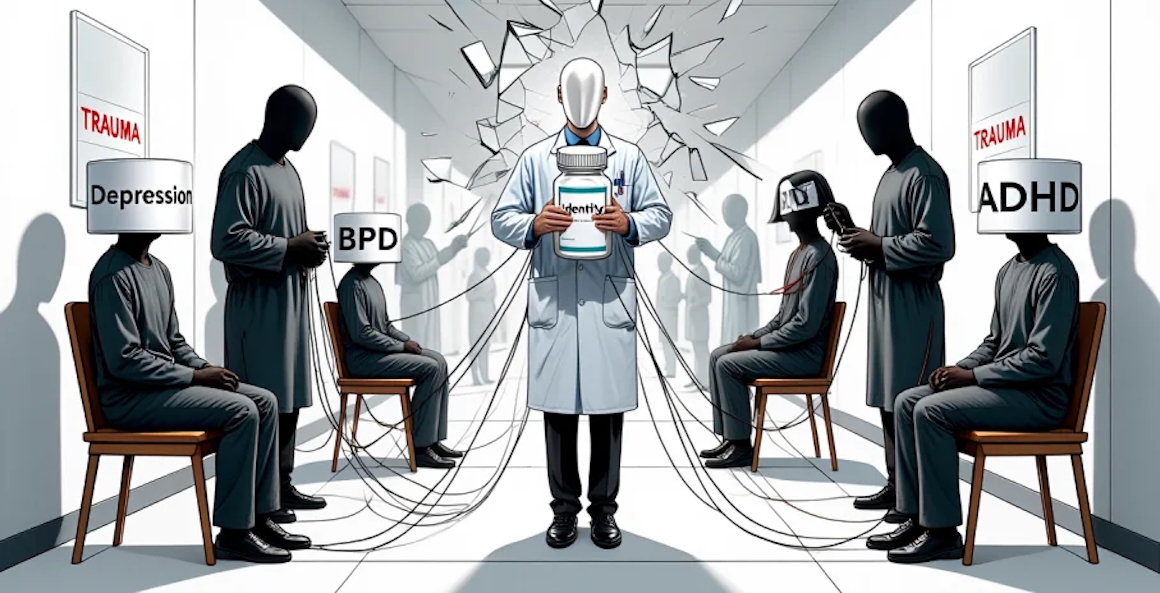
Im Podcast „Dysfunctional“ von Josh Connolly stellt die Psychologin und Bestsellerautorin Dr. Jessica Taylor eine radikale Frage: Ist die Psychiatrie auf Lügen aufgebaut? Mit schonungsloser Offenheit attackiert sie ein System, das Leid nicht nur falsch interpretiert, sondern gezielt pathologisiert. Statt Betroffenen zu helfen, so ihre These, verschärft die Psychiatrie ihre Probleme und hält sie in Abhängigkeit. Psychiatrie als Identitätspolitik: Wie Trauma pathologisiert und Menschen in Diagnosen gefangen werden.
Taylor schildert eindrucksvoll, wie Missbrauchsopfer als „krank“ abgestempelt werden. Frauen und Kinder, die Gewalt überlebt haben, landen mit Diagnosen wie „Borderline“ oder „Bipolar“ in den Akten. Damit wird ihr Schmerz zu einer Störung der Persönlichkeit erklärt, statt als natürliche Reaktion auf Trauma verstanden zu werden.
Psychiatrie als Identitätspolitik – Elektroschocks und Sprachlosigkeit
Besonders erschütternd ist ihre Erinnerung an ein 15-jähriges Mädchen, das nach einer Vergewaltigung Elektrokrampftherapie (ECT) erhielt. Die Folgen: Gedächtnisverlust, Erschöpfung, Orientierungslosigkeit. Für Taylor war dies ein Wendepunkt – ein Moment, der sie das medizinische Modell grundsätzlich infrage stellen ließ.
Sie erzählt auch von einer Frau, der Ärzte bescheinigten, sie habe eine „therapieresistente Depression“. Damit wurde ihr signalisiert: „Es gibt keine Hoffnung, du bleibst krank.“ Für Taylor ist das nichts anderes als institutionalisierte Verzweiflung.
Diagnose oder Etikett?
Ein roter Faden zieht sich durch die Episode: Diagnosen dienen nicht nur der Behandlung, sondern vor allem der Kontrolle. Wer eine Diagnose erhält, wird etikettiert. Damit lässt sich Verhalten erklären, abwerten und steuern.
Taylor weist darauf hin, dass viele psychiatrische Klassifikationen nicht auf harten Daten beruhen, sondern auf Abstimmungen in Fachgremien. So habe man sogar die Dauer, ab wann Traurigkeit als Depression gilt, per Mehrheitsentscheid festgelegt. Wissenschaft sieht anders aus.
Psychiatrie als Identitätspolitik – Die Chemie-Lüge
Ein zentraler Angriffspunkt ist die bis heute populäre „chemische Imbalance“-Theorie. Jahrzehntelang wurde Menschen erzählt, Depression sei ein Serotoninmangel. Antidepressiva sollten das Gleichgewicht wiederherstellen. Doch wissenschaftlich belegt ist diese These nie. Für Taylor ist sie ein Marketingtrick der Pharmaindustrie – simpel, verführerisch und vor allem profitabel.
Die Folge: Millionen Menschen schlucken Medikamente, die sie nicht heilen, sondern in eine Dauerschleife von Dosissteigerungen und Nebenwirkungen treiben. „Antidepressivum“ ist, so betont Taylor, kein wissenschaftlicher Begriff, sondern ein Werbeslogan.
Pathologisierte Kindheit
Besonders kritisch sieht sie den Umgang mit Kindern. Verhaltensweisen, die eigentlich normal sind – Bewegungsdrang, Langeweile im Frontalunterricht, Widerstand gegen Ungerechtigkeit – werden als Symptome von ADHS oder Autismus gedeutet. Damit können Schulen und Behörden Bedürfnisse erst dann anerkennen, wenn ein medizinisches Label existiert.
Für Taylor ist das medizinisches Gatekeeping: Kinder erhalten Unterstützung nur, wenn sie zuvor krankgeschrieben werden. Ein Mechanismus, der Eltern unter Druck setzt und Kinder stigmatisiert.
Die Macht der Sprache
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sprache der Psychiatrie. Wer sich selbst als „gestört“ oder „krank“ beschreibt, übernimmt die Logik eines Systems, das Leiden individualisiert und von gesellschaftlichen Ursachen trennt. Taylor fordert daher einen Perspektivwechsel: Gefühle wie Angst, Trauer oder Wut seien keine Symptome, sondern verständliche Reaktionen auf reale Missstände – Missbrauch, Armut, Diskriminierung, toxische Umfelder.
Statt zu sagen „mein ADHS spielt verrückt“, solle man fragen: „Wovor habe ich Angst? Was macht mich nervös?“
Psychiatrie als soziales Kontrollinstrument
Für Taylor ist Psychiatrie weniger Medizin als Identitätspolitik. Indem Menschen in Kategorien eingeteilt werden, lässt sich gesellschaftliches Verhalten steuern. Wer nicht funktioniert, wird zum Problemfall erklärt.
Historische Beispiele untermauern ihre Kritik: Fluchtversuche von Sklaven galten einst als Krankheit. Homosexualität stand bis in die 1970er im Diagnostikhandbuch DSM. Heute droht selbst ein „starker Sinn für Gerechtigkeit“ als Symptom gedeutet zu werden. Für Taylor ist klar: Jede Generation definiert neu, was „krank“ ist – und macht damit unbequeme Menschen unsichtbar.
Revolution statt Resignation
Josh Connolly (Youtube) teilt in der Folge eigene Erfahrungen. Er beschreibt, wie ihn die Sinnlosigkeit seines Jobs einst in eine Depression stürzte. Statt Medikamente zu nehmen, fand er Heilung durch neue Aufgaben im Ehrenamt. Seine Botschaft: Der Kontext macht den Unterschied.
Taylor ergänzt: Der wahre Skandal sei nicht individuelles Leid, sondern die Weigerung der Gesellschaft, strukturelle Ursachen wie Missbrauch, Armut oder toxische Arbeitswelten anzugehen. Stattdessen sollen Pillen die Symptome zudecken. Für sie ist das nichts weniger als ein dystopisches Kontrollsystem – eine Art „Black Mirror“ des realen Lebens.
Ein unbequemes Fazit
„Is Psychiatry Built on Lies?“ ist keine leichte Episode. Doch gerade in ihrer Radikalität entfaltet sie Kraft. Taylor fordert dazu auf, Diagnosen zu hinterfragen, die eigene Sprache zu reflektieren und Trauma als valide Reaktion auf reale Erfahrungen anzuerkennen.
Ob man ihrer Analyse zustimmt oder nicht – dieses Gespräch zwingt zum Nachdenken. Es zeigt, dass Psychiatrie nicht nur medizinische Praxis ist, sondern auch ein Spiegel von Macht, Profit und gesellschaftlicher Kontrolle.
Psychiatrie als Identitätspolitik: Wie Trauma pathologisiert und Menschen in Diagnosen gefangen werden
Die Wissenschaft des Manifestierens: Tara Swart erklärt, wie Neuroplastizität Dein Leben verändern kann 27 Aug 5:33 AM (last month)

Dr. Tara Swart ist eine der wenigen Expertinnen, die Neurowissenschaft, Psychiatrie und Leadership-Coaching in einem Ansatz vereint. In ihrem Vortrag „Die Wissenschaft des Manifestierens“ für After Skool erklärt sie, wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung nutzen können, um Ziele nicht nur zu visualisieren, sondern tatsächlich in unser Leben zu ziehen. Der Fokus liegt dabei nicht auf esoterischen Konzepten, sondern auf Neuroplastizität – der Fähigkeit unseres Gehirns, sich ein Leben lang zu verändern.
Wissenschaft des Manifestierens – Neuroplastizität als Fundament
Lange Zeit galt die Annahme, das Gehirn höre mit etwa 18 Jahren auf, sich zu entwickeln. Moderne Bildgebung widerlegte das. Heute wissen wir: Zwischen 25 und 65 können wir aktiv beeinflussen, wie flexibel unser Gehirn bleibt. Diese Anpassungsfähigkeit ist die Grundlage für Manifestation. Denn wer sein Denken und Handeln verändert, baut buchstäblich neue neuronale Strukturen.
Swart beschreibt vier Phasen, die für diesen Prozess entscheidend sind. Zuerst braucht es Bewusstsein: Welche Ziele verfolge ich wirklich? Danach folgt fokussierte Aufmerksamkeit, die uns hilft, blockierende Gedanken oder Muster zu erkennen. Die dritte Phase ist bewusste Praxis – kleine, wiederholte Handlungen, die unsere neuen Überzeugungen im Alltag verankern. Schließlich braucht es Verantwortung: Ziele in überschaubare Schritte zerlegen und sich selbst oder anderen Rechenschaft ablegen.
Visualisierung statt Vibrationen
Viele Manifestationsmethoden basieren auf vagen Vorstellungen von „Energie“ oder „Quantenfeldern“. Swart geht einen anderen Weg. Sie erklärt Visualisierung über drei Prozesse im Gehirn: selektives Filtern, selektive Aufmerksamkeit und sogenanntes „Value Tagging“.
Wer täglich mit klaren Bildern arbeitet – sei es durch Vision Boards oder mentale Visualisierung – richtet die Wahrnehmung neu aus. Plötzlich tauchen Gelegenheiten auf, die vorher unsichtbar schienen. Das klassische Beispiel: Man kauft ein Auto und sieht das Modell plötzlich überall. Visualisierung schärft also nicht nur den Fokus, sie verleiht auch Priorität. Und zwar nicht nur logisch, sondern auch emotional – wir beginnen, Ziele nicht nur für möglich, sondern auch für erstrebenswert zu halten.
Wissenschaft des Manifestierens – Vom Mangel zur Fülle
Ein zentraler Punkt in Swarts Ansatz ist die innere Haltung. Viele scheitern am Manifestieren, weil sie aus einem Mangeldenken heraus handeln. Zweifel, Scham oder Angst blockieren den Prozess. Das Gehirn reagiert dann mit Stresshormonen wie Cortisol – und schränkt Risikobereitschaft oder Offenheit ein.
Ein Füllebewusstsein dagegen aktiviert Oxytocin, das „Bindungshormon“. Dadurch entsteht Vertrauen, Mut und die Bereitschaft, Chancen zu ergreifen. Entscheidend ist, alte Glaubenssätze zu identifizieren – etwa mangelnde Selbstwertgefühle – und durch gezielte Mantras zu ersetzen. Swart empfiehlt, jeden negativen Gedanken sofort mit einem positiven Gegengedanken zu überschreiben. Schritt für Schritt verschiebt sich das Gehirn so von Knappheit hin zu Fülle.
Praktische Strategien
Swart betont, dass Manifestation keine reine Kopf-Sache bleibt. Kleine Experimente im Alltag helfen, Selbstvertrauen aufzubauen. Wer etwa einen Karrieresprung anstrebt, sollte sich zunächst niedrigschwellige Testsituationen suchen, um Ängste abzubauen. Diese Praxis verhindert, dass man in Passivität verharrt.
Besonders effektiv ist das sogenannte „Tetris-Effekt“-Prinzip: Was wir direkt vor dem Schlafengehen betrachten, prägt unser Unterbewusstsein besonders stark. Swart rät daher, Vision Boards neben dem Bett zu platzieren. Wer morgens und abends bewusst Ziele betrachtet, verankert sie tiefer im Gehirn.
Sie selbst nutzte diese Technik beim Wechsel von der Medizin zur Selbstständigkeit. Anfangs stand nur der Betrag auf ihrem Board, den sie für ein Jahr benötigte. Jedes Jahr verdoppelte sie den Betrag – und ihr Gehirn gewöhnte sich an die wachsende Dimension der Ziele. Gleichzeitig ließ sie Platz für Unerwartetes: Raum für das, was sie noch gar nicht erträumen konnte.
Timing und Geduld
Manifestation funktioniert nicht linear. Swart beschreibt Phasen, in denen scheinbar nichts geschieht, gefolgt von Momenten, in denen mehrere Erfolge gleichzeitig eintreten. Dieses „Busphänomen“ zeigt, dass äußere und innere Faktoren sich manchmal synchronisieren müssen. Wichtig ist, Durchhaltevermögen zu entwickeln und Fortschritte bewusst zu würdigen.
Denn wer erreichte Ziele ignoriert und sofort zum nächsten Projekt übergeht, schwächt seine Motivation. Dankbarkeit hingegen verstärkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Gehirn positive Muster erkennt und wiederholt.
Fazit | tl;dr
Tara Swarts Ansatz macht deutlich: Manifestation ist kein mystisches Ritual, sondern angewandte Neurowissenschaft. Wer Ziele klar definiert, Visualisierung nutzt, alte Glaubenssätze transformiert und konkrete Schritte geht, verändert sein Gehirn – und damit sein Leben.
Am Ende geht es nicht um magische Anziehung, sondern um neuroplastische Veränderung, die uns handlungsfähiger, aufmerksamer und mutiger macht. Manifestation heißt bei Tara Swart: Wissenschaft trifft Praxis – und eröffnet jedem die Chance, das eigene Leben bewusst neu zu gestalten.
Die Wissenschaft des Manifestierens: Tara Swart erklärt, wie Neuroplastizität Dein Leben verändern kann
Robert Glasper verbindet Jazz und Hip-Hop auf „Code Derivation“ 27 Aug 3:31 AM (last month)
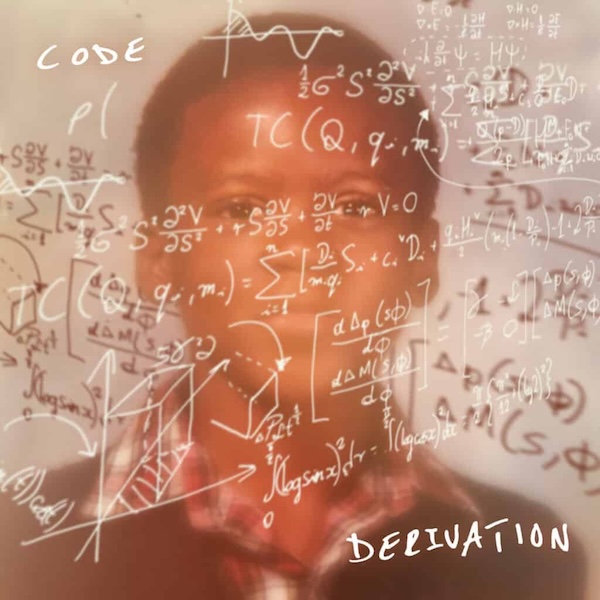
Robert Glasper hat es erneut getan. Der fünffache Grammy-Gewinner veröffentlicht mit Code Derivation sein zweites Album des Jahres 2025. Schon der Titel deutet an, worum es geht: Ableitung, Herkunft, Verbindung. Robert Glasper führt vor, dass Jazz und Hip-Hop mehr als nur Nachbarn sind – sie teilen dasselbe Fundament. „Jazz steckt in den Knochen des Hip-Hop“, erklärt er. Deshalb ließ er jedes Stück gleich doppelt entstehen: einmal als Live-Version mit seiner Band, einmal als „Flip“, bearbeitet von ausgewählten Produzenten.
Robert Glasper x Code Derivation – Die Band und ihre Energie
Für die Live-Seite holte Glasper eine Gruppe von langjährigen Weggefährten zusammen. Mit dabei sind Saxofonist Walter Smith III, Gitarrist Mike Moreno, Drummer Kendrick Scott, Bassist Vicente Archer und Trompeter Keyon Harrold. Auch Marcus Strickland gibt ein prägnantes Gastspiel. Diese Formation bringt nicht nur technische Präzision, sondern auch die spontane Energie, die Glasper so liebt. Jedes Stück wirkt wie eine Einladung zum Dialog, bei dem Jazz nicht museal, sondern hochaktuell klingt.
Produzenten als Architekten der zweiten Ebene
Doch Code Derivation lebt ebenso von seiner zweiten Schicht: den Produzenten, die Glaspers Kompositionen auseinandernehmen und neu zusammensetzen. Hier kommen Hi-Tek, Black Milk, Taylor McFerrin und Kareem Riggins ins Spiel – allesamt Veteranen, die wissen, wie man Jazz zu Hip-Hop formt, ohne ihn seiner Tiefe zu berauben. Besonders charmant ist der Beitrag von Glaspers Sohn Riley, der seinem Vater eine persönliche Note schenkt und zeigt, dass musikalisches Erbe auch familiär weitergetragen wird.
Junge Stimmen im Fokus
Neben den Beats rücken die MCs in den Vordergrund. Glasper entschied sich bewusst für junge, hungrige Stimmen wie Jamari aus Texas, MMYYKK aus Minneapolis und Oswin Benjamin aus Brooklyn. Für ihn sind sie das Herzstück des Projekts, die „pièce de résistance“. Ihre Texte ergänzen die instrumentale Basis und verleihen dem Album eine Dringlichkeit, die an die besten Momente von Black Radio erinnert, aber eigenständig bleibt.
Robert Glasper x Code Derivation – Der Kreis schließt sich
Code Derivation ist mehr als nur ein Studioalbum. Es ist ein Statement, ein Manifest über die Verwandtschaft zweier Genres, die seit jeher ineinandergreifen. Glasper demonstriert, dass Jazz nicht bloß der Vorläufer, sondern der pulsierende Kern des Hip-Hop ist. Diese Haltung vermittelte er auch im Gespräch mit Zane Lowe bei Apple Music (Video siehe unten), wo es um Sampling, Fanbindung und die Freude am gemeinsamen Prozess ging.
Live-Erfahrungen als Erweiterung
Parallel zur Albumveröffentlichung zeigt Glasper, wie stark sein Projekt auch live funktioniert. Als Artist in Residence beim Black Radio Experience in Napa Valley tritt er an der Seite von John Legend, Jill Scott, Andre 3000 und vielen weiteren Größen auf. Das Event ist ein Fest schwarzer Kultur, ein mehrtägiger Austausch, der die Philosophie von Code Derivation auf die Bühne hebt.
Tradition mit Zukunft
Im Herbst folgt dann das legendäre Robtober im Blue Note in New York. Fünf Wochen lang, mit zwei Sets pro Abend, versammelt Glasper dort Künstler und Fans aus aller Welt. Was einst als lockere Residency begann, ist längst eine Institution, die die Essenz seiner Arbeit widerspiegelt: Grenzen einreißen, Genres verbinden, Menschen zusammenführen.
Fazit
Mit Code Derivation gelingt Robert Glasper (Insta) in Balanceakt zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Familientradition und Innovation. Das Album ist kein Kompromiss, sondern ein Brückenschlag. Es beweist, dass Jazz und Hip-Hop sich nicht nur berühren, sondern aus derselben Quelle schöpfen. Wer verstehen will, warum Glasper zu den wichtigsten Musikern unserer Zeit zählt, findet hier die Antwort.
Robert Glasper – „Code Derivation“ // Spotify Player:
Robert Glasper – „Code Derivation“ // apple Music Player:
Robert Glasper x Zane Lowe Interview:
Big Sur Cliff House: Architektur, die mit der Natur verschmilzt 26 Aug 6:48 AM (last month)

An der dramatischen Küste von Big Sur, dort wo die Santa-Lucia-Berge steil ins Meer abfallen, haben Stan und Jess von Field Architecture ein Cliff House geschaffen, das nicht konkurrieren, sondern verschwinden will. Es ist weniger ein Bauwerk als ein Dialog mit der Natur. Und doch ist es ein intimes Familienheim, das Schutz bietet und zugleich die Kraft der Landschaft in jede Wand und jede Linie integriert.
Schon beim ersten Blick wird klar: Dieses Haus ist kein Monument für den Menschen, sondern eine Hommage an die Küste. Die Architekten betonen, dass sie nicht gegen die Natur bauen wollten. Stattdessen suchten sie Wege, sich mit ihr zu verbinden.
Big Sur Cliff House – Inspiration aus Erosion und Fels
Die Grundlage des Entwurfs war nicht eine starre Form, sondern die Landschaft selbst. Erosion, Felsen und Pools gaben die Leitlinien vor. Wo andere aufschütten und glätten, ließen Stan und Jess die Natur bestimmen. Herausgekommen ist eine Architektur, die aussieht, als sei sie schon immer dort gewesen.
Dünne, fast schwebende Dächer dehnen sich horizontal über das Gelände. Sie wirken wie eine Fortsetzung der Küstenlinie, ein „Datim“, das den Hang begleitet und die Bewegung des Geländes fortführt. Das Haus tritt nicht hervor – es wird Teil der geologischen Erzählung.



Ein Weg durch Licht und Ausblicke
Der Zugang zum Haus ist ein Erlebnis für sich. Von der Küstenstraße führt ein Weg durch einen Hain von Monterey-Zypressen. Erst nach dieser kurzen Passage öffnet sich der Blick auf die Architektur. Über eine Brücke betritt man den Wohnbereich, wo sich sofort das Panorama von Küste und Schlucht entfaltet.
Die Räume folgen einem Rhythmus, der Innen- und Außenwelten verschränkt. Küche und Essbereich öffnen sich zu einer Terrasse mit Pool. Über Stufen gelangt man zu den privaten Räumen: Elternschlafzimmer auf der einen Seite, Kinderzimmer auf der anderen. Die Bewegung durch das Haus gleicht einer Choreografie – jedes Stockwerk ist eine neue Szene, jede Wand ein Übergang.
Big Sur Cliff House – Architektur als Antwort auf Extreme
Big Sur ist nicht nur atemberaubend, sondern auch extrem. Gewaltige Winterstürme, starke Winde, die salzige Luft und die gnadenlose Sommersonne stellen besondere Anforderungen. Genau hier zeigt sich die Stärke des Entwurfs.
Die Architekten verstanden diese Naturgewalten nicht als Feind, sondern als Lehrer. Sie ließen sich von den Kräften inspirieren, die das Land über Jahrtausende formten. So entstand eine Architektur, die den Elementen nicht trotzt, sondern sie integriert – durch Materialien, Proportionen und Ausrichtung.



Stein, Holz und ein klarer Rhythmus
Das Materialkonzept ist bewusst reduziert. Grauer Quarzit, in horizontalen Schichten verarbeitet, bildet die Basis. Diese Steinmauern verankern das Haus im Felsen und lassen es zugleich organisch wirken.
Holz ergänzt den Stein als warmer Gegenpart. Kalifornischer Lorbeer zieht sich von Möbeln über Wandverkleidungen bis in die Details der Küche. Selbst der Esstisch und die Schränke stammen aus dem gleichen Material. Schwarzer Granit in den Arbeitsflächen setzt einen harten Akzent, ohne die Balance zu stören.
Diese Zurückhaltung erzeugt Ruhe. Statt Materialvielfalt gibt es eine klare Sprache, die Stein und Holz in Dialog treten lässt.
Emotion als Kern von Architektur
Für Stan und Jess ist dieses Haus mehr als ein Projekt. Es ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Architektur und Landschaft. Stan, der seine Karriere in Südafrika begann und bei Louis Kahn lernte, sieht hier eine Vollendung. Sein Sohn Jess, der seit Kindheitstagen die Arbeit des Vaters verfolgte, führt diese Haltung fort.
Beide betonen, dass Architektur Gefühle erzeugen muss. Hier wird nicht nur gebaut, hier wird gefühlt: die Kraft der Klippe, das Rauschen des Ozeans, das Schweigen der Bäume. Vom Pool aus sieht man, wie sich das Haus gleichzeitig in den Hang zurückzieht und sich mutig zum Meer hinausstreckt. Genau in dieser Spannung liegt seine Magie.


Ein Haus, das verschwindet
Am Ende ist das Cliff House in Big Sur kein „Objekt“, sondern eine Erfahrung. Wer es betritt, spürt, dass die Grenzen zwischen Natur und Architektur verwischen. Das Haus verschwindet – nicht im Sinne von Unsichtbarkeit, sondern im Sinne von Harmonie.
Es wird eins mit dem Ort, so wie sich Land und Meer hier schon immer begegneten. Und genau das ist die höchste Form von Architektur: nicht etwas Neues zu schaffen, sondern etwas, das schon immer da war, sichtbar zu machen.
Big Sur Cliff House: Architektur, die mit der Natur verschmilzt
Lupe Fiasco – „Samurai DX“: Ein Nachschlag für Eingeweihte und Neugierige 26 Aug 1:38 AM (last month)
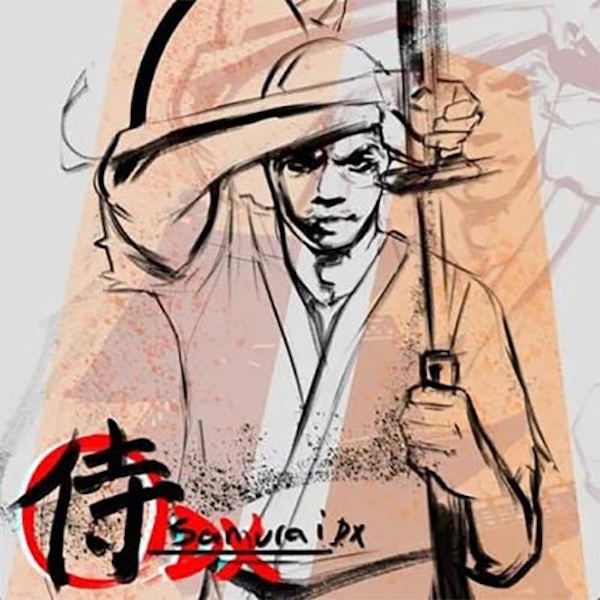
Lupe Fiasco ist bekannt dafür, lyrische Komplexität mit innovativen Konzepten zu verbinden. Mit der EP Samurai DX setzt der Chicagoer Rapper Lupe Fiasco nun die Reise fort, die er im Sommer 2024 mit dem gefeierten Album Samurai begonnen hat. Die neue Veröffentlichung fühlt sich an wie eine zweite Ebene desselben Projekts: vertraut, aber erweitert, mit dem Ziel, neue Perspektiven auf bereits bekannte Songs zu eröffnen.
Während Samurai als achtteilige Sammlung bewusst kompakt und verdichtet angelegt war, bietet Samurai DX Raum für Verfeinerung. Lupe Fiasco versteht dieses Format als Chance, bestimmte Ideen neu zu arrangieren und zugleich mit frischen Impulsen zu bereichern. Dadurch wirkt die EP wie eine Brücke: Sie hält einerseits die Intensität des Originals aufrecht, öffnet sich aber gleichzeitig für ein Publikum, das mit dem Erstkontakt vielleicht überfordert war.
Lupe Fiasco x Samurai DX – Vertraute Stücke in neuem Gewand
Kern der EP sind Neuinterpretationen von „Samurai“, „Palaces“ und „Bigfoot“. Alle drei Songs werden nun in Zusammenarbeit mit dem Sänger und Songwriter Troy Tyler präsentiert, der schon während der Tour als Support-Act in Erscheinung trat. Lupe hat die Produktionen so angepasst, dass Tylers Stimme nicht nur Akzente setzt, sondern das Klangbild entscheidend formt.
Die neuen Versionen bewegen sich stärker in Richtung R&B. Rhythmus und Groove treten in den Vordergrund, wodurch die dichten Textschichten leichter zugänglich werden. Besonders im zweiten Teil der EP zeigt sich diese Öffnung deutlich: Wo das ursprüngliche Album noch kantig und anspruchsvoll wirkte, entfaltet Samurai DX eine geschmeidige Energie, die sofort ins Ohr geht.
Zwei frische Songs: High Note & SOS
Neben den überarbeiteten Stücken enthält die EP zwei neue Aufnahmen. „High Note“ mit Luv Moore eröffnet das Projekt und überzeugt mit einem warmen, melodischen Ansatz. Der Track vereint Lupe Fiascos pointierte Reimtechnik mit Moores souligen Vocals – eine Kombination, die der EP direkt eine einladende Note verleiht.
„SOS“ hingegen entstand in Eigenregie und unterstreicht, dass Lupe auch als Produzent ein klares Gespür für Atmosphäre besitzt. Der Song trägt einen entschleunigten Vibe, ohne dabei an Schärfe im Text zu verlieren. Gerade in dieser Balance aus ruhiger Produktion und messerscharfer Sprache liegt die Stärke des Projekts.
Samurai DX als Türöffner
Während Samurai von vielen Kritikern als eines der lyrisch dichtesten Werke in Lupes Karriere eingeordnet wurde, empfanden einige Hörer den Zugang als zu fordernd. Mit Samurai DX liefert er einen alternativen Zugang. Wer bisher Berührungsängste hatte, bekommt hier die Gelegenheit, über die R&B-geprägten Neuansätze einen weicheren Einstieg zu finden.
Gleichzeitig bleibt die Essenz des Originals erhalten: Lupe Fiasco rappt mit Präzision, Nachdruck und Intelligenz. Die EP macht deutlich, dass er sich in einer Phase befindet, die zwar unterschätzt wird, aber zu den stärksten seines Schaffens zählt. Mit dieser Veröffentlichung verknüpft er Kunstfertigkeit und Zugänglichkeit auf eine Weise, die Fans wie Neueinsteiger gleichermaßen anspricht.
Fazit | tl;dr
Samurai DX ist kein bloßes Anhängsel, sondern eine durchdachte Erweiterung. Lupe Fiasco zeigt, dass selbst die komplexesten Werke Platz für neue Lesarten haben. Die EP öffnet Türen, ohne den Anspruch zu senken. Wer die Herausforderung von Samurai bereits schätzte, findet hier spannende Variationen. Wer damals zögerte, entdeckt nun eine zugänglichere Version desselben Universums.
Damit setzt Lupe Fiasco seinen Samurai-Run konsequent fort – und beweist erneut, dass er einer der wenigen Rapper ist, die es verstehen, Innovation und Tradition mühelos zu vereinen.
Lupe Fiasco – „Samurai DX“ EP // Spotify:
Lupe Fiasco – „Samurai DX“ EP // apple Music:
Von der Physik zur Spiritualität: Tom Campbell über Bewusstsein, Liebe und Lebenssinn 25 Aug 5:16 AM (last month)

Tom Campbell, ehemaliger Kernphysiker, hat etwas gewagt, das in der Wissenschaft oft für Stirnrunzeln sorgt: Er verbindet Physik, Philosophie und Spiritualität/Bewusstsein zu einer „Theory of Everything“. Der zentrale Gedanke: Bewusstsein ist nicht nur ein Nebenprodukt des Gehirns, sondern die Grundlage aller Realität. Diese radikale Sichtweise entstand nicht am Schreibtisch, sondern aus persönlichen Erfahrungen – Meditation, außerkörperliche Zustände und Jahre der Arbeit mit Bob Monroe führten Campbell Schritt für Schritt zu einem Modell, das Wissenschaft und Mystik zusammenführt.
Sein Ansatz ist logisch aufgebaut: Er beginnt mit einer einzigen Annahme – Bewusstsein existiert – und leitet daraus ab, wie Realität funktioniert. Dabei rückt er das Bild einer virtuellen Realität ins Zentrum: Unsere Welt sei wie eine hochkomplexe Simulation, in der wir uns als „Avatare“ bewegen.
Tom Campbell: Bewusstsein als Informationssystem
Campbells Modell beschreibt im Podcast (Youtube) Bewusstsein als ein System von Information. Der kleinste Baustein ist ein „Bewusstseins-Zellchen“, das Entscheidungen zwischen A und B, Null und Eins treffen kann. Mit der Fähigkeit zu erinnern und zu verknüpfen entstehen Muster, aus denen Ordnung und schließlich Mathematik hervorgehen.
Dieses System entwickelt sich, indem es Entropie verringert – sprich: indem es Unordnung in Struktur verwandelt. Das Ziel: mehr Kohärenz, mehr Sinn, mehr Liebe. Campbell zieht hier eine direkte Linie: Niedrige Entropie bedeutet Liebe und Kooperation, hohe Entropie bedeutet Angst und Trennung. Damit verknüpft er physikalische Konzepte mit den ältesten spirituellen Lehren.
Die virtuelle Realität des Lebens
Die physische Welt ist für Campbell nichts anderes als eine Simulation. Vergleichbar mit einem Computerspiel existieren zwei Ebenen: das „Rendering“ durch das Bewusstsein und der Spieler selbst – also wir als Einheiten von Bewusstsein. Unser Körper ist demnach ein Avatar, gesteuert von einem nicht-physischen Kern.
Diese Perspektive erklärt viele Rätsel der modernen Physik: Warum ist Lichtgeschwindigkeit konstant? Warum scheint die Realität auf Wahrscheinlichkeiten zu beruhen? Für Campbell liegt die Antwort darin, dass das Universum informationbasiert ist – ein Programm, das aus Regeln und Wahrscheinlichkeiten besteht.
Tom Campbell über Bewusstsein – Evolution durch Liebe
Die entscheidende Frage lautet: Wozu das alles? Campbell sagt klar: Der Sinn des Lebens ist, „Liebe zu werden“. Die virtuelle Realität dient als Trainingsfeld, in dem wir durch freie Entscheidungen unsere Bewusstseinsqualität verbessern können. Handeln wir aus Angst, verengen wir uns und erhöhen die Entropie. Handeln wir aus Liebe, erweitern wir uns und entwickeln uns weiter.
Diese Sichtweise ist praktisch: Jeder kann prüfen, wie oft er von negativen Gefühlen getrieben wird – Ärger, Misstrauen, Groll. Weniger davon bedeutet mehr Wachstum. Glück entsteht nicht durch Kontrolle äußerer Umstände, sondern durch die innere Haltung, mit der wir auf sie reagieren.
Von mystischer Erfahrung zur Wissenschaft
Campbells Weg zu dieser Theorie war untypisch für einen Physiker. Schon während seines Studiums nutzte er Meditation, um komplexe Probleme zu lösen. Er bemerkte, dass er Zugang zu Informationen hatte, die ihm nicht durch den Intellekt zugänglich sein konnten – ein erstes Fenster zu dem, was er später als „Datenbanken des Bewusstseins“ bezeichnete.
Mit Bob Monroe trainierte er außerkörperliche Erfahrungen, erforschte Heilung durch Intention und entwickelte Methoden, diese Erlebnisse wiederholbar und überprüfbar zu machen. Für ihn war das kein esoterisches Spiel, sondern ein wissenschaftlicher Prozess: Hypothesen aufstellen, Experimente durchführen, Ergebnisse vergleichen. Über Jahrzehnte fügte er Puzzlestücke zusammen, bis sich ein konsistentes Modell ergab.
Praktische Werkzeuge für den Alltag
Doch Campbell bleibt nicht im Abstrakten. Er betont, dass jeder sein Bewusstsein direkt erforschen kann. Meditation ist ein klassischer Einstieg, aber nicht der einzige. Wer Schwierigkeiten hat, den Geist zu beruhigen, kann mit aktiver Imagination arbeiten. Wichtig ist nur, die Aufmerksamkeit vom Außen ins Innere zu lenken.
Zwei Fragen helfen auf dem Weg:
- Handle ich aus Angst oder aus Liebe?
- Verkleinere oder vergrößere ich durch meine Entscheidungen die Entropie?
Wer sich konsequent an diesen Leitlinien orientiert, erlebt laut Campbell mehr Leichtigkeit, weniger negative Emotionen und eine wachsende innere Freiheit.
Eine neue Perspektive auf Sinn und Realität
Tom Campbells Modell stellt nicht nur die Wissenschaft, sondern auch unseren Alltag auf den Kopf. Es ist eine Einladung, das Leben als „Entropie-Reduktions-Training“ zu begreifen, in dem jeder Moment Gelegenheit bietet, bewusster zu werden. Und es schlägt eine Brücke zwischen den großen Traditionen – von Buddha bis zu modernen Physikern – die letztlich alle auf eine Wahrheit hinauslaufen: Wir sind Teile eines großen Bewusstseins, das sich selbst erfährt.
Das Ziel ist weder mysteriös noch unerreichbar. Es lautet schlicht: wachsen, lernen, lieben. Wer diesen Weg geht, findet laut Campbell nicht nur die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, sondern erfährt auch, dass Glück und Frieden kein Zufall, sondern das natürliche Resultat bewusster Entwicklung sind.
Von der Physik zur Spiritualität: Tom Campbell über Bewusstsein, Liebe und Lebenssinn
Earl Sweatshirt – „Live Laugh Love“: Zwischen Vaterschaft und Verfremdung 25 Aug 2:27 AM (last month)

Schon die Veröffentlichung von „Live Laugh Love“, dem sechsten Album von Earl Sweatshirt, verlief ganz im Sinne seines eigenwilligen Werdegangs. Die Release-Party ließ viele ratlos zurück. Gäste glaubten, Vince Staples, Donald Glover oder gar Dave Chappelle hätten Features beigesteuert. Tatsächlich waren alle drei nur am begleitenden Fanzine beteiligt. Dazu trat ein Performer mit dem Namen Gary Underpants auf, der Earl-Songs nachahmte – ein absurder Moment, der Fans und Medien gleichermaßen verwirrte. War es eine echte Feier oder nur ein elaborierter Scherz? Bei Earl Sweatshirt überrascht kaum noch etwas.
Schon beim Vorgänger „Voir Dire“ bewies er seine Liebe zu Geheimniskrämerei. Das Projekt war drei Jahre lang unerkannt auf YouTube hochgeladen, bevor Produzent The Alchemist es offiziell machte. Diese Art des Spiels mit Erwartungen ist typisch für einen Künstler, der seit seinen Anfängen im Odd Future-Kollektiv konsequent den abseitigen Weg bevorzugt.
Earl Sweatshirt x Live Laugh Love – Von Odd Future zum „Otherground“
Anfangs galt Earl als größtes lyrisches Talent innerhalb von Odd Future. Sein Debütmixtape „Earl“ schockierte mit drastischen Inhalten, zeigte aber zugleich ein selten präzises technisches Können. Während Tyler, The Creator die Brücke zum Mainstream schlug, zog sich Earl in eine experimentelle Welt zurück. Die Alben „I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside“ und „Some Rap Songs“ machten deutlich: hier spricht ein Rapper, der lieber avantgardistische Lo-Fi-Collagen baut, statt nach Radioplay zu schielen.
„Live Laugh Love“ knüpft an diese Linie an, bleibt jedoch zugänglicher als manch früheres Werk. Es gibt wiederkehrende Hooks, eingängige Samples und Strukturen, die nicht völlig ins Chaos zerfallen. Stücke wie „Forge“ oder „Exhaust“ fesseln mit Ohrwurmmotiven, auch wenn ihre Herkunft bewusst verschleiert wirkt.
Zwischen düsteren Beats und neuem Sonnenlicht
Der vielleicht größte Unterschied liegt in der Stimmung. Earl ist Vater geworden, und diese neue Rolle färbt auf seine Texte ab. Auf „Gamma“ rappt er: „Everybody love the sunshine / Shine like the boy Roy Ayers say“, ein klares Signal einer helleren Grundhaltung. Besonders bewegend ist „Tourmaline“, ein Stück für seine Tochter, das mit Streicherschleifen Wärme erzeugt – allerdings immer wieder durch Husten, Verzerrungen und schräge Einsprengsel gebrochen.
Diese Balance aus Liebe und Dissonanz zieht sich durchs gesamte Album. So scheint Earl zwar das Licht zu feiern, weigert sich aber, es unverfälscht stehenzulassen. Seine Realität bleibt fragmentiert, widersprüchlich und kantig.
Earl Sweatshirt x Live Laugh Love – Struktur als Irritation
Der Einstieg „GSW vs Sac“ wirkt wie ein improvisiertes Geflecht aus weiblichem Gesang, lockerem Rap und plötzlichen Abbrüchen. Kaum zwei Minuten lang, wechselt der Song abrupt in eine gesprochene Passage, bevor er ins Nichts fällt. Auch „Live“ verändert mitten im Song das Tempo, lässt Synthesizer stottern und zwingt Earl, seinen Flow spontan zu verschieben. Diese Brüche machen klar: klassische Songstrukturen sind hier fehl am Platz.
Gleichzeitig entsteht eine Sogwirkung. „Crisco“ vereint halsbrecherisches Rappen mit manipulierten Chorstimmen, die sich um das Ohr winden wie ein Traum, den man nicht ganz greifen kann. Wer sich auf diese Logik einlässt, erlebt eine dichte, wenn auch nur 25 Minuten kurze Klangreise.
Fazit: Ein Album wie ein Paralleluniversum
„Live Laugh Love“ zeigt Earl Sweatshirt als Künstler, der sich bewusst außerhalb des Mainstreams bewegt. Seine Musik ist weder einfach noch glatt, sondern eine Einladung, in ein Paralleluniversum einzutauchen. Dort herrschen andere Regeln, dort tauchen Doppelgänger wie Gary Underpants auf, dort verschwimmen Beats und Emotionen.
Gleichzeitig klingt ein neuer, fast heiterer Unterton durch, der mit seiner Vaterschaft verknüpft scheint. Gerade diese Mischung aus Wärme und Verfremdung macht das Album so spannend. Man muss nicht dauerhaft in Earls Welt leben, doch ein Besuch lohnt sich. Denn die Aussicht, so bizarr sie wirken mag, ist schlicht faszinierend.
Earl Sweatshirt – „Live Laugh Love“ // Spotify Stream:
Earl Sweatshirt – „Live Laugh Love“ // apple Music Stream:
Die ersten Philosophen: Als sich das Denken für immer veränderte 22 Aug 5:42 AM (2 months ago)
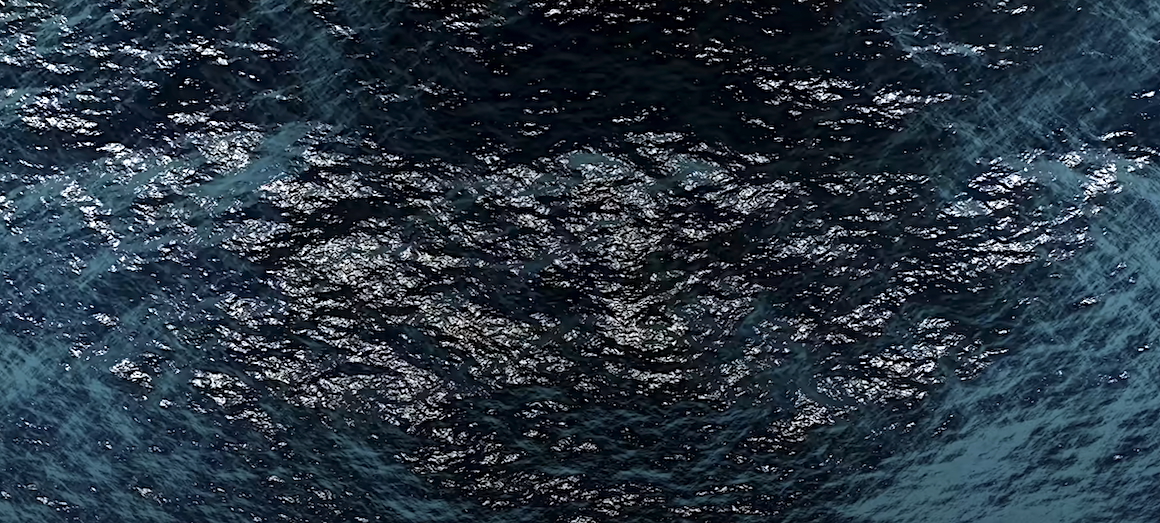
Stellen wir uns eine Welt vor, in der Geschichten alles erklären. Die Sonne wird als Gott verehrt, das Meer als Reich von Nymphen und Ungeheuern betrachtet, und Stürme gelten als göttliche Strafen. Für die Menschen der Antike war das selbstverständlich. Doch irgendwann begann eine kleine Gruppe von Denkern, diese Erklärungen infrage zu stellen, sie waren die ersten Philosophen. Sie wollten die Welt nicht länger über Mythen verstehen, sondern über Prinzipien, die ohne menschliche Fantasie auskamen. Mit diesem Schritt begann eine Revolution des Denkens: die Geburt der Philosophie.
Die Welt der Vorsokratiker
Heute nennen wir diese frühen Denker die Vorsokratiker. Sie sind weniger bekannt als Sokrates oder Aristoteles, doch ohne sie wäre die gesamte westliche Philosophie nicht denkbar. Sie suchten nach Antworten auf fundamentale Fragen: Wie funktioniert das Universum? Gibt es eine ursprüngliche Substanz, aus der alles hervorgeht? Und wie können wir Wissen überhaupt erlangen?
Ihre Suche markierte den Übergang vom Mythos zum Logos – vom Erzählen göttlicher Geschichten zur Begründung durch Beobachtung und Vernunft.
Die ersten Philosophen – Ionia – Wiege des Denkens
Die ersten Philosophen wirkten im sechsten Jahrhundert vor Christus in Ionia, einer griechischen Kolonie an der Küste Kleinasiens, im heutigen Westen der Türkei. Besonders Milet wurde zu einem Zentrum dieser neuen Denkschule. Durch regen Handel kamen dort nicht nur Waren, sondern auch Ideen aus fremden Kulturen an. Diese Offenheit schuf ein Umfeld, in dem alte Mythen leichter hinterfragt werden konnten.
Statt göttliche Willkür als Erklärung für Naturphänomene hinzunehmen, begannen die Milesier, nach rationalen Ursachen zu suchen. Ausgerechnet in einer Zeit, in der Opfer, Rituale und Tempel das Leben bestimmten, stellten sie die entscheidende Frage: Was, wenn all das nicht stimmt?
Mythen und ihre Grenzen
Die Griechen lebten in einer Welt voller Götter. Homer und Hesiod hatten ihre Geschichten gesammelt und systematisiert. Die Ilias und die Odyssee zeigten ein Universum, in dem göttliche Launen über Krieg und Schicksal entschieden. Hesiods Theogonie erklärte die Herkunft der Götter und ordnete das Chaos der Mythen. Doch je klarer diese Texte wurden, desto offensichtlicher war auch die Schwäche des Systems: Götter waren launisch, unberechenbar und menschlich in ihren Fehlern. Wer kritisch dachte, musste erkennen, dass diese Erklärungsmuster mehr Verwirrung als Klarheit boten.
Der Mut, anders zu denken
Die Vorsokratiker wagten den Bruch. Thales von Milet erklärte, dass alles aus Wasser entstehe. Sein Schüler Anaximander sprach vom „Apeiron“, einem grenzenlosen Urstoff, während Anaximenes die Luft als Ursprung allen Seins sah. Später folgten Denker wie Heraklit, der den ständigen Wandel betonte, und Parmenides, der das Sein selbst als unveränderlich erklärte.
Ihre Thesen mögen aus heutiger Sicht naiv wirken, doch entscheidend war nicht die Richtigkeit, sondern die Methode. Zum ersten Mal wurde versucht, die Welt mit logischen Überlegungen zu erklären. An die Stelle von Mythen trat ein Denken, das Ursachen in der Natur selbst suchte.
Die ersten Philosophen – Der Übergang von Mythos zu Logos
Dieser Übergang war gewaltig. Jahrtausende lang hatten Mythen das menschliche Bedürfnis nach Sinn gestillt. Doch nun gab es eine Alternative: das Denken in Prinzipien, das Hinterfragen und Überprüfen. Philosophie entstand aus dem Mut, Geschichten loszulassen und sich der Unsicherheit zu stellen. Die Vorsokratiker schufen damit das Fundament für alles, was später folgte. Ohne ihre ersten Schritte hätten weder Sokrates noch Plato oder Aristoteles die großen Systeme entwickeln können, die unser Denken bis heute prägen.
Warum es heute noch wichtig ist
Die Geschichten der Vorsokratiker erinnern uns daran, dass Fortschritt immer mit Zweifel beginnt. Sie zeigten, dass es legitim ist, vertraute Erzählungen infrage zu stellen und neue Antworten zu suchen. Gerade in einer Zeit, in der Mythen und Ideologien wieder großen Einfluss gewinnen, ist dieser Impuls aktueller denn je.
Philosophie begann mit einem einfachen, aber radikalen Akt: der Weigerung, einfache Geschichten als Wahrheit zu akzeptieren. Dieses Erbe bleibt bis heute die Grundlage jeder ernsthaften Suche nach Wissen.
Als sich das Denken für immer veränderte – Die ersten Philosophen
Ghostface Killah – „Supreme Clientele 2“: Erinnerung, Handwerk und die Kunst der Langlebigkeit 22 Aug 12:57 AM (2 months ago)

Wenn Ghostface Killah ein neues Album ankündigt, horcht die Szene auf. Mit Supreme Clientele 2 wagt er etwas, das viele Künstler scheuen: Er setzt ein Denkmal nicht fort, um es zu kopieren, sondern um es neu zu deuten. Schon im Vorfeld erklärte er, dass das Original von 2000 kein Moment sei, den man nachstellen könne, sondern ein „frame of mind“. Dieses Kopfkino wollte er erneut betreten, indem er alte Skizzen, vergessene Verse und brachliegende Beats aus den Archiven holte.
So entstand ein Album, das nicht nach Nostalgie klingt, sondern wie ein bewusstes Spiel mit Erinnerungen. Ghostface zeigt sich dabei nicht als Veteran, der um Relevanz ringt, sondern als Künstler, der weiß, dass sein Stil zeitlos ist.
Ghostface Killah x Supreme Clientele 2 – Von der Legende zum Projekt der Legenden
Dass dieses Album gerade jetzt erscheint, liegt auch am „Legend Has It“-Programm von Mass Appeal. Unter dem Banner werden sieben Ikonen des Rap geehrt, darunter Slick Rick, De La Soul oder Raekwon. Ghostface fügt sich hier nahtlos ein. Für ihn bedeutet die Kampagne, nicht als bloßes Relikt gesehen zu werden, sondern als aktiver Erzähler seiner eigenen Geschichte.
Mit Produzent Scram Jones ging er tief in alte Sessions und erschuf einen Sound, der vertraut wirkt, ohne altbacken zu klingen. Statt auf trendige Trap-Beats setzt er auf soulgetränkte Loops, kantige Drums und Samples, die wie Polaroids aus einer anderen Zeit wirken.
Sprachbilder zwischen Straße und Fantasie
Das Herzstück bleibt Ghostfaces Stimme: nasal, drängend, voller Bilder. Auf „Ironman“ eröffnet Redman, bevor Ghost seine Slang-Salven abfeuert. Er verknüpft Luxusmarken mit Martial-Arts-Referenzen, um das Chaos der Straße greifbar zu machen. „4th Disciple“ wiederum ist eine düstere Erzählung voller Trauer, in der Ghost den Tod eines Freundes mit der Metapher eines „VCR ohne Strom“ beschreibt – altmodisch, aber eindringlich.
Tracks wie „Windows“ oder „The Zoom“ zeigen seine Fähigkeit, äußeren Glanz mit innerer Verletzlichkeit zu verknüpfen. Schmuck und Designer-Labels sind bei ihm nie nur Statussymbole, sondern Projektionsflächen für Sehnsucht und Schmerz.
Ghostface Killah x Supreme Clientele 2 – Historische Verweise und neue Energie
Auf „Rap Kingpin“ schlägt Ghostface die Brücke zurück zum Klassiker. Das Sample aus Eric B. & Rakims „My Melody“ trifft auf Elemente aus „Mighty Healthy“, einem Herzstück des ersten Supreme Clientele. So schafft er eine Verbindung zwischen damals und heute.
Doch SC2 bleibt nicht im Museum stehen. Features wie Nas, M.O.P., Styles P oder Conway the Machine verleihen dem Album zusätzliche Facetten. Nas glänzt auf „Love Me Anymore“ mit nachdenklicher Melancholie, während M.O.P. das brachiale Element liefert. GZA, Raekwon und Method Man sorgen für vertrauten Wu-Spirit, ohne dass es sich wie ein reines Wiedersehenstreffen anfühlt.
Kein Abklatsch, sondern eine Reflexion
Wichtig ist die Erkenntnis: Dieses Album will gar nicht besser sein als das Original. Supreme Clientele von 2000 bleibt unantastbar, ein Eckpfeiler der Wu-Tang-Solo-Diskografie. Doch SC2 ist kein schwacher Schatten, sondern eine Reflektion über Zeit, Veränderung und das eigene Erbe. Ghostface Killah zeigt, dass Rap nicht nur jung und schnell sein muss, sondern auch gereift, vielschichtig und voller Geschichte sein kann.
Die Samples klingen vertraut, die Stimme bleibt unverkennbar, doch die Perspektive hat sich verschoben. Mit über fünfzig blickt Ghostface auf das Leben zurück – mit Humor, Schmerz, Wut und Würde.
Fazit: Ein Album über Erinnerung und Langlebigkeit
Supreme Clientele 2 ist weniger ein Album für Charts als ein Manifest für Beständigkeit. Es beweist, dass Hip-Hop auch nach Jahrzehnten wachsen kann, ohne sich zu verbiegen. Ghostface Killah hat kein Denkmal beschädigt, sondern eine neue Schicht auf ein altes Fundament gelegt.
Erinnerung und Gegenwart verschmelzen hier zu einem Werk, das zeigt, wie Rap aus Archiven, aus Narben und aus jahrzehntelanger Übung lebt. Wer nach Innovation sucht, findet sie nicht in Effekten oder Trends, sondern in der Fähigkeit, das Alte mit neuem Atem zu versehen.
Ghostface Killah – „Supreme Clientele 2“ // Spotify Stream:
Ghostface Killah – „Supreme Clientele 2“ // apple Music Stream:
Wenn dein Haustier geht: Trost und Erkenntnisse für Hundebesitzer // Peter Crone 21 Aug 6:28 AM (2 months ago)

Wenn ein geliebtes Haustier alt wird, rückt der Gedanke an Abschied und Verlust unausweichlich näher. Im Video „Trauer um das Ende des Lebens Ihres Haustiers“ begleitet Peter Crone eine Frau, die ihre beiden Hunde auf einer letzten Reise quer durch Amerika mitnimmt. Dabei geht es nicht nur um die Angst vor dem Tod der Tiere, sondern um viel tiefere Fragen: Wer bin ich ohne sie? Was bleibt, wenn die Begleiter gehen, die mein halbes Leben an meiner Seite waren? Dieser Beitrag bietet Trost für Hundebesitzer, die den Abschied von ihrem Tier fürchten.
Mehr als nur Haustiere
Die Hunde dieser Frau sind keine einfachen Haustiere. Sie sind Familie, Identität und Rettungsanker in einem. Sie hat mit ihnen gelebt, geliebt und gelernt, was bedingungslose Zuneigung bedeutet. Als einer der beiden Hunde mit Nierenversagen diagnostiziert wurde, entschloss sie sich, die verbleibende Zeit nicht im Stillstand, sondern auf einem „Celebration of Life“-Roadtrip zu verbringen.
Doch der Schmerz ist schon jetzt präsent. Es ist nicht nur Trauer über das nahende Ende, sondern auch Angst vor Leere. Crone spürt schnell, dass hinter der Sorge um die Hunde eine alte Wunde steckt – das Gefühl, als Kind nicht gewollt zu sein.
Projektion von Liebe
Peter Crone macht deutlich, dass die Trauer hier eine tiefere Dimension hat. Die Hunde sind Träger einer Geschichte, die viel früher begann. Sie stehen für Geborgenheit, für Akzeptanz, für ein bedingungsloses „Ja“ in einer Welt, die dieses Gefühl einst verwehrte.
Die Frau hat ihre Liebe so stark in diese Tiere gelegt, dass ihr Verlust wie das Ende der eigenen Fähigkeit zu lieben erscheint. Für Crone ist das eine Illusion. Denn was die Hunde spiegeln, ist keine Liebe, die von außen kommt, sondern die Liebe, die längst in ihr selbst lebt.
Trost für Hundebesitzer – Die eigentliche Quelle
Crone erinnert daran, dass Menschen ihre Realität aus inneren Überzeugungen erschaffen. Wer sich selbst als „nicht gewollt“ erlebt, wird immer wieder Zurückweisung und Verlust erfahren. Die Hunde haben diese Leerstelle gefüllt. Doch ihr bevorstehender Abschied zwingt dazu, auf die wahre Quelle zu schauen: die eigene innere Liebe.
„Du bist Liebe personifiziert“, sagt Crone. Die Tiere haben nur den Raum geöffnet, in dem diese Wahrheit sichtbar wurde. Ihr Tod bedeutet nicht das Ende der Liebe, sondern eine Einladung, sie breiter zu teilen – mit der Welt und mit Menschen, die davon ebenso profitieren könnten.
Zwischen Schmerz und Chance
Crone verharmlost den Verlust nicht. Er erkennt an, dass die Verbindung zu Tieren einzigartig ist. Doch er zeigt gleichzeitig, dass der Schmerz nicht allein vom Tod der Hunde stammt, sondern vom Wiederaufleben alter Geschichten. Der Gedanke, wieder allein durch das Leben gehen zu müssen, ist das eigentliche Trauma.
Wer diesen Moment nutzt, kann wachsen. Die Liebe, die den Hunden galt, kann sich ausdehnen. Statt als Gefängnis von Verlust kann sie zur Quelle von Verbundenheit werden – auch über die Beziehung zu Tieren hinaus.
Abschied als Neubeginn
So wird der Roadtrip nicht nur zur letzten großen Reise der Hunde, sondern auch zu einem inneren Aufbruch. Crone lädt die Frau ein, ihre Liebe nicht länger an die Anwesenheit der Tiere zu binden, sondern sie als das zu erkennen, was sie wirklich ist: grenzenlos und unzerstörbar.
Der Tod der Hunde wird kommen. Doch er ist nicht das Ende der Liebe. Er ist eine Erinnerung daran, dass Liebe in uns entsteht – und dass sie weitergegeben werden kann, wenn wir uns trauen, sie zu öffnen.
Fazit | tl;dr
Peter Crone macht klar: Hinter der Trauer um ein sterbendes Haustier steckt oft mehr als bloßer Verlust. Es sind die Geschichten unserer Vergangenheit, die durch den Abschied erneut aufbrechen. Doch gerade darin liegt eine Chance. Wer erkennt, dass Liebe nicht verloren geht, sondern immer Teil des eigenen Wesens ist, kann aus Schmerz einen Neubeginn machen – für sich selbst und für die Welt.
Wenn dein Haustier geht: Trost und Erkenntnisse für Hundebesitzer // Peter Crone:
Stop-and-Go: Wie man Samples in klassische Beats verwandelt // DJ Premier 21 Aug 12:33 AM (2 months ago)

Sampling ist das Herzstück des Hip-Hop. Doch viele Produzenten bleiben bei denselben simplen Methoden hängen. Das Ergebnis: austauschbare Beats ohne Tiefe. Wer jedoch wie die großen Pioniere auffallen will, muss sein Handwerk verfeinern. Genau darum geht es im Video „Use THIS to Flip Samples into CLASSIC Beats“. Im Zentrum steht die Stop-and-Go-Methode, ein Ansatz, den Legenden wie DJ Premier genutzt haben, um ikonische Tracks zu erschaffen. Stop-and-Go: Wie man Samples in klassische Beats verwandelt.
Warum Drums zuerst entscheidend sind
DJ Premier arbeitet bei fast allen Produktionen nach demselben Muster: Zuerst entstehen die Drums, dann der Rest. Das klingt unspektakulär, doch es hat entscheidende Vorteile. Ein dichter, voller Drumloop bildet die Grundlage, auf der später das Sample zum Leben erwacht. Ohne diesen Rhythmus fehlt Orientierung, die Beats wirken leer. Das Video betont, dass Premier auf satte, farbenreiche Drums setzt, die genug Raum lassen, damit die Samples ihre Wirkung entfalten.
Wie man Samples in klassische Beats verwandelt – Die Magie der Sample-Auswahl
Premier ist berühmt dafür, aus den unterschiedlichsten Quellen Inspiration zu ziehen: Jazz, Soul, Spoken Word oder sogar Fusion. So nutzte er für „Nas Is Like“ ein religiöses Sprachsample, für „You Know My Steez“ einen Soul-Gitarrenpart und für „Ten Crack Commandments“ jazzige Synthesizer. Entscheidend ist dabei nicht die Herkunft, sondern die Behandlung des Materials. Und genau hier kommt die Stop-and-Go-Technik ins Spiel.
Stop-and-Go: Das Geheimnis im Detail
Das Prinzip ist simpel und doch revolutionär: Statt das Sample durchgehend laufen zu lassen, setzt man gezielte Pausen. Man schneidet einzelne Noten oder Klänge – zum Beispiel Harfen, Gitarren oder Keys – und baut daraus neue Patterns. Zwischen diese Fragmente setzt man bewusst Stille. Dadurch entsteht ein Rhythmus, der sich vom Original löst und eine eigene Dynamik entfaltet.
So hört man bei „Nas Is Like“, wie Premier kurze Stops zwischen den Harfen-Schnipseln platziert. In „You Know My Steez“ wird die Gitarre stakkatoartig zerlegt, immer wieder unterbrochen von kleinen Pausen. Und bei „Ten Crack Commandments“ erreicht die Technik ihren Höhepunkt: Lange Lücken, gefüllt mit markanten Scratches, lassen den Beat fast atmen.
Den Beat auffüllen: Mehr als nur Chops
Wer mit Stop-and-Go arbeitet, stößt schnell auf ein Problem: Die Lücken können den Track leer wirken lassen. Hier kommen Zusatz-Elemente ins Spiel – Basslines, Effekte oder Scratches. Premier nutzte diese Bausteine meisterhaft. Während er bei „Nas Is Like“ einen tiefen Basslauf einfügte, setzte er bei „Ten Crack Commandments“ auf Cuts, die die Energie hochhielten.
Das Video zeigt zudem, wie Tools wie Note Grabber helfen, passende Noten im Sample zu erkennen. Damit lassen sich Basslines oder zusätzliche Melodien komponieren, die perfekt harmonieren. Das macht die Beats nicht nur dichter, sondern auch musikalisch runder.
Warum diese Methode zeitlos bleibt
Die Stop-and-Go-Methode zeigt, dass Sampling weit mehr ist als simples Loopen. Sie zwingt den Produzenten, aktiv mit Rhythmus und Raum zu arbeiten. So entstehen Beats, die sofort Charakter haben und eine eigene Handschrift tragen. Genau deswegen klingen Premiers Klassiker noch heute frisch.
Das Video verdeutlicht: Wer Beats bauen will, die aus der Masse herausstechen, muss bewusst mit Lücken, Akzenten und Ergänzungen arbeiten. Stop-and-Go ist dafür ein kraftvolles Werkzeug – egal ob im Boom-Bap, Trap oder modernen Hybrid-Sound.
Stop-and-Go: Wie man Samples in klassische Beats verwandelt
Kawakawa House: Architektur als poetische Verbindung von Mensch und Natur 20 Aug 6:02 AM (2 months ago)

An der wilden Westküste von Auckland erhebt sich das Kawakawa House wie ein stilles Gedicht an die Natur. Entworfen von Herbst Architects, liegt das Kawakawa House am Fuß eines Berghangs mit Blick auf den Piha Beach (war ich 10/2013). Diese Küste ist rau, geprägt von schwarzem Sand, kalten Südwestwinden und der ungezähmten Tasmansee. Entlang der Strände stehen Pohutukawa-Bäume, deren verwundene Formen Schutz vor dem Wind bieten. Genau hier setzt das Haus an, nicht als Fremdkörper, sondern als harmonische Ergänzung. Architekt Lance Herbst beschreibt es als „Liebesbrief an die Natur“.
Kawakawa House – Vom Standort inspiriert
Das Gelände war ursprünglich mit einem alten Gebäude bebaut, doch der Rest wurde von Pohutukawa-Wald dominiert, der in Neuseeland streng geschützt ist. Ein Neubau musste also Rücksicht nehmen. Statt den Boden massiv zu beanspruchen, hoben die Architekten das Haus über Stelzen an. So bleibt der natürliche Untergrund unangetastet, während der Blick ins Blätterdach gelenkt wird. „Alles dreht sich um die Bäume“, erklärt Herbst. Die Idee war nicht, den Strand zu inszenieren, sondern den Dialog mit dem Wald zu führen. Dadurch wirkt das Gebäude eher wie ein Pavillon als ein abgeschlossenes Haus.



Ein Rundgang durch das Kawakawa House
Wer das Grundstück betritt, fährt zunächst unter das Gebäude. Von dort führt eine Wendeltreppe nach oben, wo sich sofort ein Innenhof öffnet. Dieser Hof ist das Herz des Grundrisses und zugleich Rückzugsort bei starkem Westwind. Die umliegenden Glasflächen lassen Licht in alle Räume und öffnen zugleich den Blick zur Natur. Küche, Wohn- und Essbereich sind so ausgerichtet, dass sie stets die Küste im Blick behalten. Schlafzimmer und Bäder liegen im hinteren Teil, bleiben aber ebenfalls mit dem Wald verbunden. Der Grundriss lebt von Offenheit, Zirkulation und dem ständigen Wechsel zwischen Innen und Außen.
Materialien als Spiegel der Umgebung
Die äußere Gestaltung folgt einem klaren Prinzip: schwarzes Zedernholz und Glas dominieren. Die dunkle Färbung ahmt die Rinde der Bäume nach, wodurch das Haus in der Landschaft fast verschwindet. Ergänzt wird dies durch Stahl im Sockel und Glasflächen, die das Licht brechen. Im Inneren herrschen natürliche Töne. Birkensperrholz sorgt für helle Wärme, während Spotted-Gum-Böden Stabilität verleihen. Radiata-Holz und strukturierte Oberflächen bringen Rhythmus in die Räume. Alles wirkt bewusst reduziert und bleibt doch sinnlich, weil Material und Licht direkt mit der Natur verschmelzen.



Kawakawa House – Architektur für alle Sinne
Das Kawakawa House ist nicht nur visuell stark, sondern spricht alle Sinne an. Der Salzgeruch des Meeres zieht durch die offenen Flächen, während die Vögel im P?hutukawa-Wald eine Klangkulisse erzeugen. Besonders zur Blütezeit, wenn rote Blüten Tüi und Zikaden anlocken, wird das Haus zum Resonanzraum der Natur. Auch der Wind prägt das Erlebnis: Er lässt die Bäume ächzen und das Blattwerk pulsieren, was im Inneren spürbar bleibt. Architektur wird hier zur Bühne für Wetter, Licht und Geräusche.
Weiterentwicklung einer Idee
Für Herbst Architects ist das Projekt zugleich eine Weiterentwicklung. Schon beim Bau von „Under Pohutukawa“ hatten sie ähnliche Bedingungen vorgefunden. Kawakawa House gilt daher als zweite Iteration, mit klareren Linien und einer noch bewussteren Reaktion auf die Umgebung. Während der Vorgänger fast experimentell wirkte, erscheint dieser Entwurf verfeinert, kontrollierter und zugleich poetischer. Die Lehren der Vergangenheit wurden genutzt, ohne den ursprünglichen Geist zu verlieren.


Architektur als Liebeserklärung
Am Ende ist das Kawakawa House mehr als ein Bauwerk. Es ist Ausdruck einer Haltung, die Architektur nicht als Dominanz, sondern als Dialog versteht. Jedes Detail – von den Obergadenfenstern über die Wahl der Hölzer bis hin zur Positionierung des Innenhofs – erzählt von Respekt und Achtsamkeit. Das Gebäude reagiert auf Licht, Wind und Landschaft, es zieht sich zurück, wo es muss, und öffnet sich, wo es kann. So wird es Teil der Natur, nicht ihr Gegenspieler.
Fazit | tl;dr
Das Kawakawa House steht als Beweis dafür, dass Architektur nicht laut sein muss, um Wirkung zu entfalten. Es ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen, eine Balance zwischen Funktionalität und Poesie. Herbst Architects haben hier nicht nur ein Wohnhaus geschaffen, sondern ein Refugium, in dem Mensch und Landschaft miteinander verschmelzen. Ein echtes Symbol dafür, wie Architektur zum Bindeglied werden kann – zwischen Natur und Kultur, zwischen Schutz und Offenheit, zwischen Rückzug und Freiheit.
Kawakawa House: Architektur als poetische Verbindung von Mensch und Natur
Juicy J veröffentlicht Jazz Album „Caught Up In This Illusion“ 20 Aug 1:17 AM (2 months ago)

Juicy J ist seit Jahrzehnten bekannt für seine kompromisslose Energie und die wuchtigen Bässe von Three 6 Mafia. Doch mit seinem neuen Album „Caught Up In This Illusion“ zeigt Juicy J, dass seine Kreativität längst nicht an Genregrenzen haltmacht. Der Memphis-Veteran legt ein Werk vor, das Hip-Hop mit Jazz verbindet und dabei überraschend persönlich wirkt.
Ein mutiger Schritt in neues Terrain
Wer Juicy J bislang nur mit Clubhits wie „Bandz a Make Her Dance“ oder „Stay Fly“ in Verbindung gebracht hat, dürfte beim ersten Hören erstaunt sein. Statt Synthies und Trap-Drums dominieren Saxophone, Klaviere, Gitarren und Celli. Dieser Bruch ist bewusst gewählt. „Es ist mein wahres künstlerisches Ich, meine echten Emotionen“, erklärte Juicy J zum Release. Mit dem neuen Sound tritt er in eine Sphäre, die man von ihm so noch nicht kannte.
Dass er dabei nicht nur rappt, sondern auch singt, unterstreicht den künstlerischen Anspruch. Besonders auf „Can’t Take That Away From Me“ überrascht er mit einer samtigen Baritonstimme, die seine Verbindung zum Jazz eindrucksvoll hörbar macht.
Reflektierte Texte und tiefer Blick ins Innere
Das Album lebt jedoch nicht nur von der instrumentalen Vielfalt, sondern auch von Juicy J’s Reflektionen. Im Titeltrack zeigt er sich nachdenklich und zugleich stolz: „I can’t leave this rap game alone, it still needs me… Triple Six Mafia we going down as legends.“ Diese Zeilen spiegeln seine Rolle als Pionier und ewiger Teil der Hip-Hop-DNA wider. Er verbindet persönliche Erfahrungen mit einer Botschaft, die weit über sein eigenes Schaffen hinausgeht.
Auch gesellschaftliche Themen finden Platz. Der Song „Please, Stop The Violence In Hip-Hop“ mit Black Thought ist ein eindringlicher Appell gegen Gewalt in der Szene. Damit beweist Juicy J einmal mehr, dass er nicht nur für Partysound steht, sondern auch ernsthafte Inhalte transportieren kann.
Juicy J x Caught Up In This Illusion – Hochkarätige Gäste und musikalische Tiefe
Die Gästeliste von „Caught Up In This Illusion“ ist beeindruckend. Neben The-Roots-Legende Black Thought ist Jazz-Virtuose Cory Henry vertreten, dessen Tastenarbeit den Songs eine unverkennbare Wärme verleiht. Dazu kommt Endea Owens, Grammy- und Emmy-ausgezeichnete Bassistin, die entscheidend zum jazzigen Fundament beiträgt. Gemeinsam formen sie einen Sound, das gleichermaßen frisch wie traditionsbewusst wirkt.
Diese Mischung aus Hip-Hop-Kante und Jazz-Soulfulness verleiht dem Album eine besondere Dynamik. Juicy J gelingt es, beide Welten in Einklang zu bringen, ohne seine Identität zu verlieren.
Teil einer kreativen Hochphase
„Caught Up In This Illusion“ ist bereits das dritte Projekt, das Juicy J 2025 veröffentlicht. Zuvor erschien „Live And In Color“ mit Logic und kurz darauf das Mixtape „Head On Swivel“. Diese Schlagzahl zeigt, dass der Künstler auch nach über 30 Jahren im Geschäft ungebremst arbeitet. Anstatt sich auf alten Erfolgen auszuruhen, sucht er beständig nach neuen Ausdrucksformen.
Mit dem aktuellen Album positioniert er sich endgültig als einer der vielseitigsten Künstler der Gegenwart. Kaum ein anderer Hip-Hop-Veteran schafft es, so glaubwürdig zwischen Partyhits, Conscious Rap und Jazz zu wechseln.
Fazit: Ein Album für Herz und Verstand
„Caught Up In This Illusion“ ist mehr als ein Experiment. Es ist ein Statement. Juicy J beweist, dass künstlerische Entwicklung keine Altersfrage ist, sondern eine Haltung. Mit ehrlichen Texten, mutigen musikalischen Entscheidungen und starken Kollaborationen öffnet er Türen, die viele nicht erwartet hätten. Wer ihn bislang auf eine Rolle reduziert hat, muss umdenken.
Dieses Album zeigt einen Künstler, der seine Vergangenheit ehrt, die Gegenwart gestaltet und die Zukunft definiert. Juicy J ist noch immer hungrig, aber zugleich gelassen genug, um seiner Leidenschaft zu folgen. Genau das macht „Caught Up In This Illusion“ zu einem besonderen Werk in seiner langen Diskografie.
Juicy J – „Caught Up In This Illusion“ // Spotify Stream:
Juicy J – „Caught Up In This Illusion“ // apple Music Stream:
Vampire und Narzissten: Wie alte Mythen moderne Psychopathen erklären // Richard Grannon bei Mark Vicente 19 Aug 6:17 AM (2 months ago)

Im Podcast WTF is on My Mind?! empfängt Filmemacher und Whistleblower Mark Vicente („What the Bleep Do We Know!?“) den britischen Psychologen Richard Grannon. Ausgangspunkt ist ein scheinbar absurdes Bild: Vampire und Narzissten. Doch schnell entwickelt sich ein tiefgründiges Gespräch über Mythologie, Psychologie, Kultur und die Abgründe menschlicher Beziehungen. Die beiden nähern sich dabei einer unbequemen Wahrheit – dass Mythen wie Dracula womöglich frühe Erklärungsversuche für pathologische Persönlichkeitsstrukturen waren.
Vampire als Spiegel des Narzissmus
Richard Grannon beschreibt Vampire als perfekte Metapher für narzisstische Psychopathen. Sie schlafen im Sarg, leben im Reich der Toten, altern nicht und benötigen Blut, um zu überleben. Damit verkörpern sie das parasitäre Wesen von Menschen, die sich von der Energie anderer ernähren. Der Vergleich geht noch weiter: wie Vampire brauchen auch Narzissten die Einwilligung ihres Opfers. Nur wer ihnen die Tür öffnet, wird zum Ziel. Das Bild vom Blutsauger illustriert so die psychologische Realität der „narzisstischen Versorgung“ – den unstillbaren Hunger nach Aufmerksamkeit und Kontrolle.
Vampire und Narzissten – Warum Unschuld so oft zum Ziel wird
Besonders faszinierend ist die Frage, warum Narzissten und Psychopathen gezielt Unschuldige ins Visier nehmen. Vicente und Grannon greifen klassische Motive auf: Dracula begehrt die Jungfrau, das reine Herz, die unberührte Seele. Das Opfer ist nicht dumm, sondern naiv – und diese Naivität erleichtert Manipulation. Der Raub der Unschuld steigert das Gefühl von Macht und Grandiosität. So entsteht eine Dynamik, in der das Reinste und Verletzlichste zum bevorzugten Opfer wird.
Hollywood, Kultführer und die Faszination des Bösen
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kulturellen Verarbeitung dieser Archetypen. Hollywood schreibt Bösewichte seit Jahrzehnten oft komplexer als Helden. Grannon sieht darin nicht nur dramaturgisches Talent, sondern auch verdrängte Fantasien der Autoren. Villains sind Projektionsflächen für unterdrückte Schattenanteile. Dass Kultführer wie Keith Raniere ihre Anhänger zu „Mini-Me’s“ formen wollten, passt in dieses Muster: aus der Faszination für das Böse wird reale Manipulation. Vicente erkennt darin Parallelen zu seiner eigenen Erfahrung im Kampf gegen eine Sekte.
Schattenarbeit und das Licht der Wahrheit
Besonders eindrücklich wird der Vergleich, wenn es um das Licht geht. Vampire zerfallen bei Tageslicht – ebenso wie narzisstische Strukturen, wenn sie im therapeutischen Prozess ans Bewusstsein geholt werden. Grannon betont: Narzissten überleben nur in der Dunkelheit, im Verborgenen, in den Schatten. Schattenarbeit bedeutet, verdrängte Anteile ins Licht zu bringen und damit dem „inneren Vampir“ die Kraft zu entziehen. Vicente ergänzt, dass schon eine teilweise Integration kollektiver Schatten das Gesicht der Welt verändern könnte.
Vampire und Narzissten – Die gefährliche Anziehungskraft des „Bösen“
Ein heikles Thema ist die erotische Faszination für „bad boys“ und dunkle Figuren. Frauen und Männer, so Grannon, projizieren eigene verdrängte Wünsche auf gefährliche Partner. Hier spricht er von „Co-Idealisierung“: nicht nur der Narzisst täuscht, auch das Opfer erschafft sich ein Idealbild und verstrickt sich dadurch tiefer. Diese Dynamik erklärt, warum selbst offensichtlich destruktive Menschen Anziehungskraft besitzen – und warum Popkultur voller Figuren ist, die trotz moralischer Kälte als „sexy“ gelten.
Unterdrückung, Tabus und die Lust am Verbotenen
Die Diskussion führt weiter zur Sexualität. Unterdrückung, so Grannon, befeuert Paraphilien und Fetische. Was verboten ist, wird zum Objekt intensiver Fantasien. In einer Kultur, die einerseits hypersexualisiert und andererseits prüde bleibt, entstehen so Monsterfiguren als „sichere“ Projektionsfläche. Vampire, Werwölfe oder Serienkiller-Figuren erlauben es, verdrängte Energien auszuleben – ohne sich der Realität stellen zu müssen. Doch je mehr Schatten integriert werden, desto weniger Macht haben diese Fantasien.
Zwischen Projektion und Verantwortung
Am Ende betonen beide: Opfer von Narzissten sind keine passiven Figuren. Sie projizieren eigene verdrängte Wünsche ebenso wie Sehnsüchte auf den Täter. Diese Einsicht ist unbequem, weil sie Selbstverantwortung einfordert. Doch gerade darin liegt die Chance auf Heilung: Wer die eigenen Schatten anerkennt, verliert die Faszination für destruktive Archetypen und wird weniger manipulierbar.
Fazit: Mythen als Schlüssel zum Verständnis
Das Gespräch zwischen Vicente und Grannon zeigt, wie tief Mythen mit Psychologie verwoben sind. Vampire sind nicht nur Gruselgestalten, sondern Spiegel unserer kollektiven Angst vor Ausbeutung, Kontrollverlust und innerer Leere. Indem wir diese Bilder verstehen, erkennen wir auch die Mechanismen narzisstischer Manipulation – und können uns bewusster davor schützen. Das Licht, das Vampire verbrennt, ist dieselbe Bewusstheit, die narzisstische Strukturen entmachtet.
Vampire und Narzissten: Wie alte Mythen moderne Psychopathen erklären // Richard Grannon bei Mark Vicente:
Chance The Rapper – „STAR LINE“: Ein strahlendes Comeback 19 Aug 1:25 AM (2 months ago)

Chance The Rapper meldet sich zurück – und wie: Mit STAR LINE veröffentlicht der Chicagoer Wortakrobat sein erstes Album seit 2019. Sechs Jahre hat es gedauert, bis er wieder ein komplettes Werk ablieferte. In dieser Zeit zweifelten viele, ob seine Karriere womöglich schon ihren Höhepunkt überschritten hatte. Doch anstatt zu verblassen, tritt Chance 2025 stärker auf denn je.
Vom Scheitern zur Wiederauferstehung
Als 2019 The Big Day erschien, war die Enttäuschung groß. Das Album wirkte konfus, zu überladen und schien den magischen Funken von Acid Rap oder Coloring Book verloren zu haben. Viele Fans hielten es für das Symbol seines Niedergangs. Mit STAR LINE gelingt nun die vollständige Kehrtwende. Chance The Rapper präsentiert sich reflektiert, hungrig und gleichzeitig gereift. Schon nach den ersten Songs wird klar: Hier tritt kein nostalgischer Veteran an, sondern ein Künstler, der bereit ist, sein eigenes Narrativ neu zu schreiben.
Chance The Rapper x Star Line – Soul, Jazz und politisches Gewicht
Besonders eindrucksvoll ist das Zusammenspiel mit Jamila Woods auf No More Old Men. Über ein jazziges, warmes Instrumental entfalten beide eine Poesie voller Seele. Direkt danach setzt The Negro Problem einen radikalen Akzent. Chance seziert darin die Black-American-Erfahrung, verknüpft historische Wunden mit gegenwärtiger Realität und verleiht seiner Stimme politische Schärfe. Diese Mischung aus introspektiver Lyrik und gesellschaftlichem Kommentar ist eine der großen Stärken des Albums.
Die Rückkehr der Chicago-Connection
Chance vergisst jedoch nicht, wo er herkommt. Auf Back To The Go trifft er auf seinen langjährigen Weggefährten Vic Mensa. Der Track knallt mit Energie und wirkt wie eine Hommage an die eigene Stadt. Mit Joey Bada$$ gelingt auf The Highs & The Lows ein weiterer Höhepunkt: butterweiche Golden-Age-Funk-Vibes treffen auf selbstbewusste Verse, die trotz aller Leichtigkeit tiefgründig wirken.
Länge und Vielfalt als Stärke
Mit 17 Tracks und knapp 80 Minuten ist STAR LINE ein umfangreiches Werk. Nicht jeder Song zündet gleich stark – Tree mit Lil Wayne etwa wirkt behäbig und uninspiriert. Doch diese wenigen Schwächen gehen im Gesamterlebnis unter. Vielmehr überzeugt die Bandbreite: vom Spoken-Word-Stück Letters über das sphärische Speed Of Light bis hin zu Pretty, das zwischen rauer Direktheit und verführerischer Eleganz pendelt.
Chance The Rapper x Star Line – Glanzlichter im Schlussspurt
Besonders im letzten Drittel zeigt Chance seine ganze Klasse. Just A Drop glänzt mit pointiertem Wortspiel, unterstützt von Jay Electronicas präziser Produktion. Und wenn schließlich Jazmine Sullivan mit ihren samtigen R&B-Linien das Finale gestaltet, erreicht STAR LINE eine emotionale Dimension, die dem Album einen würdigen Abschluss verleiht. Diese Songs machen deutlich: Chance hat seine Stimme wiedergefunden – und sie klingt stärker, klarer und fokussierter als zuvor.
Ein gereifter Künstler mit neuer Strahlkraft
Die größte Überraschung liegt vielleicht darin, dass STAR LINE nicht versucht, die Vergangenheit zu kopieren. Zwar blitzt der jugendliche Esprit von Acid Rap immer wieder auf, doch das Album trägt die Handschrift eines Künstlers, der älter und weiser geworden ist. Chance reflektiert über Identität, Verantwortung und Zeit, ohne den spielerischen Charme seiner frühen Werke zu verlieren. Die Balance zwischen Reife und Kreativität gelingt hier meisterhaft.
Fazit: Ein Stern, der heller brennt als zuvor
„What happens when a star doesn’t burn?“ fragt Chance an einer Stelle des Albums. STAR LINE liefert die Antwort: Der Stern verglüht nicht, er explodiert in neuer Intensität. Mit diesem Werk reiht sich Chance nicht nur wieder in die Liga der relevanten Stimmen des Hip-Hop ein, er setzt auch ein starkes künstlerisches Ausrufezeichen. Für Fans ist es ein Fest, für Skeptiker ein Weckruf. Chance The Rapper ist zurück – und sein Licht strahlt weit.
Chance The Rapper – „STAR LINE“ // Spotify Stream:
Chance The Rapper – „STAR LINE“ // apple Music Stream:
Jimmy Kimmel bei Jay Shetty über Angst, Scheitern und das Festhalten am eigenen Humor 18 Aug 5:18 AM (2 months ago)

Jimmy Kimmel kennt das Risiko des Scheiterns besser als viele andere. Seit über 20 Jahren prägt er die Late-Night-Landschaft, doch sein Weg dorthin war gepflastert mit Niederlagen, Kündigungen und Momenten der Selbstzweifel. Im Gespräch mit Jay Shetty im On Purpose Podcast, live aus dem Greek Theatre in Los Angeles, öffnet sich der Entertainer wie selten zuvor. Zwischen bissigen Witzen und ironischen Kommentaren entsteht ein ehrlicher Einblick in ein Leben, das zeigt: Mut, Hartnäckigkeit und ein Schuss Selbsttäuschung können das Fundament echter Größe sein.
Scheitern als notwendige Schule
Jimmy Kimmel erzählt, wie er in den frühen Jahren immer wieder Jobs verlor – nicht zuletzt wegen seiner Liebe zu schrägen Streichen. Bosse mochten es nicht, wenn er ihnen Hotdogs ins Büro schmuggelte oder Golfbags sabotierte. Für ihn war das kein kalkuliertes Risiko, sondern ein Ausdruck seiner Kreativität. Heute blickt er darauf zurück und erkennt: Diese Verluste waren bitter, aber unvermeidlich. Sie zwangen ihn, sich neu zu erfinden, geduldiger zu werden und zu akzeptieren, dass Humor manchmal erst mit zeitlicher Distanz verstanden wird.
Humor als Werkzeug der Heilung
Doch Kimmel macht klar: Witze sind nicht nur Selbstzweck. Humor war für ihn immer eine Möglichkeit, Angst zu kontrollieren und Schmerz zu transformieren. Als Kind lernte er schnell, dass laute Reaktionen seiner Familie die Streiche noch lohnenswerter machten. Später nutzte er dieselbe Energie, um in schwierigen Phasen das Gefühl der Kontrolle zu behalten. Jay Shetty betont, dass Humor in diesem Kontext eine Art Heilungsprozess sein kann – ein Gedanke, den Kimmel sofort bestätigt. Lachen wird zur Waffe gegen Angst, Unsicherheit und den Druck, ständig abzuliefern.
Verletzlichkeit und Therapie
Eine besondere Dimension des Gesprächs ist Kimmels Offenheit über seine Mühe, Gefühle klar auszusprechen. Selbstkritisch gesteht er, dass er lange dazu neigte, ernste Themen mit Witzen abzublocken. Erst durch seine Frau Molly und gemeinsame Therapiesitzungen habe er gelernt, sich mehr zu öffnen. Therapie empfindet er als unbequem, aber immer lohnend. Der Dialog zeigt, wie auch ein gestandener Entertainer lernen muss, die eigenen Schutzmauern abzubauen – und wie Partnerschaft diesen Prozess beschleunigen kann.
Vom Vater zum Großvater
Kimmel ist inzwischen nicht nur Vater, sondern auch Großvater. Diese neue Rolle berührt ihn tief. Seine Tochter Katie brachte kürzlich ein Kind zur Welt, und Kimmel reflektiert, wie seltsam es sei, die eigenen Kinder in der Elternrolle zu sehen. Für ihn bedeutet Großvatersein zugleich eine Chance zur liebevollen Revanche: Süßigkeiten zu verteilen oder Regeln zu missachten – genau die Dinge, die seine Kinder ihm verbieten wollen. Dabei spürt er, wie sich Prioritäten verschieben und wie wichtig familiäre Nähe inmitten des Erfolgs bleibt.
Angst als ständiger Begleiter
Ein zentrales Thema des Gesprächs ist Kimmels Umgang mit Angst. Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen, kennt er die Sorge ums Geld. Später kamen neue Belastungen hinzu: Verantwortung gegenüber Familie, Mitarbeitern und Freunden. Kimmel beschreibt Angst als ein Chamäleon, das seine Form verändert, aber nie verschwindet. Seine Antwort darauf? Kreative Arbeit, das Festhalten an Ritualen und ein fast kindlicher Drang, immer weiter zu gestalten. Und doch bleibt Humor für ihn der zuverlässigste Schutz gegen innere Unruhe.
Helfen, um sich selbst zu heilen
Eine weitere Botschaft zieht sich durch die Unterhaltung: Wer anderen hilft, heilt auch ein Stück weit sich selbst. Kimmel betont, dass man in Momenten von Selbstzweifel oder Wertlosigkeit am besten Kraft findet, indem man sich für andere einsetzt. Für ihn sind Solidarität, Zuhören und kleine Gesten der Menschlichkeit der Schlüssel, um aus emotionalen Tiefs herauszukommen. Es ist ein Gedanke, den Shetty mit Nachdruck aufgreift – und der das Gespräch mit einer universellen Note versieht.
Die Essenz: Delusion, Mut und Ehrlichkeit
Kimmel fasst sein Erfolgsgeheimnis selbstironisch zusammen: „Pure Delusion.“ Der Glaube an den eigenen Weg, auch wenn andere ihn belächeln, war entscheidend. Doch dahinter steckt mehr als Selbsttäuschung. Es ist die Bereitschaft, unerschütterlich an die eigene Stimme zu glauben, Fehler als Lektionen zu akzeptieren und Humor als Schutzschild wie auch als Brücke zu nutzen. Shettys Fazit klingt fast wie ein Mantra: Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, ehrlich zu bleiben, aufzutreten und es immer wieder zu versuchen.
Fazit | tl;dr
Das Gespräch zwischen Jay Shetty (Youtube) und Jimmy Kimmel ist mehr als eine typische Promi-Story. Es ist eine Lektion darüber, wie eng Scheitern, Angst und Erfolg miteinander verwoben sind. Kimmel zeigt, dass Verletzlichkeit keine Schwäche ist, sondern Teil echter Größe. Und er beweist, dass Humor, richtig verstanden, nicht nur Unterhaltung bedeutet – sondern Heilung, Verbindung und Lebenskunst.
Jimmy Kimmel bei Jay Shetty über Angst, Scheitern und das Festhalten am eigenen Humor
TAVE hebt ab – sein Debüt „Fly Away“ setzt neue Maßstäbe im modernen R&B 18 Aug 2:26 AM (2 months ago)

Mit seiner ersten eigenen EP „Fly Away“ präsentiert der Londoner Künstler TAVE, inzwischen in Los Angeles ansässig, einen Auftakt, der sofort Gewicht hat. Bekannt als Grammy-nominierter Produzent und Songwriter, tritt er nun in den Vordergrund und stellt seine eigene Stimme, seine Emotionen und sein Sounddesign ins Zentrum. Das Ergebnis ist ein Projekt, das gleichermaßen verletzlich, atmosphärisch und handwerklich präzise wirkt.
TAVE x Fly Away – Zwischen Intimität und Weite
„Fly Away“ ist eine EP, die ihre Stärke aus Gegensätzen zieht. Die Songs wirken intim, fast wie persönliche Bekenntnisse, zugleich öffnen sie sich in weiten Klangräumen. TAVE gelingt es, die Seele seiner Hörer direkt anzusprechen, ohne jemals in Pathos abzurutschen. Stattdessen baut er mit klarer Stimme und fein geschichteten Arrangements eine Balance zwischen Nachdenklichkeit und Aufbruch. Schon der Opener macht deutlich, dass es hier nicht nur um Musik geht, sondern um einen emotionalen Prozess, der Mut und Verletzlichkeit gleichermaßen zeigt.
Eine illustre Gästeliste
Besonderes Gewicht erhält die EP durch ihre Gäste. Mit Musiq Soulchild, Eric Bellinger, Stacy Barthe, India Shawn und Tia Gordon holt sich TAVE Unterstützung, die sowohl auf Augenhöhe als auch ergänzend funktioniert. Jeder dieser Künstler bringt eigene Nuancen ein, doch der rote Faden bleibt TAVEs Handschrift. Seine Produktion bleibt nie bloße Kulisse, sondern bietet Raum für Stimmen, die ihre ganze Tiefe entfalten dürfen. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit, Kollaboration nicht als Wettbewerb, sondern als harmonische Erweiterung zu gestalten.
Tave – „Fly Away“ als Herzstück
Das Titelstück mit Tia Gordon verkörpert die Essenz des Projekts. Getragen von samtigen Basslinien, warmen Bläsern und einer fast schwerelosen Atmosphäre, schwebt der Song in eine Dimension zwischen Traum und Realität. Die wiederkehrende Zeile „I love this easy fly away“ entwickelt sich zum emotionalen Mantra: Loslassen, Vertrauen, sich in Liebe und Leben fallen lassen. Dieses Stück markiert nicht nur den Höhepunkt der EP, sondern auch TAVEs künstlerisches Statement – eine Einladung, sich von der Musik tragen zu lassen.
Handwerk trifft Seele
Dass TAVE seine Ausbildung an der London School of Music genossen und bereits mit Größen wie 6LACK, SiR, Masego und Jazmine Sullivan gearbeitet hat, spiegelt sich in jedem Detail. Die Produktion ist präzise, fast chirurgisch, doch nie steril. Im Gegenteil: Die Tracks atmen, sie bewegen sich zwischen digitaler Raffinesse und organischer Wärme. Es ist diese Mischung aus technischem Können und emotionalem Tiefgang, die „Fly Away“ so besonders macht.
Ein neuer Fixpunkt im R&B
TAVE steht noch am Anfang seiner Karriere als Solokünstler, doch die Richtung ist klar. BBC, Capital XTRA, UPROXX und Apple Music haben ihn längst auf dem Radar, und es ist absehbar, dass „Fly Away“ seine Reichweite noch erweitern wird. Die EP zeigt nicht nur, dass er ein begnadeter Produzent ist, sondern auch, dass er als Sänger und Songwriter eigene Geschichten erzählen kann. Geschichten, die berühren, ohne belehrend zu sein, und die auf subtile Weise Stärke und Verletzlichkeit vereinen.
Fazit
„Fly Away“ ist mehr als nur ein Debüt – es ist ein klares Zeichen dafür, dass TAVE seinen Platz gefunden hat. Er hebt ab, doch bleibt dabei geerdet. Zwischen introspektiven Momenten und hymnischen Passagen baut er eine Klangwelt, die vertraut und neu zugleich wirkt. Für Fans von modernem R&B ist diese EP Pflichtprogramm, für TAVE selbst ist sie der Beginn einer Reise, die noch weit führen wird.
TAVE – „Fly Away“ // Spotify Stream:
TAVE – „Fly Away“ // apple Music Stream:
„Zen Garden Exploration 15“ – Ruhige Harmonie im Sand (15 Minuten Meditation) 15 Aug 5:20 AM (2 months ago)

Mit dem ersten Klick beginnt eine fast tranceartige Reise: 15 Minuten Sand, Steine und subtil eingefügte Muster – das Video „Zen Garden – Exploration?15“ entfaltet eine stille Poesie in Bewegung. Im Fokus steht eine kleine, hölzerne Harke, die vorsichtig, nahezu meditativ Muster in ein feines Sandbett zieht, während zwei Steine als stumme Wegweiser fungieren. Ruhige Harmonie im Sand, das Video „Zen Garden Exploration 15“ (YT) ist so etwas wie eine 15 Minuten Meditation.
Minimalismus in Bewegung – das Prinzip hinter dem Video
Diese filigrane Arbeit ist mehr als bloßes Sandharken – sie ist Ausdruck einer jahrhundertealten japanischen Tradition: Karesansui, der japanische Trockenlandschaftsgarten, häufig auch als „Zen-Garten“ bekannt. In diesen Gärten symbolisieren Steine Berge oder Inseln, während Sand oder feiner Kies – kunstvoll mit Harke oder Rechen gezogen – Wasseroberflächen, Wellen oder Flussläufe andeuten. Die Sandmuster, oft Samon („Sandmuster“) genannt, erzeugen Bewegung im Stillen.
Zen Garden Exploration – Die Kraft der Einfachheit, philosophischer Unterbau
Karesansui entfaltet seine Wirkung durch Reduktion: Weniger ist mehr. Die Gestaltung nähert sich der Essenz von Landschaft ohne Überflüssigkeit – eine Ästhetik, die tief mit Zen-Buddhismus verwurzelt ist. Steine symbolisieren Berge oder spirituelle Stationen, der Sand erinnert an Wasser – doch das Wasser bleibt unsichtbar, suggeriert durch stilisierte Linien. Diese Leere, das bewusste Spiel mit Raum (yohaku-no-bi: Schönheit der Leere), lädt zur Meditation und inneren Ruhe ein.


YouTube-Momente – was siehst du im Kommentarfluss?
Typische Kommentare auf solchen meditativen Videos lauten auch hier:
„So beruhigend!“ • „Fast hypnotisch, diese sich wiederholenden Muster.“ • „Ich könnte ewig zuschauen.“
Diese Reaktionen spiegeln die Wirkung wider, die auch „Zen Garden – Exploration 15“ entfaltet: eine nonverbale Einladung zum Innehalten, zum achtsamen Mitbewegen mit der Harke.
Warum dieses Video so besonders ist
- Langsamkeit & Konzentration: 15 Minuten ohne Eile, in einem fortlaufenden Fluss vollendet gezogener Linien.
- Nano-Landschaft: Die zwei Steine setzen Akzente – sie geben visuelle Bezugspunkte und schaffen Spannung im sonst homogenen Sandfeld.
- Idee von Vergänglichkeit: Jede Linie ist temporär; Sand wird wieder umgelegt. Genau in diesem Moment liegt die Schönheit – nicht im bleibenden Bild.
- Eigenes Miniatur-Karesansui: Winzige Szenerie, große Wirkung. Du hältst deinen Atem an, spürst die Leichtigkeit eines vollendeten Samon-Moments.
Fazit:
„Zen Garden – Exploration 15“ ist kein gewöhnliches Video, sondern ein kurzer akustisch-visueller Zen-Raum. Es verkörpert Karesansui als Bewegung – nicht als festes Arrangement, sondern als fließende, leise Performance. Die Harke wird zum Feinschleifer des Geistes, der Sand zur Leinwand – mit nur zwei Steinen als Kompass. Ideal zum Zuschauen, Entspannen – oder einfach zum Sein.
Ruhige Harmonie im Sand – „Zen Garden – Exploration 15“ (15 Minuten Meditation)
Evidence veröffentlicht „Unlearning Vol. 2“ // Ft. Larry June, Domo Genesis, The Alchemist 15 Aug 1:36 AM (2 months ago)

Evidence, Rapper und Produzent aus Venice, Kalifornien, kehrt mit Unlearning Vol. 2 zurück. Als Teil der legendären Dilated Peoples wurde er in den 90ern bekannt. Seit 2007 verfolgt er erfolgreich eine Solokarriere und ist seit 16 Jahren fester Bestandteil von Rhymesayers Entertainment (YT). Mit diesem fünften Soloalbum knüpft er direkt an Unlearning Vol. 1 an und setzt auf Weiterentwicklung statt Stillstand.
Evidence Unlearning 2 – Ein Einstieg ohne Energieverlust
Der Opener „Plans Change“, produziert von Sebb Bash, liefert funky Beats und eine klare Botschaft: Evidence verliert keinen Dampf. Direkt darauf folgt „Different Phases“ von Beat Butcha, in dem er bekennt, die „Spielregeln“ nie gelesen zu haben. „Future Memories“ mit Larry June, produziert von The Alchemist, bringt jazzige Wärme, bevor „Outta Bounds“ das Bild vom Künstler zeichnet, der bewusst außerhalb der Linien arbeitet.
Reduktion und Selbstreflexion
„Seeing Double“ verzichtet komplett auf Drums und fordert, Vertrauen aus Liebe zu schenken. Der lo-fi-lastige, selbst produzierte Track „Nothing to See Here“ zeigt Evidence als authentischen Rapper, der keine Rolle spielt. Mit „Define Success“ am Piano definiert er Erfolg aus persönlicher Sicht, während „Stay Alive“ mit Blu davon erzählt, was das Leben am Laufen hält.
Persönliche Verletzlichkeit und Hunger
In „Nothing’s Perfect“ vergleicht er sein Leben mit einer Playlist. „Favorite Injury“ mit Domo Genesis trägt klassischen Chipmunk-Soul und beschreibt eine Ungeduld, die bis zum letzten Atemzug bleibt. C-Lance liefert für „Top Seeded“ minimalistisches Sampling, bevor „Greatest Motivation“ die provokante These aufstellt, dass Hass ein stärkerer Antrieb als Liebe sein kann.
Kreative Partnerschaften und konsequenter Abschluss
Mit „Rain Every Season“ feiern Evidence und The Alchemist als Step Brothers ein Wiedersehen, verbinden Jazz und Boom Bap und sprechen über die dünner werdende Geduld bei ausbleibender Inspiration. „Laughing Last“ erzählt vom Durchhalten gegen Widerstände. Den Schlusspunkt setzt „Dutch Angle“, das mit einem müden Vocal-Sample und einer klaren Ansage endet: Er wird in seiner Stadt nicht in Vergessenheit geraten.
Evidence x Unlearning 2 – Transformation statt Nostalgie
Unlearning Vol. 2 legt den Fokus weniger auf Komfort, sondern auf Veränderung. Evidence nutzt das offene Ende des Vorgängers, um tiefer und instinktiver zu arbeiten. Das Album klingt soulvoller als der Vorgänger, bleibt aber experimentell verwurzelt. Jeder Track wirkt wie ein gezielter Pinselstrich auf einer Leinwand aus Schmerz, Erfahrung und präziser Kreativität.
Evidence – „Unlearning Vol. 2“ // Spotify Stream:
Evidence – „Unlearning Vol. 2“ // apple Music Stream:
Bhava Samadhi – Zwischen heiliger Ekstase und spiritueller Falle 14 Aug 6:01 AM (2 months ago)

Bhava Samadhi klingt wie das ultimative spirituelle Ziel: Tränen der Ekstase, zitternder Körper, ein Herz, das in göttlicher Liebe zu schmelzen scheint. Doch diese Form der Hingabe birgt eine subtile Gefahr. Sie kann zu einem emotionalen Rausch werden, der das Gefühl von Erleuchtung vermittelt, während die eigentliche Transformation ins Stocken gerät.
Bhava bedeutet „Gefühl“ oder „emotionale Haltung“, Samadhi „Absorption“ oder „Vereinigung“. In Bhava Samadhi verschmilzt der Geist mit einer intensiven Emotion, doch das Ego bleibt erhalten. Die Trennung zwischen „Ich“ und dem Göttlichen verstärkt sich sogar – der Suchende bleibt der Liebende, nicht das Verschmolzene.
Bhava Samadhi – Historische Beispiele und spirituelle Einordnung
Der indische Heilige Sri Ramakrishna erlebte Bhava Samadhi häufig. Beim Singen für die Göttin Kali fiel er in stundenlange Trance, weinend und regungslos. Ähnliche Berichte stammen aus Vrindavan, wo Gläubige in Festen ekstatisch zusammenbrechen.
Spirituelle Texte unterscheiden drei Formen:
- Sattwige Bhava – die reinste Variante, gekennzeichnet durch Stille, unwillkürliche Tränen, Demut.
- Rajasische Bhava – energiegeladen, mit Tanz und Gesang, oft gemischt mit Ego und Selbstdarstellung.
- Tamasische Bhava – geprägt von Verwirrung, Fanatismus oder psychischer Instabilität, die als Spiritualität missverstanden wird.
Wenn Hingabe zur Abhängigkeit wird
Bhava Samadhi kann wie eine süchtig machende Droge wirken. Die Erfahrung ist so überwältigend, dass der Suchende den Zustand selbst jagt, statt die Quelle zu suchen. Besonders in modernen Kirtan-Szenen wird dieser emotionale Höhepunkt oft zum eigentlichen Ziel, während das innere Wachstum stagniert. Lehrer wie Ramana Maharshi warnten davor: Selbst göttlich wirkende Gefühle sind Bewegungen des Geistes, nicht das reine, unbewegte Bewusstsein. Wer Bhava festhalten will, klammert sich an Wolken – statt sich in das Meer der Stille aufzulösen.
Bhava als Tor, nicht Endstation
Im klassischen Bhakti-Yoga gilt Bhava nicht als Ziel, sondern als Beginn. Reine Hingabe (Prema) entsteht, wenn Bhava über Zeit gereift und geläutert wird. Dann ist keine dramatische Geste nötig, um die Tiefe der Liebe zu beweisen. Spirituell gereifte Meister wie Anandamayi Ma zeigten diese Stille: Ihre Präsenz allein bewegte andere zu Tränen, ohne sichtbare Ekstase. Sie lehrte, dass die eigentliche Kostbarkeit bleibt, wenn alle emotionalen Wellen verebben.
Bhava Samadhi – Zwischen Gefahr und Gnade
Bhava kann ein Geschenk sein – wie Regen nach einer Dürre. Doch wer es festhält, riskiert Stagnation. Authentische Bhava hinterlässt Frieden, Demut und zentrierte Liebe. Gesuchte oder inszenierte Ekstase dagegen nährt das Ego und entfernt vom Ziel.
Nim Karoli Baba brachte es auf den Punkt: „Gott sieht das Innere.“ Wahre Hingabe braucht kein Publikum. Wer Bhava erlebt, darf es zulassen, aber auch vorbeiziehen lassen. Entscheidend ist, ob danach mehr Stille, Liebe und innere Freiheit zurückbleiben.
Fazit:
Bhava Samadhi kann ein kraftvoller Moment auf dem spirituellen Weg sein – oder eine verführerische Sackgasse. Ob es dich weiterführt, hängt davon ab, ob du den Rausch jagst oder die stille Quelle suchst.
Bhava Samadhi – Zwischen heiliger Ekstase und spiritueller Falle
Omar performt live mit Band beim Tiny Desk Concert – Britischer Soul mit zeitloser Eleganz 14 Aug 3:03 AM (2 months ago)

Wenn Omar Lye-Fook beim Tiny Desk Concert den Song „This Is Not a Love Song“ anstimmt, wirkt das fast ironisch. Denn seine Karriere ist seit über 40 Jahren geprägt von tiefempfundenen Liebesliedern. Der britische Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist aus Kent hat mit seiner Stimme und seinen Kompositionen die britische Soul-Szene entscheidend mitgeprägt. Nun brachte er diesen unverwechselbaren Sound ins NPR-Headquarter – und verwandelte den kleinen Raum in ein intimes Soul-Paradies.
Eine Legende mit bewegter Karriere
Omar gilt als Pionier des Neo Soul und als Brückenbauer zwischen klassischem R&B, Jazz und Reggae-Einflüssen. Schon sein Debüt „There’s Nothing Like This“ von 1990 setzte neue Maßstäbe. Der Song öffnete ihm Türen zu Kollaborationen mit Stevie Wonder, Erykah Badu und der verstorbenen Angie Stone. Im Laufe seiner Karriere hat er immer wieder bewiesen, dass Soul-Musik nicht nur vom Herzen kommt, sondern auch den Zeitgeist überdauern kann.
Omar Tiny Desk Concert – Stilvoll und voller Energie
Für seinen Auftritt trat Omar in elegantem Outfit auf, gekrönt von seinen ikonischen High-Top-Locs. Sein Blick beim Betreten des Tiny-Desk-Sets verriet ehrliche Überraschung – vielleicht wegen der vielen treuen Fans, die dicht gedrängt den Raum füllten. Diese Energie griff er auf und verwandelte sie in eine Performance, die gleichermaßen sanft, groovend und emotional intensiv war.
Die Band, geleitet von Bassist und musikalischem Direktor Mike Griot, sorgte für ein sattes Fundament. Teddy Crockett an der Gitarre, Eric Brown am Schlagzeug, Raleigh Neal II an den Keys sowie Vivian Sessoms mit warmen Background-Vocals hielten die Dynamik lebendig. Die Bläsersektion mit Aaron Broadus an der Trompete und Antonio Parker am Saxophon brachte zusätzlichen Glanz.
Songs, die Geschichte erzählen
Das Set begann mit „Can We Go Out?“, einem smoothen Groove, der sofort Wärme und Intimität erzeugte. Mit „The Man“ brachte Omar eine selbstbewusste, fast funkige Energie ins Spiel, bevor „Little Boy“ tiefere, nachdenklichere Töne anschlug. „This Is Not a Love Song“ stand als bewusst gewählter Kontrast im Raum – ein Titel, der den Humor und die Vielschichtigkeit seines Songwritings unterstreicht. Zum Abschluss folgte „There’s Nothing Like This“, der Klassiker, mit dem Omar einst Musikgeschichte schrieb.
Omar Tiny Desk Concert – Mehr als ein Konzert, ein Statement
Dieses Tiny Desk war mehr als nur ein nostalgischer Rückblick. Es zeigte, dass Omar seine Musik mit derselben Leidenschaft und Frische spielt wie vor Jahrzehnten. Sein Gesang bleibt warm, geschmeidig und präzise, seine Bühnenpräsenz charismatisch und nahbar. Die Chemie zwischen ihm und der Band war spürbar, jeder Blick, jedes Nicken fügte sich zu einem harmonischen Ganzen.
Omar bewies einmal mehr, dass Soul nicht nur ein Genre, sondern eine Haltung ist. Eine, die auf Authentizität, Verbindung und zeitloser Musikalität beruht – und die im kleinen, intimen Rahmen des Tiny Desk (Youtube) umso stärker wirkt.
Omar performt live mit Band beim Tiny Desk Concert
Wie TikTok und Instagram deinen Geist schwächen – Dr. Ks Warnung und Ausweg 13 Aug 3:59 AM (2 months ago)

Alok M. Kanojia, besser bekannt als Dr. K, ist Psychiater, YouTuber und Mitgründer von Healthy Gamer. Seine Mission ist es, Menschen zu helfen, ihre mentale Gesundheit in einer von Technologie geprägten Welt zu schützen. Im After Skool-Video „How To Reclaim Your Attention (and your life)“ analysiert er, wie Smartphones und (Anti-)Social Media unseren Fokus zerstören und wie wir ihn gezielt zurückerobern können.
Wie Technologie unseren Geist schwächt
Technologie fesselt uns mit kurzen, intensiven Reizen. Ein süßes Katzenvideo auf TikTok kann für einen Moment völlige Aufmerksamkeit erzeugen. Doch diese Form von Konzentration entsteht nicht durch eigene Willenskraft, sondern durch externe Stimuli. Genau wie beim Fahrstuhl: Wer ihn ständig nutzt, verliert Muskelkraft. Unser „Aufmerksamkeitsmuskel“ funktioniert ähnlich. Je mehr wir uns auf externe Reize verlassen, desto schlechter können wir unseren Fokus aus eigener Kraft halten. Dadurch ertragen wir Langeweile immer weniger. Alles wirkt fade – außer den schnellen digitalen Belohnungen. Und wenn wir uns schlecht fühlen, greifen wir automatisch wieder zum Smartphone. Das lindert kurzfristig den inneren Druck, macht uns jedoch langfristig abhängiger.
Wie TikTok und Instagram deinen Geist schwächen – Der Teufelskreis der digitalen Betäubung
Dr. K vergleicht diesen Mechanismus mit Opiatabhängigkeit. Wer innere Unruhe oder negative Gedanken verspürt, sucht schnell eine Ablenkung. Das Smartphone wirkt wie ein Schmerzmittel, das Symptome unterdrückt, aber die Ursache nicht heilt. Je häufiger wir dieses „digitale Opiat“ konsumieren, desto empfindlicher reagieren wir auf Unruhe und desto schwächer wird unsere Fähigkeit, sie auszuhalten. Das verstärkt die Abhängigkeit weiter. Die Folge ist ein Kreislauf aus Reizsuche und mentaler Erschöpfung. Dr. K sieht hierin einen zentralen Faktor für den weltweiten Anstieg von Angststörungen, Depressionen und Einsamkeit.
Aufmerksamkeit als wertvollstes Gut
Aufmerksamkeit ist für Dr. K unsere wichtigste Ressource. Wer sie gezielt auf Lernen, Arbeit oder persönliche Projekte richtet, erzielt Fortschritte. Doch soziale Plattformen wollen genau diese Ressource besitzen – um Werbung zu verkaufen und unser Verhalten zu beeinflussen. Sobald andere unsere Aufmerksamkeit kontrollieren, kontrollieren sie auch unser Leben. Das geschieht oft schleichend: Wir öffnen eine App „nur kurz“ und verlieren Stunden, ohne genau zu wissen, wie es passiert ist. Algorithmen verstärken emotionale Reaktionen, formen Ansichten und treiben gesellschaftliche Spaltungen voran.
Warum wir Langeweile wieder zulassen müssen
Früher gab es im Alltag regelmäßig Phasen ohne Ablenkung. Diese „Idle Time“ nutzte das Gehirn, um Emotionen zu verarbeiten. Ein Beispiel: Zwei Jäger gehen gemeinsam auf die Jagd. Einer trifft nicht, der andere erlegt das Tier. Auf dem stundenlangen Rückweg hat der Unterlegene Zeit, Gefühle wie Neid oder Enttäuschung zu verarbeiten, bis sie sich von selbst abschwächen. Heute greifen wir in solchen Momenten sofort zum Smartphone. Dadurch unterdrücken wir vorhandene Emotionen und erzeugen gleichzeitig neue – etwa durch Nachrichten, Social-Media-Posts oder provokante Videos. Die unverarbeiteten Gefühle stauen sich im Unterbewusstsein an und können langfristig zu Gereiztheit, Antriebslosigkeit oder depressiven Verstimmungen führen.
Trataka – gezieltes Training für den Fokus
Um den „Aufmerksamkeitsmuskel“ zu stärken, empfiehlt Dr. K die Trataka-Meditation. Diese aus dem Yoga stammende Konzentrationspraxis besteht darin, den Blick ohne Blinzeln auf einen festen Punkt – oft eine Kerzenflamme – zu richten. Im Gegensatz zur Atemmeditation wirkt Trataka visuell stimulierend, was in unserer augenfokussierten Gesellschaft ein Vorteil sein kann. Sie fühlt sich fordernd an und erzeugt schnell ein Gefühl von Fortschritt. Zudem bietet sie eine unmittelbare Erfahrung, die Technologie nicht liefern kann. Wer nach einer Trataka-Sitzung die Augen schließt, sieht oft Farbmuster, die außerhalb des sichtbaren Spektrums liegen – ein Effekt, der fasziniert und motiviert. Dr. K betont außerdem, dass Trataka das sogenannte Ajna-Chakra reinigt und so intuitives Verstehen und spirituelles Wachstum fördern kann.
Aufmerksamkeit zurückerobern – Leben zurückerobern
Für Dr. K ist der Zusammenhang klar: Wer seine Aufmerksamkeit verliert, verliert Kontrolle über sein Leben. Algorithmen nutzen jede Gelegenheit, um uns länger am Bildschirm zu halten. Dabei formen sie unsere Emotionen, Meinungen und Entscheidungen – oft ohne unser Bewusstsein. Der erste Schritt zur Rückeroberung ist, sich dieser Dynamik bewusst zu werden. Der zweite Schritt ist aktives Training der Aufmerksamkeit, etwa durch Meditation, fokussiertes Lesen oder kreative Arbeit ohne Ablenkung. Ebenso wichtig ist es, Leerlaufzeiten bewusst zuzulassen, damit das Gehirn Emotionen verarbeiten und innere Balance herstellen kann.
Wie TikTok und Instagram deinen Geist schwächen – Fazit
Dr. K liefert mit seiner Analyse einen präzisen Blick auf ein unterschätztes Problem unserer Zeit: den schleichenden Verlust unserer Aufmerksamkeit. Technologie ist nicht per se schädlich, doch ihr unreflektierter Einsatz macht uns mental schwächer, abhängiger und unruhiger. Wer diesen Kreislauf durchbrechen will, muss den „Aufmerksamkeitsmuskel“ bewusst trainieren, digitale Reizquellen dosieren und wieder lernen, mit Langeweile zu leben. Denn die Rückeroberung unserer Aufmerksamkeit ist letztlich die Rückeroberung unseres Lebens.
Wie TikTok und Instagram deinen Geist schwächen – Dr. Ks Warnung und Ausweg
Der After Skool Beitrag oben stammt aus diesem Podcast, den ich ohnehin noch auf WHUDAT veröffentlichen wollte. Machen wir es also einfacher und fügen ihn hier direkt ein – diese drei Stunden sollte man sich nehmen.
Wie östliche Weisheit und Neurowissenschaft zusammenwirken, um das menschliche Potenzial freizusetzen:
Kenn Starr & Kev Brown droppen Collabo-Projekt „COLD“ 13 Aug 12:43 AM (2 months ago)

Kenn Starr meldet sich zurück. Der MC mit dem lässigen Flow bringt gemeinsam mit Produzenten-Legende Kev Brown ein Album, das in jeder Sekunde authentisch klingt. Es ist die erste größere Veröffentlichung von Starr seit längerer Zeit. Doch die beiden setzen genau dort an, wo ihre früheren Kollaborationen aufhörten. Kev Brown liefert druckvolle, detailverliebte Beats. Kenn Starr rappt konzentriert, ehrlich und mit unverkennbarer Gelassenheit.
„Go For Broke“ – Der Blick in den Spiegel
Der Track „Go For Broke“ gibt Einblick in die lange Pause von Kenn Starr. In der letzten Strophe erklärt er, wie er die Zeit genutzt hat. Über Browns warmen Synth-Layer rappt er selbstkritisch: „You never get the second chance to make a first impression / Thought I was an exception, I guess I learned my lesson“. Anschließend beschreibt er, wie er jahrelang an der perfekten Platte arbeitete. Sieben Jahre voller Schweiß und Zweifel, aber auch voller Hingabe. Man spürt, dass er den Respekt der Hörer nicht mit schnellen Veröffentlichungen, sondern mit Qualität sichern will.
„Respect the Process“ – Selbstverständnis eines Hip-Hop-Veteranen
In „Respect the Process“ betont Starr seine musikalischen Wurzeln. Er steht in der Tradition von Slum Village und A Tribe Called Quest. Doch er weiß, dass sein persönlicher Höhepunkt noch bevorsteht. Die Lines wirken selbstbewusst, aber nicht überheblich. Er zeigt, dass Ausdauer und Fokus wichtiger sind als kurzfristiger Ruhm.
Kenn Starr auf Kev Browns Produktion – Präzision und Tiefe
Kev Brown bringt auf „COLD“ eine Produktion, die gleichermaßen groovt und Raum für Starrs Texte lässt. Jeder Track sitzt im richtigen Tempo. Die Drums sind satt, die Samples clever gesetzt. „DDTP“ etwa wirkt zugleich entspannt und unheimlich. Dieses Spannungsfeld macht Browns Beats so besonders. Gast-MC Kaimbr passt sich perfekt an und liefert eine Strophe, die den Song abrundet.
Gäste und zusätzliche Elemente
Neben Kaimbr treten auch Supastition, Tanya Morgan und Nathaniel Star auf. Sie sorgen für Abwechslung und ergänzen Starrs Stil. DJ Jon Doe bringt klassische Scratches ins Spiel. Sie verstärken das organische Hip-Hop-Gefühl und geben den Songs eine zusätzliche Ebene. Das Zusammenspiel zwischen Browns Produktion, Starrs Flow und den Gästen wirkt harmonisch und durchdacht.
Fazit – Hip-Hop mit Haltung
„COLD“ ist ein Album, das von Erfahrung und Liebe zum Handwerk lebt. Kenn Starr (Youtube) bringt ehrliche Texte, die mehr sind als reines Entertainment. Kev Brown liefert einen Sound, der im Hier und Jetzt steht, aber auch an goldene Zeiten erinnert. Zusammen erschaffen sie ein Werk, das seine Stärke in Konsistenz und Seele findet. Wer authentischen Hip-Hop sucht, sollte hier reinhören – am besten sofort.